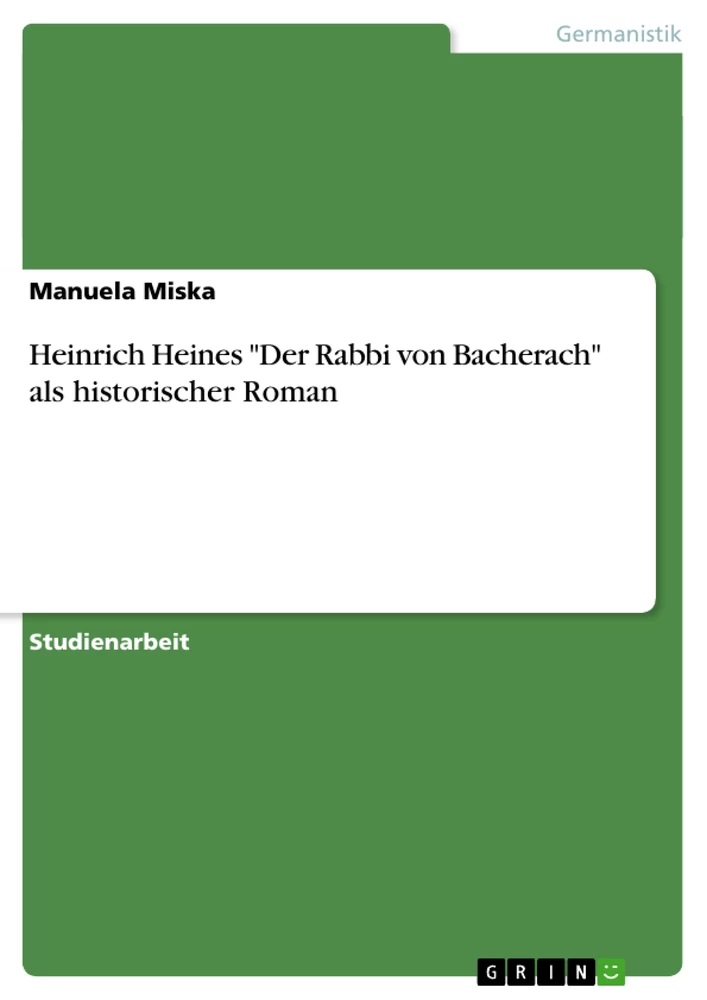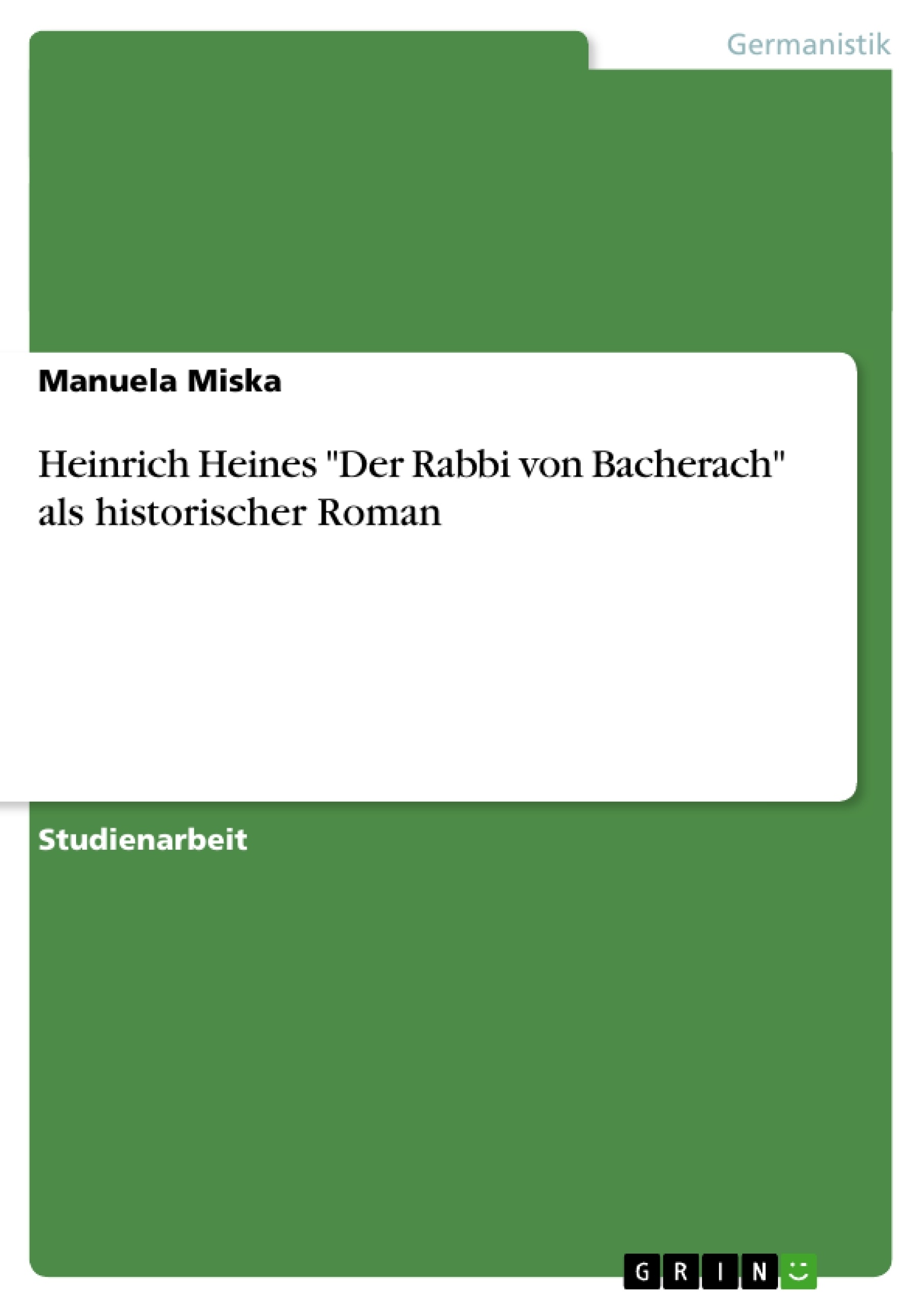„Wenige Werke Heines geben dem Leser mehr Rätsel auf als der ‚Rabbi von Bacherach‘“ , konstatierte Erich Loewenthal zu Beginn seines Aufsatzes „Der Rabbi von Bacherach“. Loewenthal bezieht sich mit dieser These insbesondere auf den fragmentarischen Charakter des Werkes, auf den durch einen stagnierenden Erzählfluss unterdrückten Höhepunkt der Handlung sowie auf die Mischung von Ernsthaftigkeit, Tragik, Satire und Posse, deren Vereinigung dem Autor in der Erzählung kaum gelinge. Heines „Der Rabbi von Bacherach“ ist bei weitem keine makellose Erzählung und auch die zeitgenössische Leserschaft konnte der Autor mit diesem Werk kaum erreichen: Der „Rabbi“ erhielt nach seiner Veröffentlichung in Heines "Salon IV" 1840 vorrangig schlechte Kritiken oder wurde gar nicht beachtet. Viele Leser sehen in dieser Erzählung noch heute die weitläufige Meinung bestätigt, Heine habe kaum über erzählerisches Talent verfügt.
Setzt man sich jedoch genauer mit dem „Rabbi“ auseinander, so gilt es bei dieser Erzählung in besonderem Maße, Entstehungsbedingungen und Entstehungszeit sowie die lebensweltlichen Hintergründe des Autors zu berücksichtigen. Die Genese des „Rabbi“ dauerte insgesamt über 15 Jahre: Während Heine die ersten beiden Kapitel 1824 und 1825 verfasste, fuhr er mit der Arbeit am dritten Kapitel erst 1840 fort. Es ist davon auszugehen, dass die Motivationen Heines sich in dieser Zeit deutlich veränderten. [...] In der Anfangszeit noch konzipiert als „historisches Sittengemälde“ des Judentums im Spätmittelalter wandelt sich die Erzählung im dritten Kapitel erkennbar zu einer autobiographisch-gefärbten Dichtung, die vom Prototyp des historischen Romans nach Scott deutlich abweicht.
Im Folgenden soll der „Rabbi von Bacherach“ als historischer Roman betrachtet und untersucht werden, wobei die Abweichungen von seiner ursprünglichen Konzeption Erläuterung finden sollen. Dazu erfolgen eine Einführung in den historischen Roman zur Entstehungszeit des ersten Kapitels sowie ein Überblick über die Merkmale des die damalige Literaturwelt dominierenden historischen Romans Walter Scotts. Weiterhin werden die prägnantesten historischen Elemente aus den einzelnen Kapiteln des „Rabbi“ aufgeführt, erläutert und, soweit wie möglich, ihre Quellen benannt. Besonderes Augenmerk wird auf den in der Forschung umstrittenen „Stilbruch“ im dritten Kapitel gelegt, wobei mögliche Gründe für denselben in der Textgenese sowie in der Lebensgeschichte des Autors gesucht werden.
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG
- 1. DER HISTORISCHE ROMAN ZUR ENTSTEHUNGSZEIT DES ERSTEN KAPITELS.
- 1.1 DIE EINFLÜSSE WALTER SCOTTS.
- 2. DIE HISTORISCHEN DARSTELLUNGEN IM,,RABBI VON BACHERACH"
- 2.1 JÜDISCHES LEBEN IM MITTELALTER - RITUALMORD-VORWÜRFE UND POGROME..
- 2.2 DIE DARSTELLUNG FRANKFURTS AM MAIN UND DES JÜDISCHEN GHETTOS.
- 2.3 DER SPANIEN-KOMPLEX UND DON ISAAK ABARBANEL.
- 3. VOM HISTORISCHEN ROMAN ZUR „BEKENNTNISDICHTUNG“? – DER,,STILBRUCH“ IM DRITTEN KAPITEL ........
- SCHLUSSBETRACHTUNG
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Heinrich Heines Fragment "Der Rabbi von Bacherach" als historischen Roman. Sie analysiert die Genese des Werkes und dessen Abweichungen von der ursprünglichen Konzeption. Dazu werden die Einflüsse Walter Scotts auf den historischen Roman sowie die historischen Elemente in Heines Erzählung beleuchtet.
- Der historische Roman zur Entstehungszeit des ersten Kapitels
- Die historischen Darstellungen im "Rabbi von Bacherach"
- Der "Stilbruch" im dritten Kapitel
- Heines Einstellung zum Judentum
- Die Lebensgeschichte des Autors
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel befasst sich mit dem historischen Roman zur Entstehungszeit des ersten Kapitels von Heines "Rabbi von Bacherach" und untersucht den Einfluss Walter Scotts auf diese Gattung. Es werden die charakteristischen Merkmale des historischen Romans und dessen Bedeutung in der Literatur des frühen 19. Jahrhunderts beleuchtet.
Das zweite Kapitel analysiert die historischen Elemente in Heines Erzählung. Es werden die Darstellung des jüdischen Lebens im Mittelalter, die Darstellung Frankfurts am Main und des jüdischen Ghettos sowie Heines Auseinandersetzung mit dem "Spanien-Komplex" und Don Isaak Abarbanel betrachtet.
Das dritte Kapitel befasst sich mit dem sogenannten "Stilbruch" in Heines "Rabbi von Bacherach" und untersucht die Gründe für die Abweichungen von der ursprünglichen Konzeption. Es werden mögliche Gründe für diesen Stilwandel in der Textgenese und der Lebensgeschichte des Autors gefunden.
Schlüsselwörter
Historischer Roman, Walter Scott, Heinrich Heine, "Der Rabbi von Bacherach", Judentum, Mittelalter, Frankfurt am Main, "Stilbruch", Lebensgeschichte, Textgenese.
- Citation du texte
- Manuela Miska (Auteur), 2007, Heinrich Heines "Der Rabbi von Bacherach" als historischer Roman, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/86114