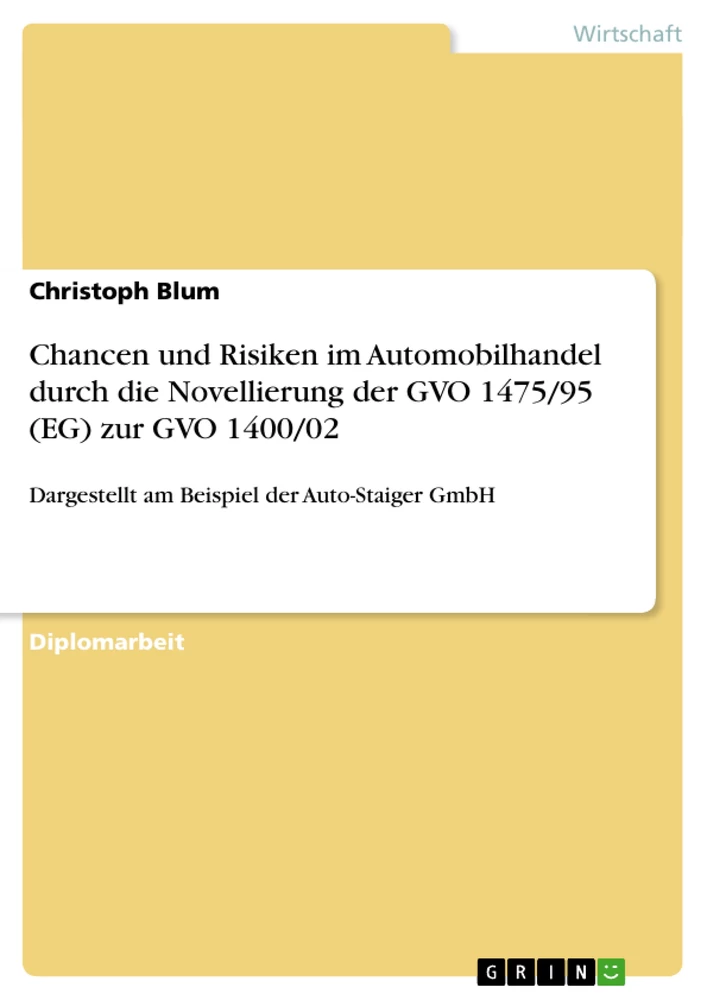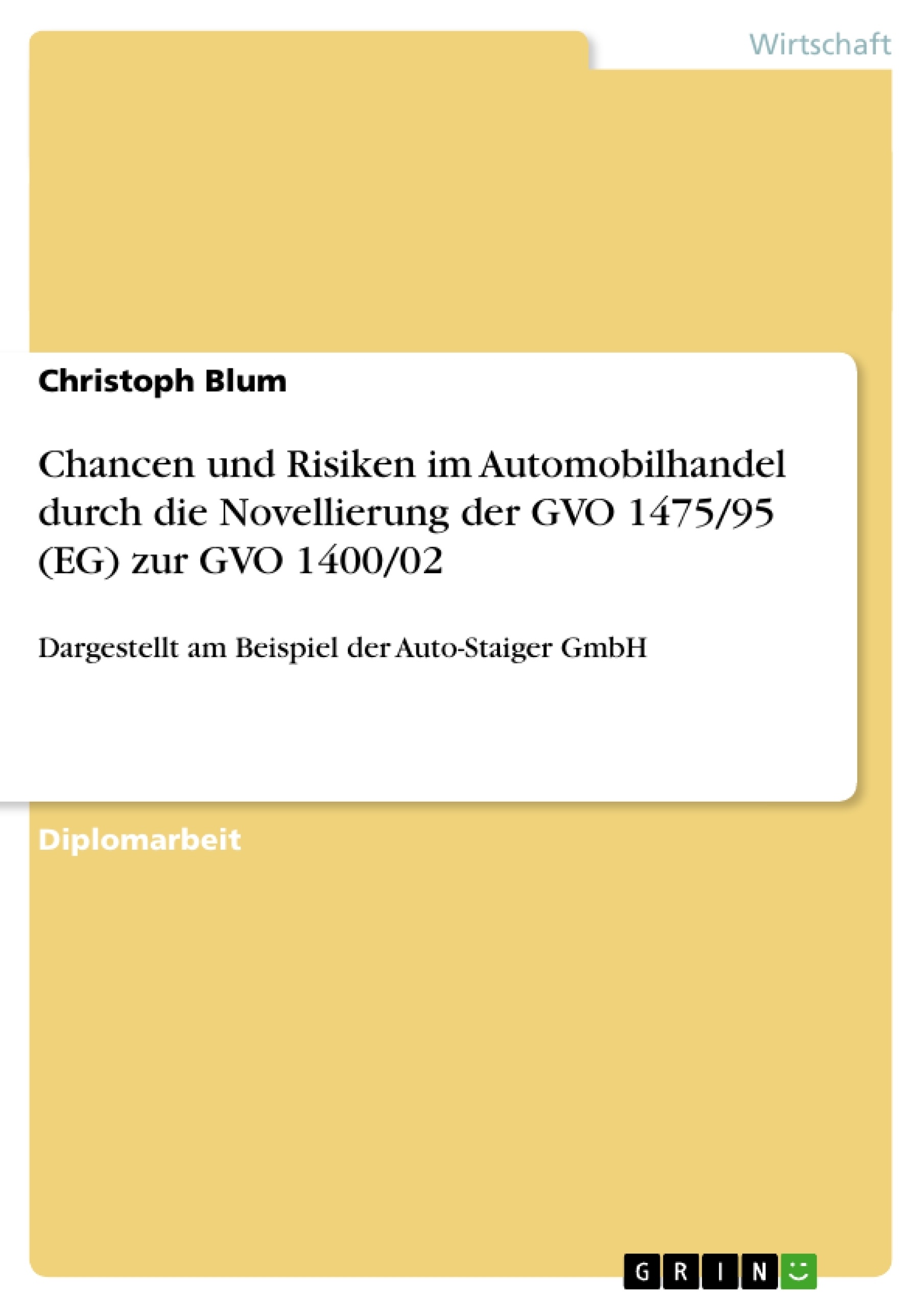Nachdem die Gruppenfreistellungsverordnung Nr. 1400/2002 (EG) die Hälfte ihrer Laufzeit passiert hat, ist es für die von der Verordnung betroffenen Unternehmen an der Zeit, eine Zwischenbilanz zu ziehen. Die Gruppenfreistellungsverordnung Nr. 1400/2002 (EG) soll dabei der Regelung „über die Anwendung von Art. 81 Abs. 3 des Vertrags auf Gruppen von vertikalen Vereinbarungen und aufeinander abgestimmten Verhaltensweisen im Kraftfahrzeugsektor“ dienen.
Durch die Novellierung der Gruppenfreistellungsverordnung (im Folgenden GVO genannt) wurde eine neue Ära des Automobilhandels angebrochen. Bereits am 05. Februar 2002 wurden die Eckpunkte für die Neugestaltung der GVO Nr. 1400/2002 (EG) (im Folgenden Kfz-GVO genannt) durch eine Presseinformation der EU-Kommission publiziert. Nach langen Verhandlungen mit diversen Gruppierungen von Interessenvertretungen wurde am 31. Juli 2002 die Kfz-GVO durch die EU-Kommission erlassen. Zum 1. Oktober 2002 löste die Verordnung – nach Maßgabe der Übergangsbestimmung - ihre Vorgängerin, die GVO Nr. 1475/95 (EG) (im Folgenden GVO 1475/95 genannt) ab. Hieraus resultiert ein völlig neues Fundament für die vertikalen Beziehungen im Kfz-Sektor.
Der Vertrieb und der After-Sales-Markt neuer Kraftfahrzeuge sollten in Europa durch die Kfz-GVO verändert werden wie durch keine andere Regelung je zuvor. Mit ihrer Laufzeit soll die Kfz-GVO – wie die generelle Gruppenfreistellungsverordnung für vertikale Vertriebsbindungen Nr. 2790/99 (EG) (sog. “Schirm-GVO“) – bis zum 31. Mai 2010 valide sein.
Die mit der Kfz-GVO anvisierten Ziele der EU-Kommission sollen ein intensiverer Mehrmarkenvertrieb am Point-of-Sale, eine expansive Angebotsvielfalt im After-Sales-Service sowie eine Preisharmonisierung beim Kauf neuer Kraftfahrzeuge sein und somit die Position der Verbraucher stärken. Diese wettbewerbsfördernden Ziele tangieren neben den Verbrauchern und Herstellern ebenfalls den Vertragshändler, welcher eine zentrale Mittlerposition zwischen den Verbrauchern und der Industrie repräsentiert. Im hart umkämpften Automobilhandel müssen sich die beteiligten Unternehmen den für sich ergebenden Vor- und Nachteilen bewusst werden, um auf diese im existenzbedrohenden Wettbewerb entsprechend zu reagieren.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Begrifflich-systematische Grundlagen
- Automobilhandel
- Ausgangssituation
- Vom Fachhandel zum Systemhändler
- Die GVO 1400/02 als Rahmenbedingung im Kraftfahrzeugsektor
- Verbot nach Art. 81 Abs. 1 EG
- Sanktion nach Art. 81 Abs. 2 EG
- Ausnahmetatbestand nach Art. 81 Abs. 3 EG
- Voraussetzungen für die Validität der GVO 1400/02
- Kernbeschränkungen in vertikalen Vereinbarungen
- Automobilhandel
- Vertrieb neuer Kraftfahrzeuge
- Selektiver Vertrieb
- Qualitativ-selektiver Vertrieb
- Quantitativ-selektiver Vertrieb
- Exklusiver Vertrieb
- Direktvertrieb
- Verbot eines selektiv-exklusiven Vertriebs
- Mehrmarkenvertrieb
- Reorganisation der Verbindung von Vertrieb und Kundendienst
- Selektiver Vertrieb
- Regelungen für den After-Sales-Markt
- Selektion der zugelassenen Werkstätten
- Zugelassene versus unabhängige Werkstätten
- Mehrmarkenreparaturen
- Ersatzteile
- Originalersatzteile
- Qualitativ gleichwertige Ersatzteile
- Auswirkungen der Novellierung der GVO 1475/95 zur GVO 1400/02 am Beispiel der Auto-Staiger GmbH
- Vertrieb neuer Kraftfahrzeuge
- Mehrmarkenvertrieb
- Wegfall der Standortklausel
- Regelungen für den After-Sales-Markt
- Mehrmarkenreparaturen
- Ersatzteile
- Originalersatzteile
- Qualitativ gleichwertige Ersatzteile
- Vertrieb neuer Kraftfahrzeuge
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit analysiert die Auswirkungen der Novellierung der GVO 1475/95 zur GVO 1400/02 auf den Automobilhandel, dargestellt am Beispiel der Auto-Staiger GmbH. Die Arbeit untersucht die neuen Rahmenbedingungen für den Vertrieb neuer Kraftfahrzeuge und den After-Sales-Markt, insbesondere im Hinblick auf Mehrmarkenvertrieb und die Zulassung von unabhängigen Werkstätten.
- Die rechtlichen Grundlagen der GVO 1400/02 im Kontext des Wettbewerbsrechts
- Die Auswirkungen der Novellierung auf den Vertrieb neuer Kraftfahrzeuge
- Die Auswirkungen der Novellierung auf den After-Sales-Markt, insbesondere im Hinblick auf Mehrmarkenreparaturen und die Zulassung von unabhängigen Werkstätten
- Die Anpassung des Automobilhandels an die neuen Rahmenbedingungen am Beispiel der Auto-Staiger GmbH
- Die Chancen und Risiken der Novellierung für den Automobilhandel
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel bietet eine Einleitung in die Thematik der Diplomarbeit. Es werden die Relevanz des Themas und die Forschungsfragen sowie der Aufbau der Arbeit vorgestellt.
Kapitel 2 analysiert die rechtlichen Grundlagen der GVO 1400/02 im Kontext des Wettbewerbsrechts. Es werden die relevanten EU-Rechtsnormen erläutert und die Auswirkungen der Novellierung auf den Automobilhandel dargestellt.
Kapitel 3 befasst sich mit dem Vertrieb neuer Kraftfahrzeuge. Es werden verschiedene Vertriebsmodelle, wie selektiver, exklusiver und Direktvertrieb, vorgestellt und deren Auswirkungen auf den Automobilhandel diskutiert.
Kapitel 4 analysiert die Regelungen für den After-Sales-Markt, insbesondere die Selektion der zugelassenen Werkstätten und die Zulassung von unabhängigen Werkstätten.
Kapitel 5 analysiert die Auswirkungen der Novellierung der GVO 1475/95 zur GVO 1400/02 am Beispiel der Auto-Staiger GmbH. Es werden die konkreten Auswirkungen der neuen Regelungen auf den Vertrieb neuer Kraftfahrzeuge und den After-Sales-Markt dargestellt.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter dieser Arbeit sind: GVO 1400/02, Automobilhandel, Vertrieb neuer Kraftfahrzeuge, After-Sales-Markt, Mehrmarkenvertrieb, unabhängige Werkstätten, Originalersatzteile, qualitativ gleichwertige Ersatzteile, Wettbewerbsrecht, EU-Recht, Auto-Staiger GmbH.
Häufig gestellte Fragen
Was änderte sich durch die GVO 1400/02 im Automobilhandel?
Die Verordnung brach das Monopol der Hersteller auf. Sie ermöglichte Mehrmarkenvertrieb, stärkte die Rechte unabhängiger Werkstätten und zielte auf eine Preisharmonisierung innerhalb der EU ab.
Was bedeutet Mehrmarkenvertrieb am Point-of-Sale?
Händler erhielten durch die neue GVO das Recht, Fahrzeuge verschiedener Hersteller im selben Ausstellungsraum zu präsentieren, sofern bestimmte qualitative Standards eingehalten werden.
Wie beeinflusst die GVO den After-Sales-Markt (Werkstätten)?
Hersteller dürfen den Zugang zu technischem Wissen und Originalersatzteilen nicht mehr auf Vertragswerkstätten beschränken. Auch unabhängige Werkstätten können nun nach Herstellervorgaben reparieren.
Was ist der Unterschied zwischen qualitativ und quantitativ selektivem Vertrieb?
Qualitativ selektiv bedeutet, dass jeder Händler beliefert werden muss, der bestimmte Standards erfüllt. Quantitativ selektiv erlaubt dem Hersteller, die Anzahl der Händler in einem Gebiet zu begrenzen.
Welche Chancen ergaben sich für Firmen wie die Auto-Staiger GmbH?
Durch den Wegfall der Standortklausel und die Möglichkeit zum Mehrmarkenvertrieb konnten Händler expandieren und ihr Serviceangebot diversifizieren, mussten aber auch einen höheren Wettbewerbsdruck verkraften.
- Quote paper
- Diplom-Betriebswirt (BA) Christoph Blum (Author), 2007, Chancen und Risiken im Automobilhandel durch die Novellierung der GVO 1475/95 (EG) zur GVO 1400/02 , Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/86180