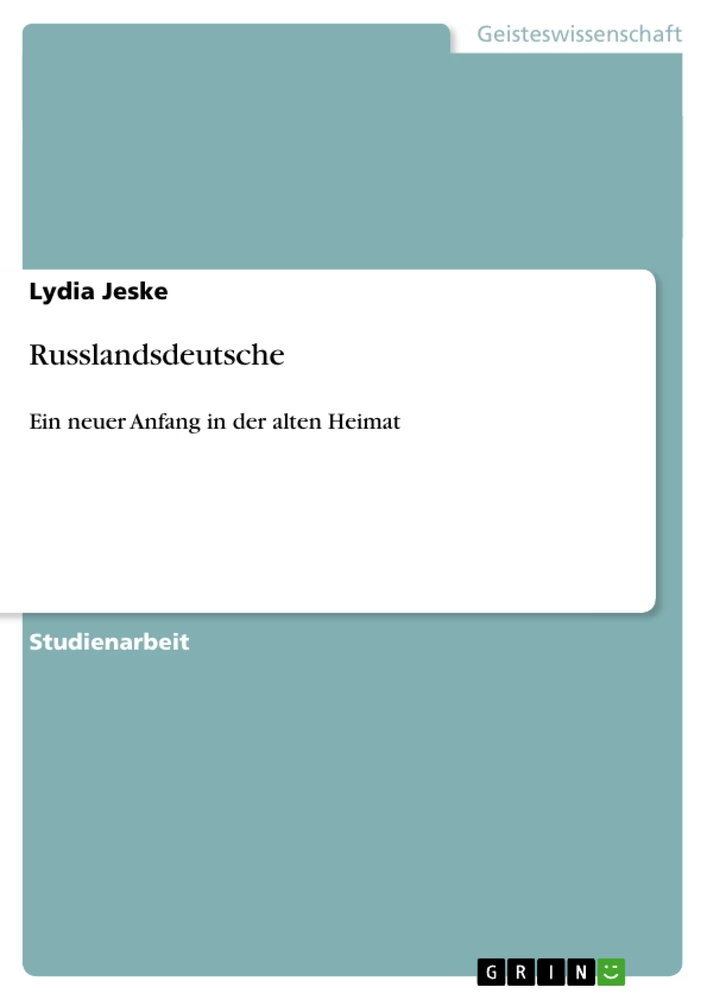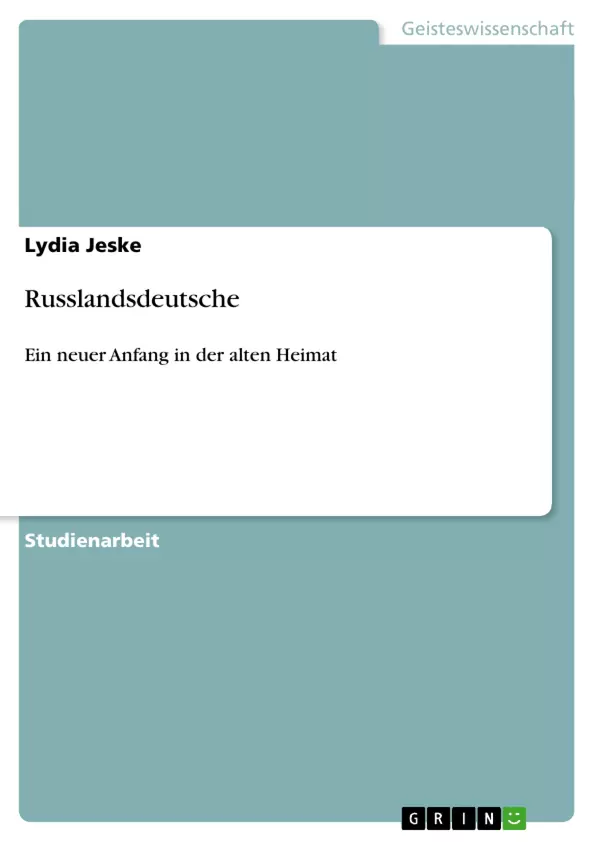Die junge Bundesrepublik Deutschland musste in ihrer bisherigen Bestehungsgeschichte bereits eine sehr hohe Anzahl an Zuwanderern aufnehmen, die entweder die Absicht hegten hier für eine relativ kurze Zeit zu verweilen oder Deutschland zu ihrer neuen Heimat zu machen. Offiziell gilt die BR Deutschland nicht als ein Zuwanderungsland.
Jedoch ist Zuwanderung für die BRD, bereits seit ihren Anfängen bis zur heutigen Zeit, ein hochaktuelles Thema gewesen. Kurz nach der Gründung der Bundesrepublik wurden ausländische Arbeitskräfte seitens der damaligen jungen Regierung angeworben, damit diese beim Wiederaufbau Deutschlands mithelfen konnten. So reisten bis 1973 mehrere Millionen ausländischer Arbeitskräfte ein, um der Bitte der deutschen Regierung nach zu kommen.
In den letzten 18 Jahren hat sich ein drastischer Wandel in der Zusammensetzung der Zuwanderung vollzogen. Der „Fall der Mauer“ im Jahre 1989 brachte einen Strom an deutschstämmigen Zuwanderern mit sich. Die Bundesrepublik Deutschland musste in den Jahren 1989 und 1990 circa 780.000 Zuwanderer unterbringen und ihnen eine angemessene Versorgung gewährleisten. Dies stellte sowohl Bund als auch Länder auf eine harte Bewährungsprobe.
Der starke Migrantenzustrom aus den osteuropäischen Ländern und der ehemaligen UdSSR riss nur langsam ab, d.h. dass heutzutage noch immer zehntausende an Zuwanderern aus diesen Regionen, insbesondere aus den Gebieten der ehemaligen UdSSR, nach Deutschland einreisen.
Es stellt sich in Anbetracht der Massen, die in kürzester Zeit eingewandert sind, die Frage: Wie gut konnten diese Personen in die hiesige Gesellschaft integriert werden? Ein wichtiger Teil der Integration läuft über die berufliche Integration bzw. die Arbeitsmarktintegration der Neuankömmlinge in Deutschland ab.
Es gilt nun in dieser Arbeit zu klären wie gut die berufliche Eingliederung von deutschstämmigen Zuwanderern in den vergangen Jahren abgelaufen ist. Diese Gruppe wird im Folgenden mit der ausländischen Einwanderergruppe verglichen, um eventuelle Parallelen oder Differenzen in Anbetracht ihrer Integration heraus zu arbeiten. Eine weitere Referenzgruppe stellen die einheimischen Deutschen dar. Damit man herausfinden kann wie erfolgreich die Arbeitsmarktintegration und, im weiteren Sinne, in die deutsche Gesellschaft ist bzw. war.
Inhaltsverzeichnis
- Weg von der Problematik der ausländischen Migranten hin zu der Problematik der deutschstämmigen Migranten
- Kleiner Überblick über die Situation der (Spät-)Aussiedler
- Berufliche Integration: Ein Schritt in die richtige Richtung?
- Bestehen Gemeinsamkeiten zwischen (Spät-)Aussiedlern und ausländischen Migranten?
- Wie groß ist die Chance erwerbstätig zu werden?
- Berufliche Dequalifizierung: vom Arzt zum Bauarbeiter
- (Spät-)Aussiedlerinnen und ihre Integration in den Arbeitsmarkt
- Sind die Integrationsbemühungen erfolgreich gewesen?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die berufliche Integration von deutschstämmigen Zuwanderern in Deutschland, insbesondere von (Spät-)Aussiedlern. Sie untersucht, wie diese Gruppe in den Arbeitsmarkt integriert wurde und vergleicht ihre Erfahrungen mit denen von ausländischen Migranten und einheimischen Deutschen. Die Arbeit zielt darauf ab, die Erfolgsfaktoren und Herausforderungen der beruflichen Integration von (Spät-)Aussiedlern zu beleuchten.
- Berufliche Integration von (Spät-)Aussiedlern in Deutschland
- Vergleich mit der Integration ausländischer Migranten und einheimischer Deutscher
- Erfolgsfaktoren und Herausforderungen der beruflichen Integration
- Entwicklung der (Spät-)Aussiedlerzahlen und ihre Relevanz für die deutsche Gesellschaft
- Die Rolle des Bundesvertriebenengesetzes (BVFG) bei der Integration von (Spät-)Aussiedlern
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Die Arbeit stellt die Problematik der deutschstämmigen Migranten im Kontext der allgemeinen Zuwanderungsdebatte in Deutschland vor. Sie beleuchtet die historische Entwicklung der Zuwanderung und den Einfluss des Falls der Mauer auf die Aussiedlerzahlen.
- Kapitel 2: Dieses Kapitel bietet einen Überblick über die Situation der (Spät-)Aussiedler in Deutschland. Es definiert die verschiedenen Gruppen von Aussiedlern und Spätaussiedlern und erläutert die rechtlichen Grundlagen ihrer Integration.
- Kapitel 3: Dieses Kapitel untersucht die berufliche Integration von (Spät-)Aussiedlern und stellt die Frage, ob diese erfolgreich war. Es analysiert die Herausforderungen und Chancen auf dem deutschen Arbeitsmarkt.
- Kapitel 4: In diesem Kapitel werden Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen (Spät-)Aussiedlern und ausländischen Migranten in Bezug auf die berufliche Integration herausgearbeitet.
- Kapitel 5: Dieses Kapitel analysiert die Chancen der (Spät-)Aussiedler, in Deutschland eine Beschäftigung zu finden. Es untersucht die Faktoren, die die Erwerbstätigkeit beeinflussen.
- Kapitel 6: Dieses Kapitel betrachtet die Problematik der beruflichen Dequalifizierung von (Spät-)Aussiedlern. Es untersucht die Gründe für den Abstieg in niedrigere Berufsfelder.
- Kapitel 7: Dieses Kapitel fokussiert auf die Integration von (Spät-)Aussiedlerinnen in den Arbeitsmarkt. Es analysiert die spezifischen Herausforderungen und Möglichkeiten für Frauen.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter dieser Arbeit sind: (Spät-)Aussiedler, berufliche Integration, Arbeitsmarktintegration, deutschstämmige Migranten, ausländische Migranten, Bundesvertriebenengesetz (BVFG), Erwerbstätigkeit, Dequalifizierung, Integration.
Häufig gestellte Fragen
Wer sind (Spät-)Aussiedler im Kontext dieser Arbeit?
Es handelt sich um deutschstämmige Zuwanderer aus osteuropäischen Ländern und der ehemaligen UdSSR, die insbesondere nach 1989 in hoher Zahl nach Deutschland kamen.
Was ist das Hauptkriterium für eine erfolgreiche Integration in diesem Bericht?
Ein zentraler Aspekt der Integration ist die berufliche Eingliederung bzw. die erfolgreiche Integration in den deutschen Arbeitsmarkt.
Was wird unter dem Begriff "berufliche Dequalifizierung" verstanden?
Dequalifizierung beschreibt den beruflichen Abstieg von Zuwanderern, zum Beispiel wenn ein ausgebildeter Arzt in Deutschland lediglich als Bauarbeiter tätig sein kann.
Welche Rolle spielt das Bundesvertriebenengesetz (BVFG)?
Das BVFG bildet die rechtliche Grundlage für die Aufnahme und Integration von (Spät-)Aussiedlern in Deutschland.
Wie werden (Spät-)Aussiedler im Vergleich zu ausländischen Migranten betrachtet?
Die Arbeit vergleicht beide Gruppen, um Parallelen und Differenzen in ihrem Integrationsprozess und ihren Chancen am Arbeitsmarkt herauszuarbeiten.
Gibt es spezifische Analysen für Frauen in diesem Bereich?
Ja, ein Kapitel der Arbeit widmet sich explizit den Herausforderungen und Möglichkeiten von (Spät-)Aussiedlerinnen bei der Arbeitsmarktintegration.
- Arbeit zitieren
- Lydia Jeske (Autor:in), 2006, Russlandsdeutsche, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/86251