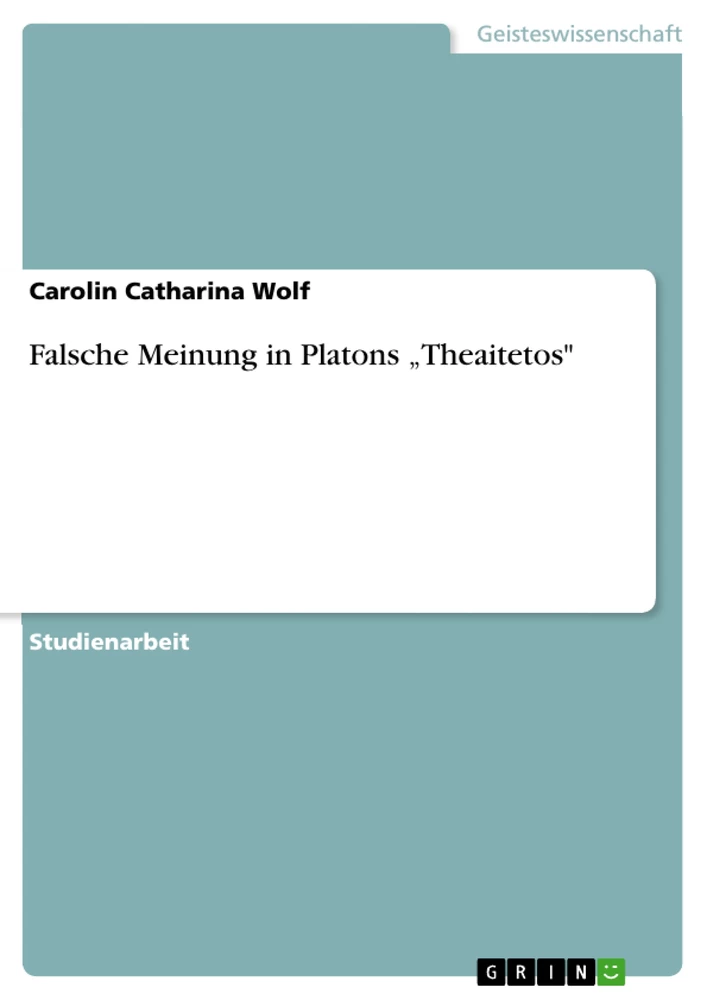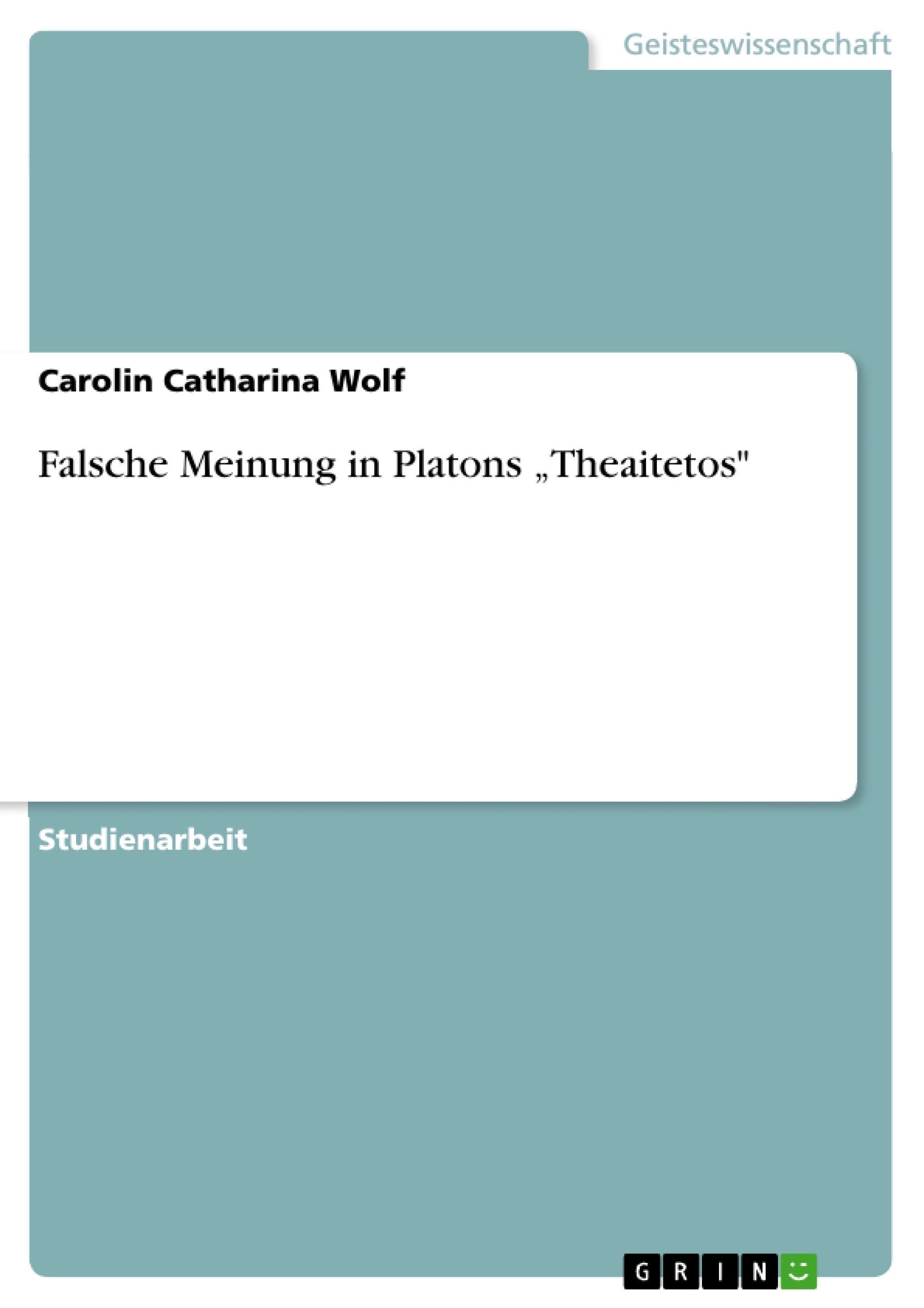Platons Spätdialog ‚Theätet’ behandelt die Frage ‚Was ist Wissen?’ . Die Dialogpartner Sokrates und Theätet besprechen, prüfen und verwerfen bei der Untersuchung dieser Frage drei Thesen:
1. Wissen ist Wahrnehmung
2. Wissen ist wahre Meinung
3. Wissen ist wahre begründete Meinung…
Wenn der Vorschlag gemacht wird, dass es sich bei Wissen (beziehungsweise Erkenntnis) um wahre Meinung handelt, stellt sich die Frage ‚Was ist falsche Meinung’?
Sokrates und sein Gesprächspartner Theätet gehen davon aus, dass es solches ‚falsches Meinen’ gibt. Zu ersehen ist dies schon aus der Art und Weise, wie die Frage formuliert ist:
„Mich beunruhigt jetzt und auch sonst oft, und es bringt mich in große Verlegenheit mir selbst und einem anderen gegenüber, dass ich nicht erklären kann, was das eigentlich für ein Zustand in uns ist und wie er zustande kommt.“ (187d)
An anderer Stelle wir dies noch einmal explizit ausgesprochen:
„Sokrates: […] Behaupten wir, dass es jeweils eine falsche Meinung gibt […]? Theätet: Ja, das behaupten wir.“ (187e)
Es wird also keineswegs daran gezweifelt, dass falsche Meinung möglich sei. Dennoch soll zu erklären versucht werden, wie diese zustande kommen kann.
Die anschließende Untersuchung ist für den späteren Verlauf des ‚Theätet’ nicht von Bedeutung- es handelt sich um einen Exkurs, für dessen Ausführung nicht nur Muße, sondern vor allen Dingen innere Gründe ausschlaggebend sind.
Entscheidend für die Ausführung ist auch die Tatsache, dass philosophische Wahrheit nicht das Wahre an sich ist, sondern zugleich die Auflösung des Falschen. Um zu einer richtigen Meinung zu gelangen, muss also erst die falsche Meinung bestimmt und überwunden werden oder wie Spinoza es ausdrückt: „Est enim verum index sui et falsi.“
Wie also löst die richtige Meinung die ihr entgegenstehende falsche auf, beziehungsweise: Wie korrigiert sie sie?
Insgesamt werden fünf Erklärungsversuche für falsche Meinung angetreten.
Gleich zu Beginn dieser Untersuchung aber treten unerwartete Schwierigkeiten auf, weil die ersten drei Argumente, die Sokrates gegen die Annahme falscher Meinung ins Feld führt, auf fehlerhaften Prämissen beruhen.
Der vierte und der fünfte Erklärungsversuch- das Gleichnis vom Wachsblock und das Gleichnis vom Taubenschlag- sollen Abhilfe schaffen. Alleine auch hier tun sich Hindernisse auf, so dass Platons Bemühungen, falsche Meinung zu beschreiben weitgehend scheitern.
Im Folgenden sollen die von Platon behandelten Ansätze näher untersucht werden. Hierbei wird auf Schwachpunkte seiner Untersuchung aufmerksam gemacht werden; überdies hinaus interessiert aber auch die Frage, welche positiven Ansätze zur Beschreibung falscher Meinung der ‚Theätet’ bereits enthält. Ein Überblick über seinen direkt anschließenden Dialog ‚Sophistes’, in welchem eine solche Beschreibung entsprechend gelungen ist, soll in diesem Zusammenhang Aufschluss gebe
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Erster Ansatz (188a-c)
- Zweiter Ansatz (188d-189b)
- Dritter Ansatz (189c- 191a)
- Zusammenfassung der ersten drei Ansätze
- Vierter Ansatz: Das Wachstafelgleichnis oder die falsche Meinung in der Empirie (191a-196e)
- Fünfter Ansatz: Das Taubenschlaggleichnis oder die falsche Meinung im Felde des Mathematischen (197a-200d)
- Sophistes...
- Schlussbetrachtungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text analysiert die Frage nach falscher Meinung im Kontext von Platons „Theaitetos“. Es wird untersucht, wie Sokrates und Theätet verschiedene Ansätze zur Erklärung des Phänomens „falsche Meinung“ diskutieren und bewerten.
- Die Bedeutung der philosophischen Wahrheit und ihre Beziehung zur Auflösung des Falschen.
- Die verschiedenen Erklärungsversuche für falsche Meinung, die Sokrates und Theätet im Dialog entwickeln.
- Die Kritik an den ersten drei Ansätzen, die auf fehlerhaften Prämissen basieren.
- Die Analyse des Wachstafelgleichnisses und des Taubenschlaggleichnisses als Versuche, die Entstehung falscher Meinung zu erklären.
- Der Vergleich der Ergebnisse des „Theaitetos“ mit Platons anschließendem Dialog „Sophistes“.
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt die Frage nach der Natur von falscher Meinung im Kontext des Platonschen „Theaitetos“ und erläutert die Relevanz dieser Frage für das Verständnis von Wissen und Erkenntnis.
- Erster Ansatz (188a-c): In diesem Abschnitt wird Sokrates' erster Erklärungsversuch für falsche Meinung vorgestellt, der auf der Annahme basiert, dass alles entweder bekannt oder unbekannt ist. Es wird gezeigt, wie dieser Ansatz zu einem unlösbaren Widerspruch führt.
- Zweiter Ansatz (188d-189b): Der zweite Ansatz baut auf dem ersten auf und führt zu der Schlussfolgerung, dass man nichts Nicht-Seiendes meinen kann. Hier wird die Analogie zwischen sinnlicher Wahrnehmung und Meinen kritisiert.
- Dritter Ansatz (189c- 191a): Der dritte Ansatz wird vorgestellt, der ebenfalls zu keiner befriedigenden Erklärung für falsche Meinung führt.
- Vierter Ansatz: Das Wachstafelgleichnis (191a-196e): Der vierte Ansatz stellt das Wachstafelgleichnis vor, das als Versuch dienen soll, die Entstehung falscher Meinung zu erklären. Dieser Ansatz wird ebenfalls kritisch beleuchtet.
- Fünfter Ansatz: Das Taubenschlaggleichnis (197a-200d): Der fünfte Ansatz wird vorgestellt, der ebenfalls nicht in der Lage ist, die Entstehung falscher Meinung vollständig zu erklären.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter des Textes sind: Falsche Meinung, Wissen, Erkenntnis, Platons „Theaitetos“, Sokrates, Theätet, Wachstafelgleichnis, Taubenschlaggleichnis, Sophistes, Philosophische Wahrheit, Nicht-Seiendes.
- Arbeit zitieren
- Carolin Catharina Wolf (Autor:in), 2007, Falsche Meinung in Platons „Theaitetos", München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/86312