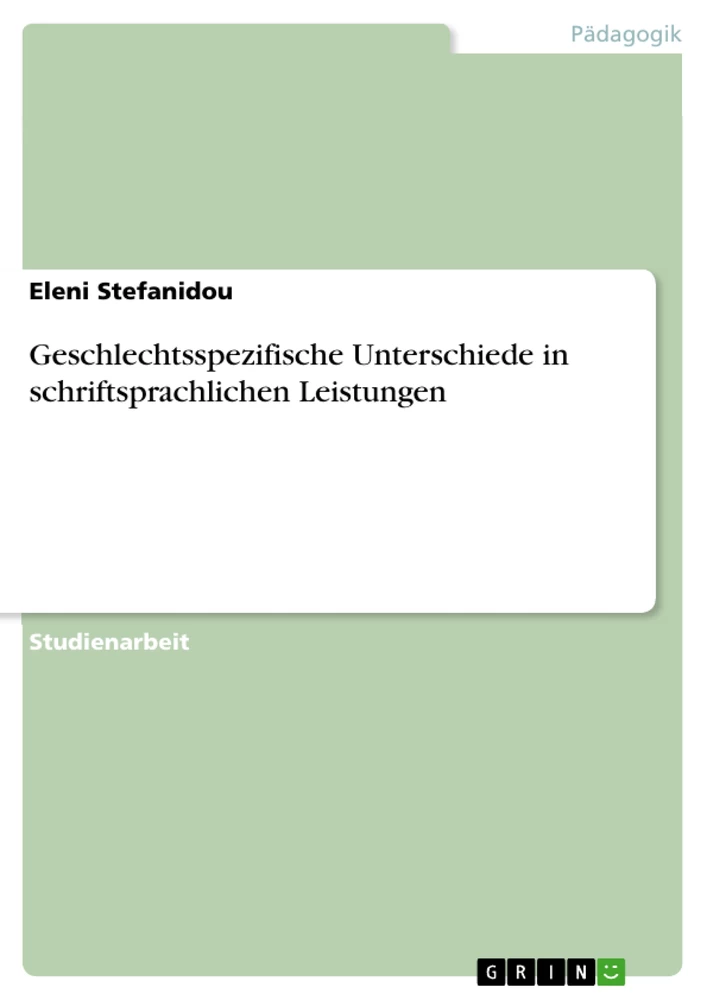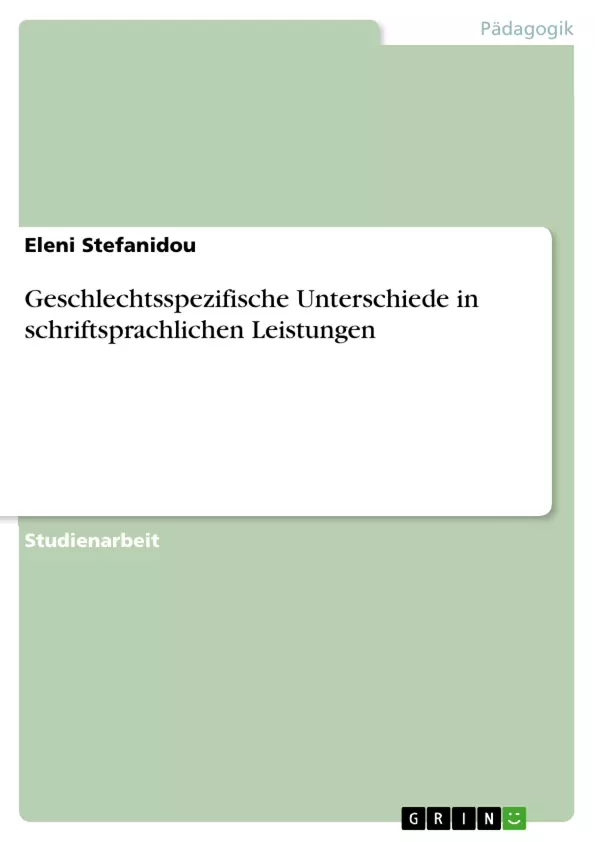Die Arbeit beschäftigt sich mit geschlechtsspezifischen Leistungen im Schriftsprachbereich, in welchem Jungen den Mädchen generell unterlegen sind. Der Überblick über die physiologischen, sozialisationstheoretischen und psycho¬linguistischen Erklärungsansätze zeigt, dass letzterer geschlechtsspezifische Unterschiede in den Schulleistungen mit einer mangelnden Berücksichtigung geschlechtsspezifischer Interessen besonders plausibel erklären kann. Durch kognitive Lerntheorien und Erkenntnisse der Interessen¬forschung erhält diese Annahme ferner ein theoretisches Fundament, dessen Aspekte auch in Rechtschreibmodellen berücksichtigt sind. Im Anschluss werden empirische Forschungsergebnisse zum psycholinguistischen Erklärungsansatz vorgestellt, womit sich die Arbeit vornehmlich auf die Untersuchungen von Richter (1996a) bezieht, die sich vor allem mit Unterschieden in der Rechtschreibleistung bei Grundschulkindern beschäftigen. Die daraus erwachsenden didaktischen Folgerungen dienen nicht nur einer Aufhebung der Benachteiligung der Jungen im Schriftsprach¬bereich, sondern zielen auf eine Chancengleichheit aller SchülerInnen in allen Schulfächern.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Geschlechtsspezifische Unterschiede in schriftsprachlichen Leistungen
- Erklärungsansätze für geschlechtsspezifische Unterschiede in schriftsprachlichen Leistungen
- Physiologische Erklärungsansätze
- Sozialisationstheoretische Erklärungsansätze
- Psycholinguistischer Erklärungsansatz
- Theoretische Grundlagen
- Lernen aus der Sicht der Kognitiven Psychologie
- Interesse und Lernen
- Rechtschreibmodelle
- Entwicklungsmodelle
- Prozessmodelle
- Ökologische Feldmodelle
- Empirische Untersuchungen zu psycholinguistischen Faktoren
- Qualitative Leistungsunterschiede zwischen den Geschlechtern bei Diktaten
- Geschlechtsspezifischer Wortschatz
- Berücksichtigung des geschlechtsspezifischen Wortschatzes
- Didaktische Folgerungen
- Modell der „Ökologischen Didaktik“
- Konsequenzen für den schriftsprachlichen Anfangsunterricht
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit setzt sich zum Ziel, die Ursachen für geschlechtsspezifische Unterschiede in schriftsprachlichen Leistungen zu untersuchen. Dabei werden verschiedene Erklärungsansätze beleuchtet und die Rolle von Interessen und kognitiven Lernprozessen in diesem Zusammenhang analysiert.
- Leistungsunterschiede zwischen Jungen und Mädchen im Schriftsprachbereich
- Physiologische, sozialisationstheoretische und psycholinguistische Erklärungsansätze
- Kognitive Lerntheorien und Interessenforschung im Zusammenhang mit Rechtschreibmodellen
- Empirische Forschungsergebnisse zu psycholinguistischen Faktoren und deren Einfluss auf die Rechtschreibleistung
- Didaktische Folgerungen für einen chancengerechten Unterricht im Schriftsprachbereich
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den Forschungsgegenstand der geschlechtsspezifischen Unterschiede in schriftsprachlichen Leistungen vor und skizziert den Aufbau der Arbeit. Kapitel 2 beleuchtet die Forschungslage und die empirischen Befunde zu den Leistungsunterschieden zwischen Jungen und Mädchen. Kapitel 3 widmet sich verschiedenen Erklärungsansätzen, darunter physiologische, sozialisationstheoretische und psycholinguistische Ansätze. Die theoretischen Grundlagen werden in Kapitel 4 behandelt, wobei die Schwerpunkte auf kognitiven Lernprozessen, Interessenforschung und Rechtschreibmodellen liegen. In Kapitel 5 werden empirische Untersuchungen zu psycholinguistischen Faktoren vorgestellt, die den Einfluss von Wortschatz und anderen sprachlichen Fähigkeiten auf die Rechtschreibleistung beleuchten. Kapitel 6 zeigt didaktische Folgerungen auf, die sich aus den bisherigen Erkenntnissen ergeben und für einen chancengerechten Unterricht im Schriftsprachbereich relevant sind.
Schlüsselwörter
Geschlechtsspezifische Unterschiede, schriftsprachliche Leistungen, Rechtschreibung, Lesekompetenz, Erklärungsansätze, physiologische Faktoren, Sozialisationstheorie, Psycholinguistik, Interessenforschung, kognitive Lernprozesse, empirische Untersuchungen, didaktische Folgerungen, chancengerechter Unterricht
Häufig gestellte Fragen
Warum haben Jungen oft schlechtere Leistungen im Schriftsprachbereich?
Neben physiologischen Faktoren spielen psycholinguistische Ansätze eine Rolle, die auf eine mangelnde Berücksichtigung jungen-spezifischer Interessen im Unterricht hinweisen.
Was besagt der psycholinguistische Erklärungsansatz?
Er geht davon aus, dass Schulleistungen steigen, wenn die Lerninhalte (z. B. Wortschatz in Diktaten) die spezifischen Interessen der Schüler ansprechen.
Wie hängen Interesse und Lernen zusammen?
Interesse führt zu einer tieferen kognitiven Verarbeitung und höherer Motivation, was besonders beim Erwerb der Rechtschreibung entscheidend ist.
Welche didaktischen Folgerungen ergeben sich für den Unterricht?
Gefordert wird eine „Ökologische Didaktik“, die geschlechtsspezifische Wortschätze und Themen einbezieht, um Benachteiligungen abzubauen.
Gibt es qualitative Unterschiede bei Diktatfehlern?
Untersuchungen (z. B. von Richter) zeigen, dass sich Fehlerbilder zwischen Jungen und Mädchen unterscheiden können, wenn der Kontext der Texte variiert wird.
- Citar trabajo
- Eleni Stefanidou (Autor), 2007, Geschlechtsspezifische Unterschiede in schriftsprachlichen Leistungen, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/86341