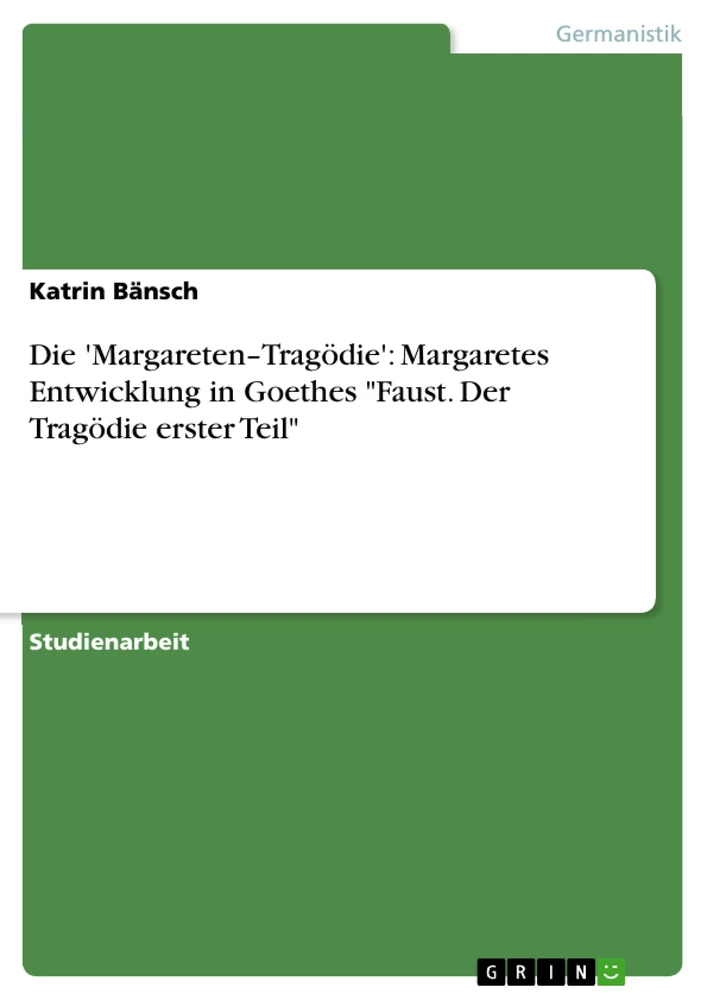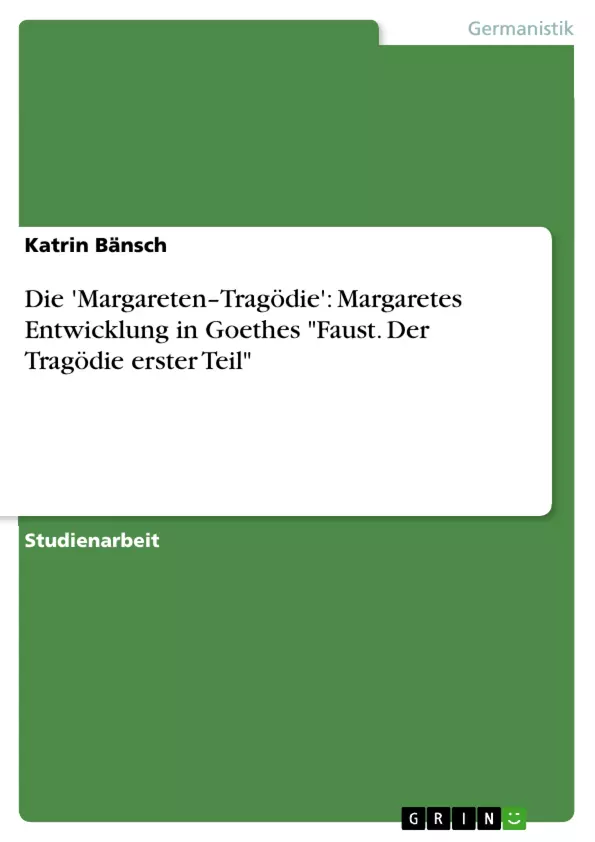1 Einleitung
Die vorliegende Arbeit soll sich mit der so genannten „Margareten – Tragödie“ aus Johann Wolfgang von Goethes „Faust“ befassen. Zugrunde gelegt wird „der Tragödie erster Teil“, der nach dem „Urfaust“ und nach „Faust. Ein Fragment“ im Jahre 1808 veröffentlicht wurde und damit ein Weimarer Drama ist. Im Gegensatz zu seinen Vorgängern trägt er die Gattungsbezeichnung „Tragödie“, in der es unter anderem um die Beziehung zwischen Margarete und Faust geht. „Die Margareten – Tragödie“ ist eine Thematik, die auf Goethe zurückgeht, da sie nicht durch den tradierten Fauststoff motiviert ist. Sie zeigt einen anderen Weg der Entgrenzung, den der Liebe. Wie sich dieser Weg darstellt, das heißt wie sich die Liebe anbahnt und entwickelt und worin schließlich der tragische Aspekt der Margareten – Handlung besteht, soll das Thema der Arbeit sein. Dabei liegt der Fokus auf Margarete, deren Entwicklung thematisiert werden soll. Aus ihrer Sicht wird die Tragödie geschildert. Der Weg vom naiven Kind zur selbst bestimmenden und frei entscheiden könnenden Frau ist darzulegen. Dabei soll auch besonderes Augenmerk auf die unterschiedliche Sprecherbezeichnung Margarete - Gretchen gelegt werden, wobei aber nicht die historische Ableitung des Namens erörtert werden soll. Ob Goethe nun die Heilige Margarete oder die Kindsmörderin Susanna Margaretha Brandt als Vorbild für seine weibliche Protagonistin genommen hat, spielt für diese Interpretation keine Rolle, da es sich hier um die literarische Margarete, eine eigene Figur handelt. Es geht hier vielmehr darum zu zeigen, weshalb die Namen in der Regieanweisung von Margarete zu Gretchen und umgekehrt hin und her wechseln.
Bei der Bearbeitung der Fragestellung sollen Ergebnisse der vorhandenen Sekundärliteratur nicht als gegeben hingenommen, sondern hinterfragt werden, so dass sich beim Abschluss dieser Arbeit ein neues Margareten – Bild etablieren könnte. Ist Margarete wirklich die verführte Unschuld, die dem Wahnsinn verfällt oder ist auch eine andere Interpretation möglich?
Um nun kurz auf die Vorgehensweise einzugehen, so wird mit der Tragödiendefinition begonnen, wobei danach auf Margaretes Entwicklung und ihre Liebe zu Faust eingegangen wird. Das Schlusskapitel soll im Anschluss die Begründung der Tragödie darlegen.
2 Tragödie
Die Tragödie ist neben der Komödie die wichtigste Gattung des europäischen Dramas. „In ihrem Zentrum steht ein schicksalhafter, unvermeidlicher und unlösbarer Konflikt, der zum Untergang des tragischen Helden führt.“ Entstanden ist die Tragödie in Griechenland aus dem Kultfest des Dionysos. Sophokles, der Werke wie „König Ödipus“ und „Antigone“ gedichtet hat, lässt in seinen Tragödien das Individuum hervortreten, das in einen „unvermeidlichen, tragisch-schuldhaften Gegensatz zu den in den Göttern verkörperten heiligen Ordnungen“ gerät .
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Tragödie
- 3 Eine Einführung in die Margareten-Tragödie
- 3.1 Einführung und erster Auftritt Margaretes
- 3.2 Margaretes Reaktion auf die Begegnung mit Faust in der Szene „Abend“
- 4 Margaretes Entwicklung
- 4.1 Margarete: Verführung Fausts
- 4.2 Gretchen am Spinnrade
- 4.3 Margarete in „Marthens Garten“ und ihr Weg zu einem neuen Dasein als Gretchen
- 4.4 Gretchen in Trauer
- 5 Die Begründung der Tragödie: Margaretes Rückkehr
- 6 Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die „Margareten-Tragödie“ in Goethes „Faust I“, fokussiert auf Margaretes Entwicklung und die Tragik ihrer Liebesbeziehung zu Faust. Ziel ist es, Margaretes Wandel vom naiven Mädchen zur selbstbestimmten Frau zu beleuchten und gängige Interpretationen zu hinterfragen. Die Arbeit analysiert die Tragödie aus Margaretes Perspektive.
- Margaretes Entwicklung vom naiven Mädchen zur selbstbestimmten Frau
- Die Darstellung der Liebe und ihrer Folgen in der Tragödie
- Die Bedeutung der Namensgebung (Margarete/Gretchen)
- Eine kritische Auseinandersetzung mit bestehenden Interpretationen der Margareten-Figur
- Die Definition und Anwendung des Tragischen im Kontext von Goethes „Faust“
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung beschreibt den Fokus der Arbeit: die Analyse der „Margareten-Tragödie“ in Goethes „Faust I“ aus Margaretes Perspektive. Es wird die Absicht betont, bestehende Interpretationen zu hinterfragen und ein neues Bild Margaretes zu schaffen, das über das Klischee der verführten Unschuld hinausgeht. Die methodische Vorgehensweise, beginnend mit der Tragödiendefinition und fortfahrend mit der Darstellung von Margaretes Entwicklung und ihrer Beziehung zu Faust, wird kurz skizziert.
2 Tragödie: Dieses Kapitel definiert den Begriff der Tragödie, beginnend mit ihrer Bedeutung im europäischen Drama. Es werden antike Vorbilder wie Sophokles und Aristoteles herangezogen, um die zentralen Elemente einer Tragödie zu erläutern: den schicksalhaften Konflikt, den Untergang des Helden, die Erzeugung von Jammer und Schaudern beim Zuschauer und die damit verbundene Katharsis. Der Bezug zu Goethes „Faust“ und dessen Orientierung an der Antike wird hergestellt, wobei auch existenzielle Fragen wie Schuld, Sühne und Freiheit im Kontext des Tragischen beleuchtet werden.
3 Eine Einführung in die Margareten-Tragödie: Dieses Kapitel dient als Einführung in die „Margareten-Tragödie“. Es analysiert Margaretes ersten Auftritt und ihre Reaktion auf die Begegnung mit Faust, insbesondere in der Szene „Abend“. Hier wird der Grundstein für die spätere Tragik gelegt und Margaretes Entwicklung angedeutet.
4 Margaretes Entwicklung: Dieses Kapitel beschreibt den Entwicklungsprozess Margaretes über mehrere Schlüsselmomente hinweg. Es analysiert die Verführung durch Faust, Margaretes Innensicht am Spinnrad, ihre Erfahrungen in Marthens Garten, und schlussendlich ihren Zustand der Trauer. Es wird der Wandel ihrer Persönlichkeit und ihres Selbstverständnisses im Verlauf der Handlung beleuchtet. Die unterschiedliche Verwendung der Namen Margarete und Gretchen wird erwähnt, ohne jedoch die historische Ableitung näher zu erläutern. Das Kapitel setzt sich mit der Frage auseinander, ob Margarete tatsächlich als verführte Unschuld zu betrachten ist oder ob alternative Interpretationen möglich sind.
5 Die Begründung der Tragödie: Margaretes Rückkehr: Dieses Kapitel würde die Ursachen und Hintergründe der Tragödie aus Margaretes Sicht beleuchten. Es würde die zentralen Aspekte ihrer Handlung und Entscheidungen analysieren und deren Konsequenzen darlegen.
Schlüsselwörter
Goethe, Faust I, Margareten-Tragödie, Tragödie, Margaretes Entwicklung, Liebe, Schuld, Verführung, Katharsis, Weimarer Klassik, Existentialismus, Interpretation.
Goethes Faust I: Margareten-Tragödie - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die „Margareten-Tragödie“ in Goethes „Faust I“. Der Fokus liegt auf Margaretes Entwicklung und der Tragik ihrer Beziehung zu Faust. Die Arbeit hinterfragt gängige Interpretationen und beleuchtet Margaretes Wandel vom naiven Mädchen zur selbstbestimmten Frau aus ihrer Perspektive.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Margaretes Entwicklung, die Darstellung der Liebe und ihrer Folgen, die Bedeutung der Namensgebung (Margarete/Gretchen), eine kritische Auseinandersetzung mit bestehenden Interpretationen der Margareten-Figur und die Definition und Anwendung des Tragischen im Kontext von Goethes „Faust“.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in sechs Kapitel: Einleitung, Tragödie (Definition und Kontextualisierung), Einführung in die Margareten-Tragödie (Margaretes erster Auftritt und Reaktion auf Faust), Margaretes Entwicklung (Verführung, Spinnrad-Szene, Marthens Garten, Trauer), Die Begründung der Tragödie: Margaretes Rückkehr und Schlussbetrachtung. Jedes Kapitel wird zusammengefasst.
Was ist das Ziel der Arbeit?
Das Ziel ist es, Margaretes Entwicklung und die Tragik ihrer Situation umfassend zu analysieren und ein neues Bild von ihr zu zeichnen, das über das Klischee der verführten Unschuld hinausgeht. Die Arbeit hinterfragt bestehende Interpretationen und bietet eine neue Perspektive.
Wie wird die Tragödie definiert?
Das Kapitel „Tragödie“ definiert den Begriff anhand antiker Vorbilder (Sophokles, Aristoteles), indem es die zentralen Elemente einer Tragödie (schicksalhafter Konflikt, Untergang des Helden, Jammer und Schaudern, Katharsis) erläutert. Der Bezug zu Goethes „Faust“ und existenzielle Fragen wie Schuld, Sühne und Freiheit im Kontext des Tragischen werden beleuchtet.
Welche Schlüsselmomente in Margaretes Entwicklung werden analysiert?
Die Arbeit analysiert Margaretes ersten Auftritt, ihre Reaktion auf Faust in der „Abend“-Szene, ihre Verführung, ihre Innensicht am Spinnrad, ihre Erfahrungen in Marthens Garten und schließlich ihren Zustand der Trauer. Der Wandel ihrer Persönlichkeit und ihres Selbstverständnisses wird im Detail untersucht.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Goethe, Faust I, Margareten-Tragödie, Tragödie, Margaretes Entwicklung, Liebe, Schuld, Verführung, Katharsis, Weimarer Klassik, Existentialismus, Interpretation.
Welche Kapitelzusammenfassungen werden angeboten?
Die Arbeit bietet Kapitelzusammenfassungen für alle sechs Kapitel, die die jeweiligen Inhalte und Schwerpunkte kurz und prägnant beschreiben.
Werden alternative Interpretationen der Margareten-Figur berücksichtigt?
Ja, die Arbeit hinterfragt gängige Interpretationen und versucht, alternative Perspektiven auf Margaretes Figur zu entwickeln, die über das Klischee der „verführten Unschuld“ hinausgehen.
Wie wird die Bedeutung der Namensgebung (Margarete/Gretchen) behandelt?
Die Arbeit erwähnt die unterschiedliche Verwendung der Namen Margarete und Gretchen, ohne jedoch die historische Ableitung näher zu erläutern. Die Bedeutung im Kontext der Entwicklung der Figur wird diskutiert.
- Quote paper
- Katrin Bänsch (Author), 2007, Die 'Margareten–Tragödie': Margaretes Entwicklung in Goethes "Faust. Der Tragödie erster Teil", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/86348