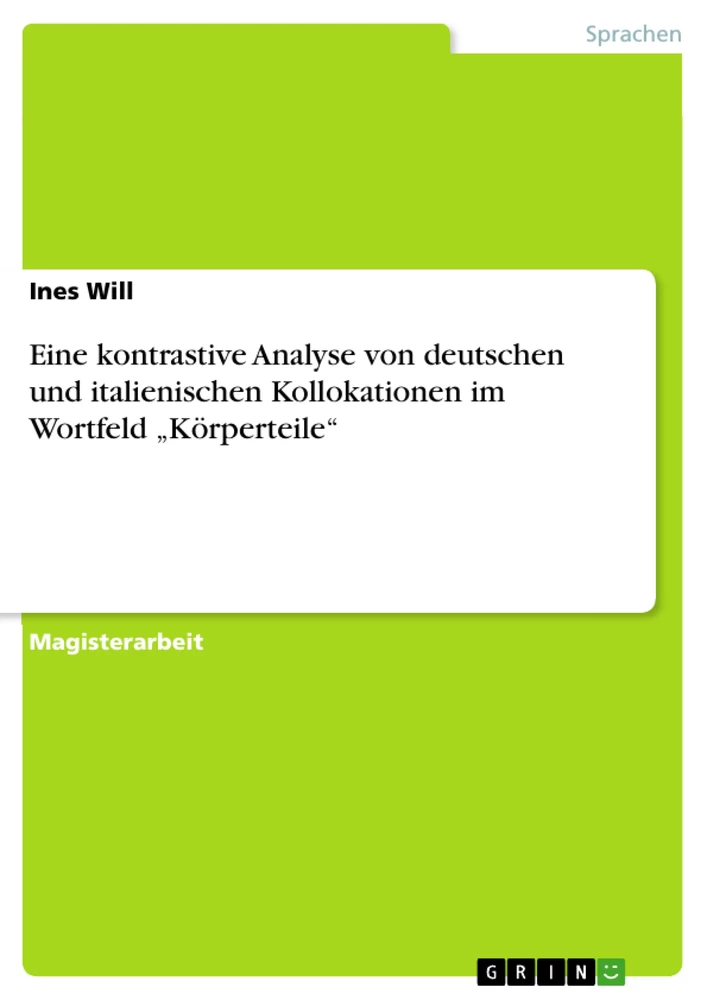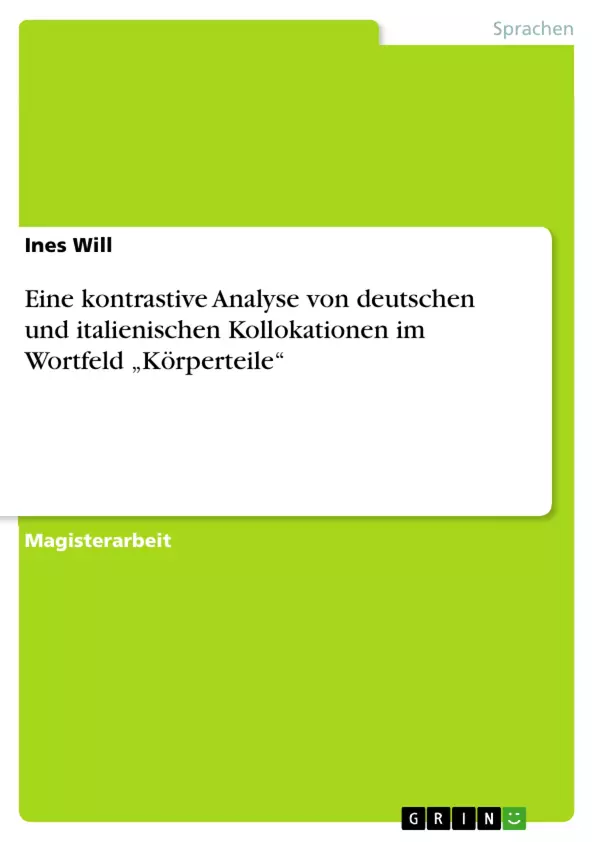Wortverbindungen haben es in sich: Für Nichtmuttersprachler stellen sie bisweilen eine große Hürde dar. Denn wer kann schon begründen, warum man sich im Deutschen die Zähne putzt während man sie im Italienischen wäscht (lavare i denti)?
Man fällt ein Urteil, wünscht sich Hals- und Beinbruch - und wer zu spät kommt den bestraft das Leben.
Beim Sprechen werden nicht nur einzelne Wörter zu sinnvollen Sätzen zusammengefügt, sondern man verwendet allgemein übliche Wortkombinationen, die dem täglichen Sprachgebrauch angehören. Sie werden bereits im frühen Kindesalter als zusammenhängende Einheiten gelernt und im mentalen Lexikon gespeichert. Deshalb gebrauchen Muttersprachler intuitiv korrekte und passende Verbindungen. Lernt man hingegen eine Fremdsprache, besteht stets die Gefahr, dass die Kombinationsregeln dieser Sprache verletzt werden, da diese von den Gesetzmäßigkeiten der eigenen Muttersprache nicht selten abweichen.
In der vorliegenden Arbeit wird ein Typ dieser Wortverbindungen, die sogenannten Kollokationen genauer untersucht. Das sind auf den ersten Blick eher unauffällige, semantisch durchsichtige Fügungen, wie zum Beispiel eingefleischter Junggeselle bzw. it. scapolo impenitente.
Die wichtigste Zielsetzung dieser Arbeit besteht in einem synchronen kontrastiven Vergleich von italienischen und deutschen Kollokationen im Wortfeld „Körperteile“. Dabei werden morphologisch - syntaktische und semantisch - lexikalische Ähnlichkeiten und Unterschiede besonders berücksichtigt. Es werden auch sprachdidaktische und lexikographische Aspekte in die Betrachtungen miteinbezogen.
Zunächst sind die Kollokationen in den Bereich der Phraseologie, der Lehre von den festen Wortverbindungen einzuordnen. Es werden die zentrale Terminologie, sowohl für Phraseologismen als auch Kollokationen, und die damit zusammenhängenden vielfältigen Definitions - und Abgrenzungprobleme erörtert. Weiterhin werden die, für die Sprachwissenschaft wichtigsten Grundkonzepte des Kollokationsbegriffs und dessen Abgrenzung von anderen linguistischen Konzepten erläutert. Diese Vorüberlegungen zu Kollokationen bilden den theoretischen Rahmen der kontrastiven Analyse, die den zweiten Teil der Arbeit ausmacht. Die Analyse beschränkt sich auf deutsche und italienische Substantiv - Verb - Kollokationen und Substantiv - Adjektiv - Kollokationen im Wortfeld „Körperteile“, die verschiedenen ein - und zweisprachigen Wörterbüchern entnommen wurden. Das dadurch entstandene Untersuchungskorpus wird nach verschiedenen Methoden untersucht und bewertet. Das Korpus musste insoweit begrenzt werden, dass dessen manuelle Bearbeitung möglich war und der Rahmen dieser Arbeit nicht gesprengt wurde.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Zielsetzung
- 1.2 Stand der Wissenschaft
- 2. Die Stellung der Kollokationen in der Phraseologie
- 2.1 Gegenstandsbestimmung der Phraseologie
- 2.2 Zum Wesen phraseologischer Einheiten
- 2.2.1 Polylexikalität
- 2.2.2 Idiomatizität
- 2.2.3 Stabilität
- 2.2.4 Reproduzierbarkeit
- 2.2.5 Lexikalisierung
- 2.3 Klassifikation der phraseologischen Einheiten
- 2.3.1 PE als festgeprägte Sätze
- 2.3.2 PE als Wortgruppen
- 3. Die Analyse des Kollokationbegriffes im Rahmen der Sprachwissenschaft
- 4. Deutsche und italienische Kollokationen im Wortfeld „Körperteile“
- 4.1 Kollokationsauffassung der kontrastiven Analyse
- 4.2 Das Korpus
- 4.2.1 Substantiv - Adjektiv - Kollokationen
- 4.2.2 Substantiv - Verb - Kollokationen
- 4.3 Beschreibungsmethode
- 4.4 Äquivalenzbeziehungen bei deutschen und italienischen Kollokationen im Wortfeld „Körperteile“
- 4.5 Sprachkontrastive Effekte
- 5. Die Bedeutung der Kollokationen für praktische Aufgabenstellungen
- 5.1 Kollokationen in der Übersetzung
- 5.2 Kollokationen im Fremdsprachenunterricht
- 5.3 Kollokationen als lexikographisches Problem
- 6. Zusammenfassung
- 7. Schlussbemerkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Magisterarbeit untersucht Kollokationen, einen speziellen Typ von Wortverbindungen, im Deutschen und Italienischen. Die Hauptzielsetzung besteht in einem kontrastiven Vergleich dieser Kollokationen im semantischen Feld „Körperteile“. Dabei werden morphologisch-syntaktische und semantisch-lexikalische Aspekte analysiert. Die Arbeit berücksichtigt auch sprachdidaktische und lexikographische Implikationen.
- Kontrastive Analyse deutscher und italienischer Kollokationen
- Untersuchung der morphologisch-syntaktischen und semantisch-lexikalischen Eigenschaften von Kollokationen
- Klassifizierung und Definition von Kollokationen
- Bedeutung von Kollokationen für Übersetzung und Fremdsprachenunterricht
- Kollokationen als lexikographisches Problem
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Kollokationen ein und erläutert die Problematik ihrer Verwendung für Nicht-Muttersprachler. Sie begründet die Notwendigkeit einer kontrastiven Analyse von deutschen und italienischen Kollokationen im Wortfeld „Körperteile“ und skizziert den Aufbau der Arbeit. Besonders hervorgehoben wird die Schwierigkeit, die intuitiv korrekte Verwendung von Wortverbindungen in einer Fremdsprache zu erlernen, da diese oft von den Regeln der Muttersprache abweichen.
2. Die Stellung der Kollokationen in der Phraseologie: Dieses Kapitel ordnet die Kollokationen in den Bereich der Phraseologie ein. Es definiert zentrale Begriffe der Phraseologie, wie Phraseologismen und Kollokationen, und beleuchtet die damit verbundenen Definitionsprobleme und Abgrenzungsschwierigkeiten zu anderen linguistischen Konzepten. Es wird eine differenzierte Betrachtung der Eigenschaften phraseologischer Einheiten (Polylexikalität, Idiomatizität, Stabilität, Reproduzierbarkeit, Lexikalisierung) vorgenommen und verschiedene Klassifizierungsmöglichkeiten vorgestellt.
3. Die Analyse des Kollokationbegriffes im Rahmen der Sprachwissenschaft: Dieses Kapitel befasst sich eingehend mit dem Kollokationsbegriff in der Sprachwissenschaft. Es grenzt Kollokationen von anderen syntagmatischen Beziehungen wie freien Wortverbindungen, Idiomen und Funktionsverbgefügen ab. Der britische Kontextualismus (Firth, Halliday, Sinclair) und wichtige lexikographische Ansätze (Cowie, Benson, Hausmann) zur Beschreibung von Kollokationen werden vorgestellt und diskutiert. Schließlich werden Selektionsbeschränkungen, Kollokationsrestriktionen und der Begriff der Kollokabilität erläutert und verschiedene Klassifikationsmöglichkeiten vorgestellt.
4. Deutsche und italienische Kollokationen im Wortfeld „Körperteile“: Der Kern der Arbeit liegt in der kontrastiven Analyse von deutschen und italienischen Kollokationen im Wortfeld „Körperteile“. Das Kapitel beschreibt die gewählte Kollokationsauffassung, das verwendete Korpus (Substantiv-Adjektiv- und Substantiv-Verb-Kollokationen), und die angewandte Beschreibungsmethode. Im Fokus steht die Untersuchung von Äquivalenzbeziehungen (vollständige, partielle, fehlende Äquivalenz) und die Analyse sprachkontrastiver Effekte, wobei freie Verbindungen, Idiome und Kollokationen verglichen werden. Die Konzeptualisierung und Kategorisierung von Kollokationen werden ebenfalls behandelt.
5. Die Bedeutung der Kollokationen für praktische Aufgabenstellungen: Dieses Kapitel widmet sich den praktischen Implikationen der Kollokationsanalyse. Es untersucht die Bedeutung von Kollokationen in der Übersetzung, im Fremdsprachenunterricht und in der Lexikographie, wobei die Herausforderungen bei der Bewältigung dieser lexikalischen Einheiten in diesen Kontexten dargestellt werden.
Schlüsselwörter
Kollokationen, kontrastive Analyse, Deutsch, Italienisch, Körperteile, Phraseologie, Lexikographie, Fremdsprachenunterricht, Übersetzung, Sprachwissenschaft, semantische Analyse, morphologisch-syntaktische Analyse, Äquivalenz.
Häufig gestellte Fragen zur Magisterarbeit: Kontrastive Analyse deutscher und italienischer Kollokationen im Wortfeld „Körperteile“
Was ist der Gegenstand dieser Magisterarbeit?
Die Magisterarbeit untersucht Kollokationen, einen speziellen Typ von Wortverbindungen, im Deutschen und Italienischen. Der Fokus liegt auf einem kontrastiven Vergleich dieser Kollokationen im semantischen Feld „Körperteile“, wobei morphologisch-syntaktische und semantisch-lexikalische Aspekte analysiert werden. Die Arbeit betrachtet auch sprachdidaktische und lexikographische Implikationen.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Hauptzielsetzung besteht in einem kontrastiven Vergleich deutscher und italienischer Kollokationen im semantischen Feld „Körperteile“. Es werden die morphologisch-syntaktischen und semantisch-lexikalischen Eigenschaften dieser Kollokationen analysiert, ihre Klassifizierung und Definition erörtert und ihre Bedeutung für Übersetzung und Fremdsprachenunterricht beleuchtet. Die Arbeit thematisiert auch die Herausforderungen, die Kollokationen in der Lexikographie darstellen.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Schwerpunkte: kontrastive Analyse deutscher und italienischer Kollokationen, Untersuchung der morphologisch-syntaktischen und semantisch-lexikalischen Eigenschaften von Kollokationen, Klassifizierung und Definition von Kollokationen, Bedeutung von Kollokationen für Übersetzung und Fremdsprachenunterricht sowie Kollokationen als lexikographisches Problem.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in sieben Kapitel: Einleitung, die Stellung der Kollokationen in der Phraseologie, die Analyse des Kollokationsbegriffes in der Sprachwissenschaft, deutsche und italienische Kollokationen im Wortfeld „Körperteile“, die Bedeutung der Kollokationen für praktische Aufgabenstellungen, Zusammenfassung und Schlussbemerkung. Jedes Kapitel behandelt spezifische Aspekte der Kollokationsanalyse, von der Einordnung in die Phraseologie bis hin zu den praktischen Implikationen für Übersetzung und Lexikographie.
Was wird im Kapitel „Die Stellung der Kollokationen in der Phraseologie“ behandelt?
Dieses Kapitel ordnet Kollokationen in den Bereich der Phraseologie ein. Es definiert zentrale Begriffe wie Phraseologismen und Kollokationen und beleuchtet Definitionsprobleme und Abgrenzungsschwierigkeiten zu anderen linguistischen Konzepten. Es analysiert Eigenschaften phraseologischer Einheiten (Polylexikalität, Idiomatizität, Stabilität, Reproduzierbarkeit, Lexikalisierung) und präsentiert verschiedene Klassifizierungsmöglichkeiten.
Was wird im Kapitel „Die Analyse des Kollokationbegriffes im Rahmen der Sprachwissenschaft“ behandelt?
Dieses Kapitel untersucht den Kollokationsbegriff in der Sprachwissenschaft. Es grenzt Kollokationen von anderen syntagmatischen Beziehungen ab und diskutiert den britischen Kontextualismus (Firth, Halliday, Sinclair) und lexikographische Ansätze (Cowie, Benson, Hausmann). Selektionsbeschränkungen, Kollokationsrestriktionen, Kollokabilität und verschiedene Klassifikationsmöglichkeiten werden erläutert.
Was ist der Inhalt des Kapitels „Deutsche und italienische Kollokationen im Wortfeld „Körperteile““?
Dieses Kapitel beinhaltet die kontrastive Analyse deutscher und italienischer Kollokationen im Wortfeld „Körperteile“. Es beschreibt die gewählte Kollokationsauffassung, das verwendete Korpus (Substantiv-Adjektiv- und Substantiv-Verb-Kollokationen) und die angewandte Methode. Es untersucht Äquivalenzbeziehungen (vollständige, partielle, fehlende Äquivalenz) und analysiert sprachkontrastive Effekte im Vergleich von freien Verbindungen, Idiomen und Kollokationen. Die Konzeptualisierung und Kategorisierung von Kollokationen werden ebenfalls behandelt.
Welche praktischen Implikationen werden im Kapitel „Die Bedeutung der Kollokationen für praktische Aufgabenstellungen“ behandelt?
Dieses Kapitel widmet sich den praktischen Implikationen der Kollokationsanalyse. Es untersucht die Bedeutung von Kollokationen in der Übersetzung, im Fremdsprachenunterricht und in der Lexikographie und zeigt die Herausforderungen bei der Bewältigung dieser lexikalischen Einheiten in diesen Kontexten auf.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für diese Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Kollokationen, kontrastive Analyse, Deutsch, Italienisch, Körperteile, Phraseologie, Lexikographie, Fremdsprachenunterricht, Übersetzung, Sprachwissenschaft, semantische Analyse, morphologisch-syntaktische Analyse, Äquivalenz.
- Quote paper
- Ines Will (Author), 2005, Eine kontrastive Analyse von deutschen und italienischen Kollokationen im Wortfeld „Körperteile“, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/86430