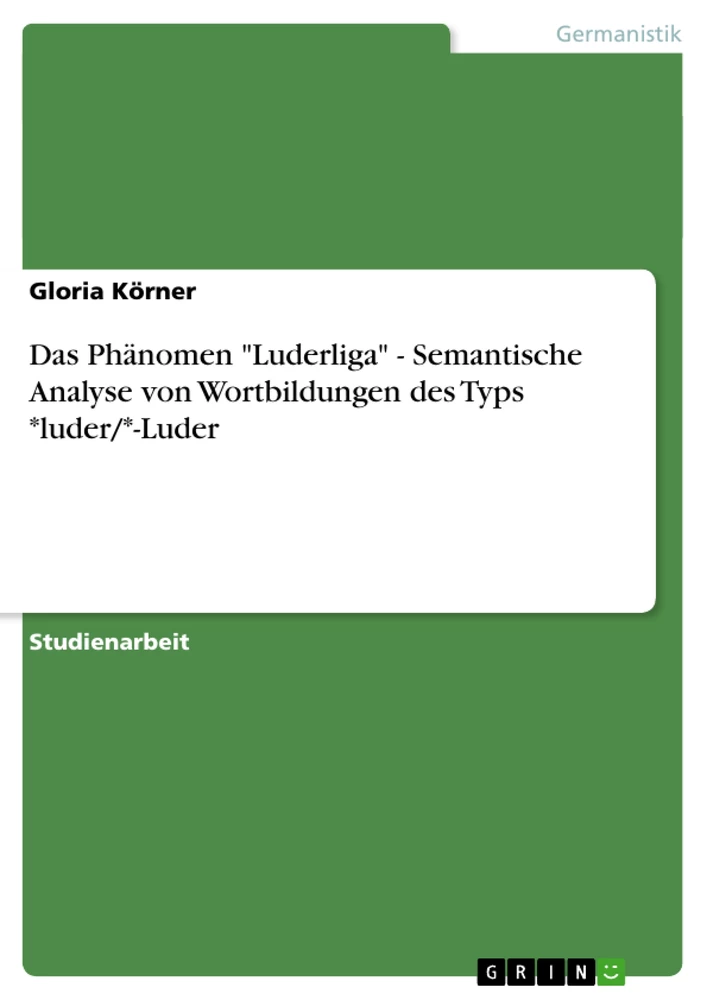„Luder – Das Wort kann auf eine erstaunliche Begriffskarriere in den 1990er Jahren zurückblicken, als die Gazetten plötzlich einen neuen Typus Frau entdeckten, der mit Hilfe unkonventioneller Methoden die Aufmerksamkeit prominenter Personen sucht. Neben dem vom Autorennen allseits bekannten Boxenluder gab es das Puddingluder […], das Teppichluder[…] und das Botschaftsluder[…], um nur einige zu nen-nen.“(Mrozek 2007, S.124)
Bei Untersuchung der Liste zur Wahl der Wörter des Jahres 2001 (Gesellschaft für deutsche Sprache) lässt sich der Begriff Luderliga auf dem 9. Platz finden. So hat es den Anschein, dass die oben zitierte Begriffskarriere sogar zum Erfinden einer Art eigenen Wettkampfklasse, in der die verschiedenen Luder erfasst werden können, führte.
Eine Recherche in digitalen Korpora des COSMAS II - Webdienstes des IDS Mann-heim lieferte bei den Suchanfragen *-Luder sowie *luder tatsächlich ca. 50 verschiedene Wortformvarianten. Diese recherchierten Wortbildungen stellen das Basismaterial für die Untersuchungen der Seminararbeit.
Hauptthema und zugleich Untersuchungsziel ist die semantische Analyse unterschiedlicher Wortformen des Typus *luder / *-Luder. Überprüft werden der jeweilige Kontext, mögliche Paraphrasen, die Abhängigkeit des Bedeutungsverständnisses vom Kontextwissen und die erzielte Konnotation der Wortbildung; Hauptaugenmerk soll vor allem auf den assoziativen, emotionalen, stilistischen oder wertenden Nebenbedeutungen der Wortbildungen liegen.
Vorab findet eine formale Analyse der Wortformen hinsichtlich der Klassifikation ihrer Komponenten und der Wortbildungstypen sowie eine semantische Analyse der Erstglieder statt. Auf dieser Basis werden mögliche Gruppen gebildet und wenn notwendig eine Auswahl an Material getroffen.
Eingangs werden verschiedene Bedeutungen des Wortes Luder gegeben, die teilweise schon Assoziationen mit den zu untersuchenden Wortformen zulassen. Daraufhin folgt im Hinblick auf vermutete Untersuchungsergebnisse eine Sammlung von Attributen und Klischees, die einem Luder heute gemeinhin zugesprochen werden.
Ausgehend von jenen werden signifikant überwiegend negative Konnotationen der Wortformen erwartet.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Begriffsbestimmung Luder
- 2.1 Definitionen aus ausgewählten Wörterbüchern
- 2.2 Klischeeformulierungen
- 3. Formale Analyse der Wortbildungstypen
- 3.1 Determinativkomposita
- 3.1.1 Substantiv + Substantiv
- 3.1.2 Eigenname + Substantiv
- 3.1.3 Verbstamm + Substantiv
- 3.2 Präfixoidbildungen
- 3.3 Präfixbildungen
- 4. Semantische Analyse
- 4.1 Semantische Analyse der Erstglieder
- 4.2 Semantische Analyse der Wortbildungen
- 4.2.1 Beschreibungen von Opernrollen
- 4.2.2 Beschreibungen von Filmrollen
- 4.2.3 Eigennamen von Musikgruppen
- 4.2.4 Beschreibung von Comedy-/Kabarettprogramm
- 4.2.5 Bezeichnung realer Personen
- 4.2.5.1 Bezeichnung einer bestimmten Person
- 4.2.5.2 Bezeichnung einer Personengruppe
- 5. Auswertung der Untersuchungsergebnisse
- 6. Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit untersucht die semantische Analyse von Wortbildungen des Typs *luder/* -Luder. Das Hauptziel ist die Überprüfung des jeweiligen Kontextes, möglicher Paraphrasen, der Abhängigkeit des Bedeutungsverständnisses vom Kontextwissen und der erzielten Konnotation der Wortbildungen. Der Fokus liegt auf den assoziativen, emotionalen, stilistischen und wertenden Nebenbedeutungen.
- Semantische Entwicklung des Wortes "Luder"
- Formale Analyse von Wortbildungen mit "Luder"
- Kontextuelle Bedeutung von "Luder"-Komposita
- Konnotationen und Assoziationen mit "Luder"-Wortbildungen
- Analyse der Verwendung von "Luder" in verschiedenen Kontexten
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema ein und beschreibt die überraschende Karriere des Wortes "Luder" in den 1990er Jahren, als es zur Bezeichnung verschiedener Frauentypen verwendet wurde. Sie erwähnt die "Luderliga" und die Vielzahl an Wortbildungen mit "Luder", die Gegenstand der Untersuchung sind. Das Hauptziel der Arbeit, die semantische Analyse dieser Wortbildungen, wird klar formuliert.
2. Begriffsbestimmung Luder: Dieses Kapitel beleuchtet die Bedeutung des Wortes "Luder" aus etymologischer Sicht, vergleicht verschiedene Wörterbucheinträge und zeigt die semantische Entwicklung vom "Köder" zum Schimpfwort auf. Es werden verschiedene Bedeutungsfacetten und historische Entwicklungen des Wortes im Althochdeutschen, Mittelhochdeutschen und Neuhochdeutschen beschrieben und der Wandel der Bedeutung von "Beute" zum negativ konnotierten Schimpfwort wird nachvollzogen. Historische Beispiele und Zitate aus Wörterbüchern wie den Gebrüder Grimm unterstreichen die semantische Entwicklung.
Schlüsselwörter
Luder, Wortbildung, Semantik, Konnotation, Kontext, Klischee, Wortfeldanalyse, Kompositum, semantische Entwicklung, Assoziation, Negativkonnotation.
Häufig gestellte Fragen zur Seminararbeit: Semantische Analyse von Wortbildungen des Typs *Luder/* -Luder
Was ist der Gegenstand der Seminararbeit?
Die Seminararbeit untersucht die semantische Analyse von Wortbildungen, die das Wort "Luder" enthalten. Der Fokus liegt auf der Bedeutung im Kontext, möglichen Paraphrasen, der Abhängigkeit des Bedeutungsverständnisses vom Kontextwissen und den Konnotationen der Wortbildungen. Besondere Aufmerksamkeit wird den assoziativen, emotionalen, stilistischen und wertenden Nebenbedeutungen gewidmet.
Welche Ziele verfolgt die Arbeit?
Das Hauptziel ist die Überprüfung des Kontextes, in dem "Luder"-Wortbildungen verwendet werden. Es geht darum, die Bedeutung dieser Wortbildungen zu analysieren und zu verstehen, wie sich diese Bedeutung durch den Kontext verändert. Die Arbeit untersucht die semantische Entwicklung des Wortes "Luder" und die formalen Aspekte der Wortbildungen.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die semantische Entwicklung des Wortes "Luder", die formale Analyse von Wortbildungen mit "Luder", die kontextuelle Bedeutung von "Luder"-Komposita, die Konnotationen und Assoziationen mit "Luder"-Wortbildungen und die Analyse der Verwendung von "Luder" in verschiedenen Kontexten.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in mehrere Kapitel: Einleitung, Begriffsbestimmung "Luder" (inkl. Definitionen aus Wörterbüchern und Klischeeformulierungen), formale Analyse der Wortbildungstypen (Determinativkomposita, Präfixoidbildungen, Präfixbildungen), semantische Analyse (der Erstglieder und der Wortbildungen in verschiedenen Kontexten wie Opernrollen, Filmrollen, Musikgruppen etc.), Auswertung der Untersuchungsergebnisse und Resümee.
Welche Wortbildungstypen werden analysiert?
Die formale Analyse umfasst Determinativkomposita (Substantiv + Substantiv, Eigenname + Substantiv, Verbstamm + Substantiv), Präfixoidbildungen und Präfixbildungen.
Welche Kontexte werden in der semantischen Analyse betrachtet?
Die semantische Analyse untersucht die Verwendung von "Luder"-Wortbildungen in Beschreibungen von Opernrollen, Filmrollen, Eigennamen von Musikgruppen, Beschreibungen von Comedy-/Kabarettprogrammen und der Bezeichnung realer Personen (sowohl Einzelpersonen als auch Personengruppen).
Welche Schlüsselwörter sind relevant für die Arbeit?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Luder, Wortbildung, Semantik, Konnotation, Kontext, Klischee, Wortfeldanalyse, Kompositum, semantische Entwicklung, Assoziation, Negativkonnotation.
Welche Bedeutung hat das Wort "Luder" historisch?
Das Kapitel zur Begriffsbestimmung beleuchtet die etymologische Entwicklung des Wortes "Luder", vergleicht Wörterbucheinträge und zeigt den semantischen Wandel vom "Köder" zum Schimpfwort auf. Es wird die historische Entwicklung der Bedeutung von "Beute" bis hin zu der negativ konnotierten Verwendung nachvollzogen.
Welche überraschende Entwicklung des Wortes "Luder" wird in der Einleitung erwähnt?
Die Einleitung beschreibt die überraschende Karriere des Wortes "Luder" in den 1990er Jahren, als es zur Bezeichnung verschiedener Frauentypen verwendet wurde und die Entstehung von zahlreichen Wortbildungen mit "Luder" hervorrief.
- Quote paper
- Gloria Körner (Author), 2007, Das Phänomen "Luderliga" - Semantische Analyse von Wortbildungen des Typs *luder/*-Luder, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/86434