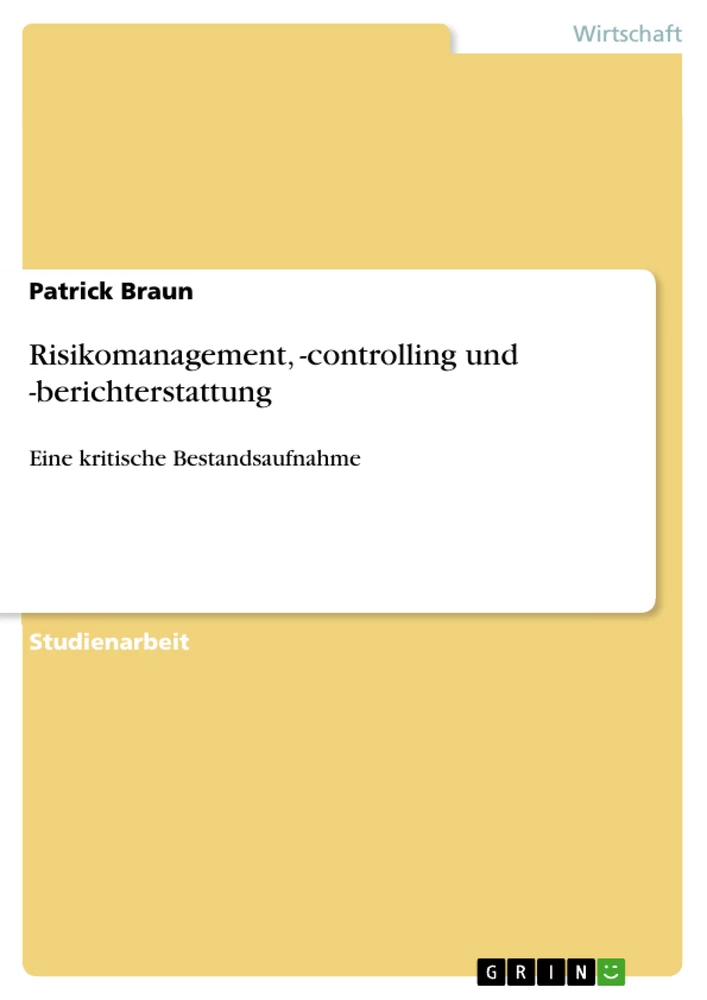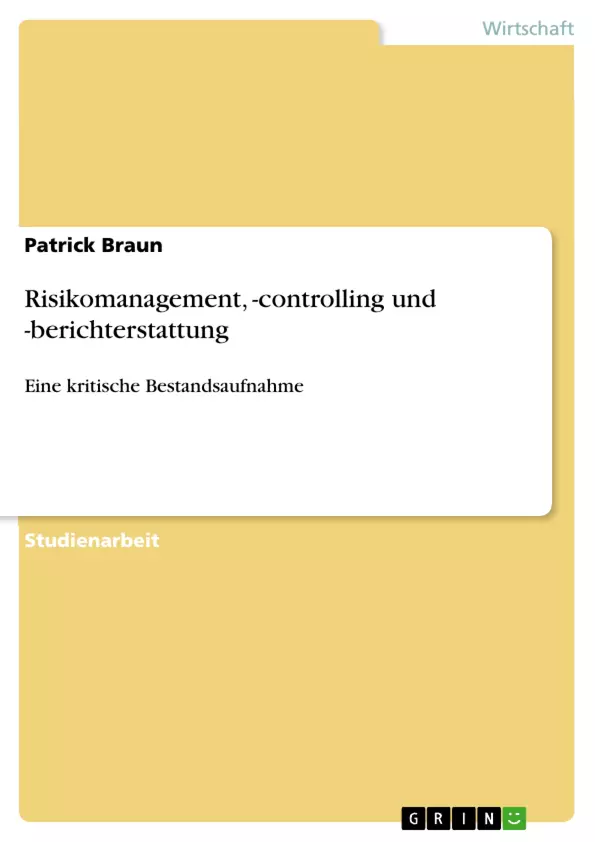Aufgrund der Unternehmensinsolvenzen der letzten Jahre hat sich kein anderes Fachgebiet der Betriebswirtschaft mit einer solchen Dynamik und Geschwindigkeit entwickelt wie das RM. Viele der Insolvenzen, insbesondere die Liquidationen einiger bekannter Großunternehmen (Holzmann AG, Bremer Vulkan etc.) sind auf fehlende Kontroll- und Informationssysteme, sowie fehlendes Risikobewusstsein zurückzuführen. Weitere Auslöser für diese Entwicklungen sind neue Risiken aus dem gewachsenen Wettbewerbsdruck, die stärkere Globalisierung, sowie dem drastischen Wandel der klassischen Geschäftsmodelle. Aufgrund dieser Evolutionen ist ein RM für eine langfristige und nachhaltige Unternehmensführung unabdingbar. Der Gesetzgeber hat mit der Verabschiedung des „Gesetzes zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich“ im Jahre 1998 dafür gesorgt, dass sich die Unternehmensführung mit den potenziellen Risiken systematisch und bewusst auseinander setzt. Durch diese Rechtsnorm wird das Management verpflichtet ein Risikomanagementsystem im Unternehmen zu installieren, sowie ausführlich im Lagebericht zur Risikosituation des Unternehmens Stellung zu beziehen. Das Ziel einer Implementierung ist die fortwährende und langfristige Unternehmenssteuerung durch Identifikation und Risikoanalyse sowie deren Bewertung, um so Risikostrategien herauszuarbeiten. Eine angemessene Berichterstattung im Lagebericht der Gesellschaft soll den Kapitalgebern einen passenden Eindruck über die Risikosituation des Unternehmens darlegen. Das Ziel dieser Arbeit ist es, die Bedeutung des Risikocontrollings in einem Unternehmen durch ein Risikomanagementsystem mit der dazugehörigen Risikoberichterstattung darzustellen und zu systematisieren. Aus diesem Grunde werden rechtliche und politische Rahmenbedingungen, ausgewählte Instrumente zur Analyse und Bewertung der Risiken sowie Anforderungen an die Berichterstattung thematisiert und dargestellt.
Abschließend erfolgen eine kritische Würdigung der Aufgaben und Ziele des RM, sowie ein Ausblick auf zukünftige Entwicklungen in diesem Bereich.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Ausgangslage
- 1.2 Ziel der Arbeit
- 2. Begriffsbestimmungen
- 2.1 Risiko
- 2.2 Risikomanagement/-controlling
- 3. Rechtliche-politische Hintergründe
- 3.1 Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich
- 3.2 2. Baseler Akkord (Basel II)
- 3.3 Sarbanes-Oxley-Act
- 3.4 Deutscher Rechnungslegungsstandard
- 4. Risikomanagement/-controlling/-berichterstattung
- 4.1 Risikomanagement
- 4.1.1 Risikofelder
- 4.1.2 Risikostrategie
- 4.1.3 Risikomanagementprozess
- 4.1.4 Instrumente zur Risikobewertung
- 4.1.4.1 Value-at-Risk
- 4.1.4.2 Risk Map
- 4.1.4.3 Cash-Flow-at-Risk
- 4.1.4.4 Scoring-Modell
- 4.1.4.5 Balanced Chance and Risk Card
- 4.2 Risikocontrolling
- 4.2.1 Konzept des Risikocontrollings
- 4.2.2 Risikocontrolling vs. Interne Revision
- 4.3 Risikoberichterstattung
- 4.3.1 Anforderungen
- 4.3.2 Gestaltung
- 4.3.2.1 Interne Berichterstattung
- 4.3.2.2 Externe Berichterstattung
- 5. Bewertung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht die Bedeutung von Risikocontrolling im Unternehmenskontext. Ziel ist die Darstellung und Systematisierung des Risikocontrollings innerhalb eines Risikomanagementsystems und der dazugehörigen Berichterstattung. Die Arbeit beleuchtet rechtliche und politische Rahmenbedingungen, analysiert ausgewählte Instrumente zur Risikobewertung und beschreibt Anforderungen an die Berichterstattung.
- Rechtliche und politische Rahmenbedingungen des Risikomanagements
- Instrumente zur Analyse und Bewertung von unternehmerischen Risiken
- Konzept und Bedeutung des Risikocontrollings
- Anforderungen an die Risikoberichterstattung (intern und extern)
- Zusammenhang zwischen Risikomanagement, -controlling und -berichterstattung
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung beschreibt den Kontext der Arbeit vor dem Hintergrund der gestiegenen Bedeutung von Risikomanagement (RM) nach diversen Unternehmensinsolvenzen. Sie betont die Notwendigkeit von Kontroll- und Informationssystemen sowie Risikobewusstsein für eine nachhaltige Unternehmensführung. Das KonTraG von 1998 wird als gesetzlicher Impuls für systematisches Risikomanagement genannt, welches die Identifizierung, Analyse, Bewertung von Risiken und die Entwicklung von Risikostrategien umfasst. Die Arbeit selbst hat zum Ziel, die Bedeutung des Risikocontrollings im Rahmen eines Risikomanagementsystems und der damit verbundenen Berichterstattung darzustellen und zu systematisieren.
2. Begriffsbestimmungen: Dieses Kapitel definiert die Kernbegriffe "Risiko" und "Risikomanagement/ -controlling". Es legt die Grundlage für das Verständnis der weiteren Kapitel, indem es die zentralen Konzepte präzise erklärt und voneinander abgrenzt. Die genaue Ausgestaltung dieser Definitionen ist essentiell für die konsistente Anwendung und Interpretation der im weiteren Verlauf verwendeten Methoden und Ansätze im Zusammenhang mit Risikoanalyse, Bewertung und Management.
3. Rechtliche-politische Hintergründe: Dieses Kapitel behandelt die rechtlichen und politischen Rahmenbedingungen, die das Risikomanagement beeinflussen. Es analysiert Gesetze und Regulierungen wie das KonTraG, Basel II und den Sarbanes-Oxley-Act, sowie den Deutschen Rechnungslegungsstandard (DRS). Der Fokus liegt auf den Auswirkungen dieser Regelungen auf die Anforderungen an die Implementierung und Dokumentation von Risikomanagementsystemen in Unternehmen. Die Analyse dieser Regelungen verdeutlicht die wachsende Bedeutung von Transparenz und Rechenschaftspflicht im Umgang mit unternehmerischen Risiken.
4. Risikomanagement/-controlling/-berichterstattung: Der Hauptteil der Arbeit konzentriert sich auf das Risikomanagement, -controlling und die -berichterstattung. Er beschreibt verschiedene Risikofelder, Risikostrategien und den Risikomanagementprozess. Ausführlich werden Instrumente zur Risikobewertung wie Value-at-Risk (VaR), Risk Map, Cash-Flow-at-Risk (CFAR), Scoring-Modelle und die Balanced Chance and Risk Card vorgestellt und erklärt. Das Kapitel beleuchtet das Konzept des Risikocontrollings im Vergleich zur internen Revision, und beschreibt die Anforderungen und Gestaltung der internen und externen Risikoberichterstattung. Das Kapitel veranschaulicht den komplexen und vielschichtigen Zusammenhang zwischen diesen drei Bereichen und zeigt, wie sie einander bedingen und ergänzen.
Schlüsselwörter
Risikomanagement, Risikocontrolling, Risikoberichterstattung, KonTraG, Basel II, Sarbanes-Oxley-Act, Deutscher Rechnungslegungsstandard, Risikoanalyse, Risikobewertung, Instrumente der Risikobewertung, Interne Revision, Unternehmensführung, Nachhaltigkeit.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Seminararbeit: Risikomanagement, -controlling und -berichterstattung
Was ist der Inhalt dieser Seminararbeit?
Diese Seminararbeit befasst sich umfassend mit dem Thema Risikomanagement, -controlling und -berichterstattung in Unternehmen. Sie untersucht die Bedeutung des Risikocontrollings im Unternehmenskontext, systematisiert dessen Platz innerhalb eines Risikomanagementsystems und analysiert die dazugehörige Berichterstattung. Die Arbeit beleuchtet rechtliche und politische Rahmenbedingungen, analysiert ausgewählte Instrumente zur Risikobewertung und beschreibt Anforderungen an die Berichterstattung (intern und extern).
Welche Themen werden in der Seminararbeit behandelt?
Die Arbeit umfasst folgende Schwerpunktthemen: Rechtliche und politische Rahmenbedingungen des Risikomanagements (KonTraG, Basel II, Sarbanes-Oxley-Act, DRS), Instrumente zur Analyse und Bewertung unternehmerischer Risiken (Value-at-Risk, Risk Map, Cash-Flow-at-Risk, Scoring-Modelle, Balanced Chance and Risk Card), Konzept und Bedeutung des Risikocontrollings im Vergleich zur internen Revision, Anforderungen an die Risikoberichterstattung (intern und extern), sowie den Zusammenhang zwischen Risikomanagement, -controlling und -berichterstattung.
Welche Kapitel beinhaltet die Seminararbeit?
Die Seminararbeit gliedert sich in fünf Kapitel: 1. Einleitung (Ausgangslage und Zielsetzung), 2. Begriffsbestimmungen (Risiko und Risikomanagement/-controlling), 3. Rechtliche-politische Hintergründe (KonTraG, Basel II, Sarbanes-Oxley-Act, DRS), 4. Risikomanagement/-controlling/-berichterstattung (Risikofelder, Risikostrategien, Risikobewertungsmethoden, internes und externes Reporting), und 5. Bewertung und Ausblick.
Welche Instrumente der Risikobewertung werden vorgestellt?
Die Arbeit beschreibt und erläutert verschiedene Instrumente zur Risikobewertung, darunter Value-at-Risk (VaR), Risk Map, Cash-Flow-at-Risk (CFAR), Scoring-Modelle und die Balanced Chance and Risk Card. Diese Instrumente werden im Kontext des Risikomanagements und -controllings eingeordnet und ihre Anwendungsmöglichkeiten erklärt.
Wie wird der Zusammenhang zwischen Risikomanagement, -controlling und -berichterstattung dargestellt?
Die Seminararbeit verdeutlicht den komplexen und vielschichtigen Zusammenhang zwischen Risikomanagement, -controlling und -berichterstattung. Sie zeigt, wie diese drei Bereiche einander bedingen und ergänzen, um ein effektives Risikomanagementsystem zu gewährleisten. Der Fokus liegt dabei auf der systematischen Darstellung der Interaktionen und Abhängigkeiten zwischen den einzelnen Bereichen.
Welche rechtlichen und politischen Rahmenbedingungen werden betrachtet?
Die Arbeit analysiert die relevanten rechtlichen und politischen Rahmenbedingungen, die das Risikomanagement beeinflussen. Hierzu gehören das Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich (KonTraG), der 2. Baseler Akkord (Basel II), der Sarbanes-Oxley-Act und der Deutsche Rechnungslegungsstandard (DRS). Die Auswirkungen dieser Regelungen auf die Implementierung und Dokumentation von Risikomanagementsystemen werden detailliert untersucht.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Seminararbeit?
Schlüsselwörter, die den Inhalt der Seminararbeit prägnant beschreiben, sind: Risikomanagement, Risikocontrolling, Risikoberichterstattung, KonTraG, Basel II, Sarbanes-Oxley-Act, Deutscher Rechnungslegungsstandard, Risikoanalyse, Risikobewertung, Instrumente der Risikobewertung, Interne Revision, Unternehmensführung, Nachhaltigkeit.
Was ist das Ziel der Seminararbeit?
Das Ziel der Seminararbeit ist die Darstellung und Systematisierung des Risikocontrollings innerhalb eines Risikomanagementsystems und der dazugehörigen Berichterstattung. Es soll die Bedeutung des Risikocontrollings im Unternehmenskontext aufgezeigt und die Anforderungen an ein effektives Risikomanagement im Hinblick auf die rechtlichen, politischen und praktischen Aspekte beleuchtet werden.
- Arbeit zitieren
- Patrick Braun (Autor:in), 2007, Risikomanagement, -controlling und -berichterstattung, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/86444