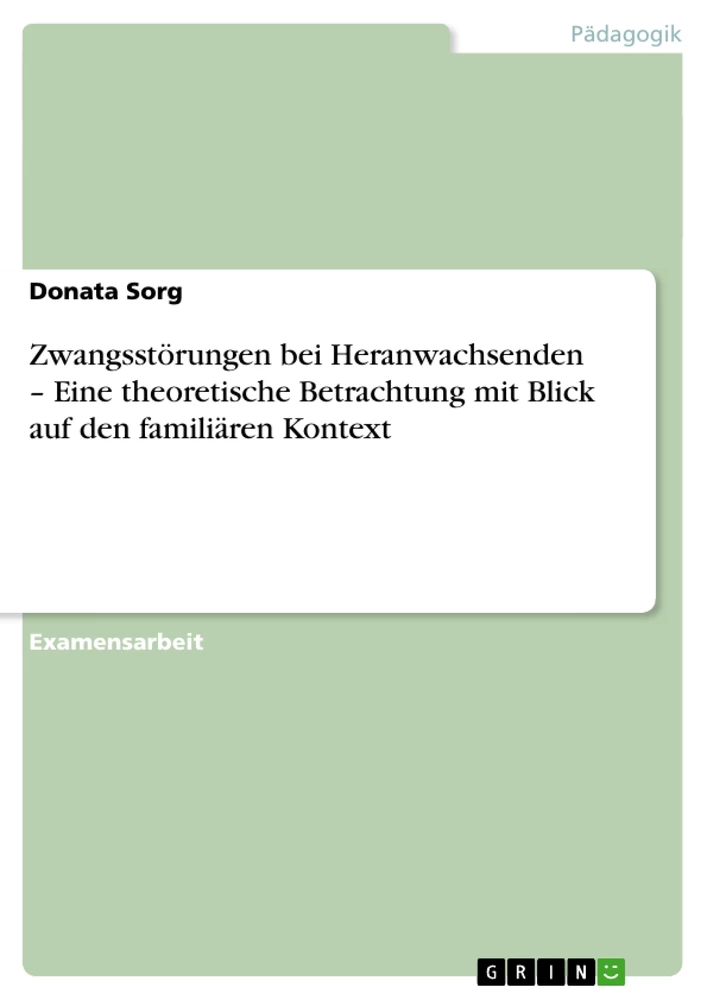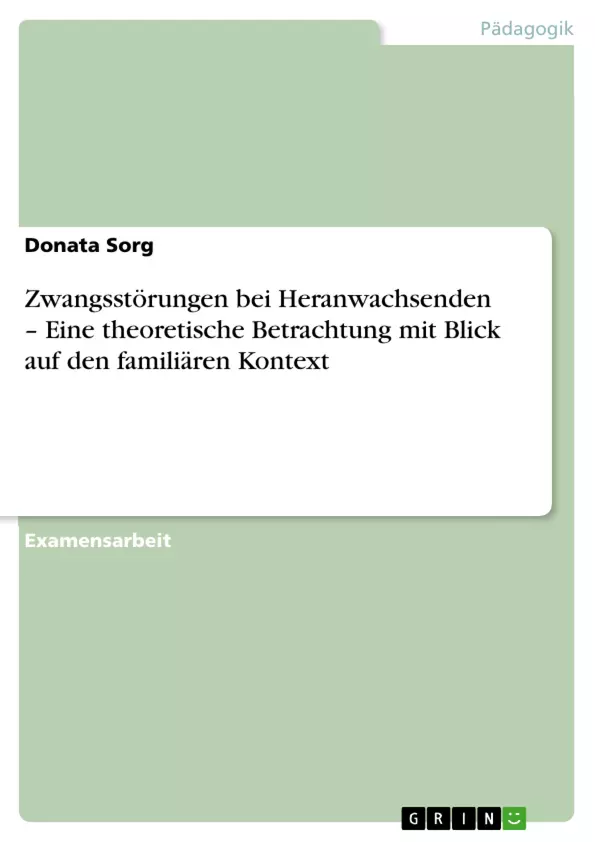Bei Zwangsstörungen mit Beginn im Kindes- und Jugendalter handelt es sich um ein schweres und belastendes Krankheitsbild, das sowohl für den Betroffenen als auch für seine Angehörigen und seine weitere soziale Umgebung ein schwer zu ertragendes psychisches Leiden darstellt. Umso bedeutender ist ein umfassendes Wissen um das Krankheitsbild, eine möglichst frühe Diagnostik und eine spezifisch wirksame Therapie, um eine Chronifizierung der Krankheit zu vermeiden.
Zwangsstörungen sind komplexe psychische Störungen, bei denen sich den Betroffenen Gedanken und Handlungen aufdrängen, die zwar als quälend empfunden werden, aber dennoch umgesetzt werden müssen. Der Betroffene erkennt, dass diese Zwänge übertrieben und sinnlos sind, kann sich ihnen jedoch nicht entziehen.
In Deutschland sind ca. 2-3% der Bevölkerung von Zwangsstörungen betroffen, unter den Heranwachsenden liegt die Rate bei ca. 1%. Nach den Depressionen, den Phobien und den Suchterkrankungen sind Zwänge die vierthäufigste psychische Krankheit.
Dennoch sind Zwangsstörungen kaum in der Öffentlichkeit bekannt. Retrospektive Untersuchungen zeigen, dass durchschnittlich erst 7-10 Jahre nach Beginn der Zwangsstörung eine Behandlung in Anspruch genommen wird. Dies liegt daran, dass häufig eine Unkenntnis der Problematik vorherrscht. Auch bei vielen Ärzten findet man immer noch veraltete Vorstellungen, was die Behandlungsmöglichkeiten für Zwänge betrifft.
Lange Zeit galten Zwangsstörungen als seltene und unheilbare Krankheit, für die man keine wirksamen Behandlungsmöglichkeiten kannte. Jahrzehntelang wurden Zwangsstörungen mit tiefenpsychologischen Verfahren therapiert, diese bewirkten allerdings keine Besserung der Symptomatik. Erst seit Anwendung der Verhaltenstherapie in den 60er Jahren können Zwänge wirksam behandelt werden. Heute stehen mit kognitiv-verhaltenstherapeutischen Techniken wirksame und empirisch erprobte Verfahren zur Behandlung von Zwängen zur Verfügung. Eine Verbesserung der Symptomatik kann auch durch die Einnahme bestimmter Psychopharmaka erreicht werden. Trotz dieser Fortschritte ist die Forschung von einer Ideallösung noch weit entfernt, denn selbst die heutigen Therapiemöglichkeiten erreichen nicht immer eine vollständige und dauerhafte Heilung.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Terminologische Abgrenzungen
- 2.1. Zwangsstörung
- 2.1.1. Klassifikation nach ICD-10
- 2.1.2. Klassifikation nach DSM IV
- 2.1.3. Lebenszeitprävalenz
- 2.2. Zwanghafte Persönlichkeitsstörung
- 2.3. Beziehung der Zwänge zu anderen Störungen
- 2.3.1. Zwänge und Phobien
- 2.3.2. Zwänge und Depressionen
- 2.3.3. Zwänge und Schizophrenie
- 2.3.4. Zwänge und Ticstörungen
- 2.3.5. Zwänge und Trichotillomanie
- 2.1. Zwangsstörung
- 3. Verlauf und Erscheinungsformen
- 3.1. Verlauf
- 3.2. Erscheinungsformen
- 3.2.1. Kontrollzwänge
- 3.2.2. Wasch- und Reinigungszwänge
- 3.2.3. Zwangsgedanken
- 3.2.4. Ordnungs-, Wiederholungs- und Zählzwänge
- 3.2.5. Sammel- und Hortzwänge
- 3.2.6. Zwanghafte Langsamkeit
- 3.2.7. Abergläubische Zwangsgedanken und -handlungen
- 4. Ursachen
- 4.1. Vererbung
- 4.2. Erziehung
- 4.3. Kindheit
- 4.4. Persönlichkeit
- 4.5. Krankheitsbeginn
- 4.6. Erklärungsmodelle für Zwangsstörungen
- 4.6.1. Das lerntheoretische Modell
- 4.6.2. Kognitive Modelle
- 4.6.3. Theorie zu Netzwerkstruktur von Zwängen
- 4.6.4. Gedächtnisschwäche
- 4.6.5. Paradoxer Effekt der Gedankenunterdrückung
- 4.6.6. Psychoanalyse
- 4.7. Biologische Faktoren
- 4.7.1. Neuropsychologische Einflüsse
- 4.7.2. Neurochemische Einflüsse
- 4.7.3. Verschiedene körperliche Krankheiten
- 5. Diagnose und Therapie
- 5.1. Diagnose und Differentialdiagnose
- 5.2. Therapiemöglichkeiten
- 5.2.1. Stationäre Behandlung
- 5.2.2. Zielsetzungen
- 5.2.3. Konfrontation/Exposition mit Reaktionsverhinderung
- 5.2.4. Kognitive Therapie
- 5.2.5. Familiäre Interventionen
- 5.2.6. Pharmakotherapie
- 5.2.7. Behandlung reiner Zwangsgedanken
- 5.3. Vorbeugung gegen Rückschritte und Rückfälle
- 5.4. Neurochirurgie
- 6. Familiäre und psychosoziale Aspekte
- 6.1. Sozioökonomische und religiöse Faktoren
- 6.2. Genetische Faktoren
- 6.3. Die Verstrickung der Familie
- 6.4. Familienklima, Erziehung und intrafamiliäre Kommunikation
- 7. Verallgemeinerung der Ergebnisse und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit Zwangsstörungen bei Heranwachsenden und untersucht diese unter Berücksichtigung des familiären Kontextes. Ziel ist es, ein umfassendes Verständnis der Störung, ihrer Ursachen, Erscheinungsformen und Therapiemöglichkeiten zu entwickeln.
- Definition und Abgrenzung von Zwangsstörungen
- Ursachen und Entstehung von Zwangsstörungen im Kindes- und Jugendalter
- Erscheinungsformen und Verlauf von Zwangsstörungen
- Diagnostik und Therapieansätze
- Der Einfluss des familiären Kontextes auf das Entstehen und den Verlauf von Zwangsstörungen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema Zwangsstörungen bei Heranwachsenden ein und erläutert die Relevanz der Betrachtung des familiären Kontextes. Sie skizziert den Aufbau der Arbeit und benennt die Forschungsfragen.
2. Terminologische Abgrenzungen: Dieses Kapitel definiert den Begriff der Zwangsstörung präzise und grenzt ihn von verwandten Konzepten wie der zwanghaften Persönlichkeitsstörung ab. Es werden die Klassifikationen nach ICD-10 und DSM-IV vorgestellt, sowie die Lebenszeitprävalenz der Störung diskutiert. Die Beziehungen zu anderen psychischen Erkrankungen wie Phobien, Depressionen, Schizophrenie und Ticstörungen werden detailliert beschrieben.
3. Verlauf und Erscheinungsformen: Der Verlauf einer Zwangsstörung wird im Detail dargestellt, von den ersten Anzeichen bis hin zur möglichen Chronifizierung. Die verschiedenen Erscheinungsformen, wie Kontrollzwänge, Wasch- und Reinigungszwänge, Zwangsgedanken und andere, werden differenziert beschrieben und mit Beispielen illustriert. Der Fokus liegt auf den Besonderheiten im Jugendalter.
4. Ursachen: Dieses Kapitel analysiert die multifaktoriellen Ursachen von Zwangsstörungen. Es beleuchtet genetische Faktoren, erzieherische Einflüsse, frühkindliche Erfahrungen und Persönlichkeitsmerkmale. Verschiedene Erklärungsmodelle, wie das lerntheoretische, kognitive und psychoanalytische Modell, werden vorgestellt und kritisch bewertet. Der Einfluss biologischer Faktoren wie neuropsychologische und neurochemische Prozesse wird ebenso erörtert.
5. Diagnose und Therapie: Dieses Kapitel beschreibt die diagnostischen Verfahren und die differenzialdiagnostische Abgrenzung zu anderen Störungen. Es stellt verschiedene Therapiemöglichkeiten vor, einschließlich stationärer Behandlung, kognitiver Verhaltenstherapie, familiärer Interventionen und Pharmakotherapie. Die Behandlung reiner Zwangsgedanken wird speziell behandelt. Die Vorbeugung gegen Rückfälle wird ebenfalls thematisiert.
6. Familiäre und psychosoziale Aspekte: Dieses Kapitel untersucht den Einfluss sozioökonomischer und religiöser Faktoren auf das Auftreten von Zwangsstörungen. Es analysiert die Rolle der Familie, das Familienklima, die Erziehung und die intrafamiliäre Kommunikation. Die Verstrickung der Familie in die Symptomatik wird eingehend betrachtet.
Schlüsselwörter
Zwangsstörungen, Heranwachsende, Familie, familiärer Kontext, ICD-10, DSM-IV, Kognitive Verhaltenstherapie, Pharmakotherapie, Diagnostik, Therapie, Verlauf, Erscheinungsformen, Ursachen, Erziehung, Genetik, Psychosoziale Faktoren.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu Zwangsstörungen bei Heranwachsenden
Was ist der Inhalt dieses Dokuments?
Dieses Dokument bietet einen umfassenden Überblick über Zwangsstörungen bei Heranwachsenden. Es beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel, und Schlüsselwörter. Der Fokus liegt auf der Betrachtung der Störung unter Berücksichtigung des familiären Kontextes.
Welche Themen werden im Dokument behandelt?
Das Dokument behandelt folgende Themen: Definition und Abgrenzung von Zwangsstörungen, Ursachen und Entstehung im Kindes- und Jugendalter, Erscheinungsformen und Verlauf, Diagnostik und Therapieansätze, sowie den Einfluss des familiären Kontextes auf das Entstehen und den Verlauf der Störung. Es werden verschiedene Klassifikationen (ICD-10, DSM-IV), Erklärungsmodelle (lerntheoretisch, kognitiv, psychoanalytisch, biologisch), und Therapiemöglichkeiten (kognitive Verhaltenstherapie, Pharmakotherapie, Familieninterventionen) detailliert beschrieben.
Wie werden Zwangsstörungen definiert und von anderen Störungen abgegrenzt?
Das Dokument definiert Zwangsstörungen präzise und grenzt sie von ähnlichen Konzepten wie der zwanghaften Persönlichkeitsstörung ab. Es beschreibt die Klassifikationen nach ICD-10 und DSM-IV und beleuchtet die Beziehungen zu anderen psychischen Erkrankungen wie Phobien, Depressionen, Schizophrenie und Ticstörungen.
Welche Ursachen werden für Zwangsstörungen genannt?
Die Ursachen werden als multifaktoriell beschrieben und umfassen genetische Faktoren, erzieherische Einflüsse, frühkindliche Erfahrungen, Persönlichkeitsmerkmale, und biologische Faktoren (neuropsychologische und neurochemische Einflüsse). Verschiedene Erklärungsmodelle, wie das lerntheoretische, kognitive und psychoanalytische Modell werden vorgestellt und diskutiert.
Welche Erscheinungsformen und Verlaufsformen von Zwangsstörungen werden beschrieben?
Das Dokument beschreibt detailliert verschiedene Erscheinungsformen wie Kontrollzwänge, Wasch- und Reinigungszwänge, Zwangsgedanken, Ordnungs-, Wiederholungs- und Zählzwänge, Sammel- und Hortzwänge, zwanghafte Langsamkeit und abergläubische Zwangsgedanken und -handlungen. Der Verlauf der Störung, von den ersten Anzeichen bis zur möglichen Chronifizierung, wird ebenfalls dargestellt.
Welche Diagnoseverfahren und Therapiemöglichkeiten werden vorgestellt?
Das Dokument beschreibt diagnostische Verfahren und die differenzialdiagnostische Abgrenzung zu anderen Störungen. Es stellt verschiedene Therapiemöglichkeiten vor, darunter stationäre Behandlung, kognitive Verhaltenstherapie, familiäre Interventionen und Pharmakotherapie. Die Behandlung reiner Zwangsgedanken und die Vorbeugung gegen Rückfälle werden ebenfalls thematisiert.
Welche Rolle spielt der familiäre Kontext bei Zwangsstörungen?
Das Dokument untersucht den Einfluss sozioökonomischer und religiöser Faktoren, die Rolle der Familie, das Familienklima, die Erziehung und die intrafamiliäre Kommunikation auf das Auftreten und den Verlauf von Zwangsstörungen. Die Verstrickung der Familie in die Symptomatik wird eingehend betrachtet.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren den Text?
Schlüsselwörter sind: Zwangsstörungen, Heranwachsende, Familie, familiärer Kontext, ICD-10, DSM-IV, Kognitive Verhaltenstherapie, Pharmakotherapie, Diagnostik, Therapie, Verlauf, Erscheinungsformen, Ursachen, Erziehung, Genetik, Psychosoziale Faktoren.
- Quote paper
- Donata Sorg (Author), 2007, Zwangsstörungen bei Heranwachsenden – Eine theoretische Betrachtung mit Blick auf den familiären Kontext, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/86474