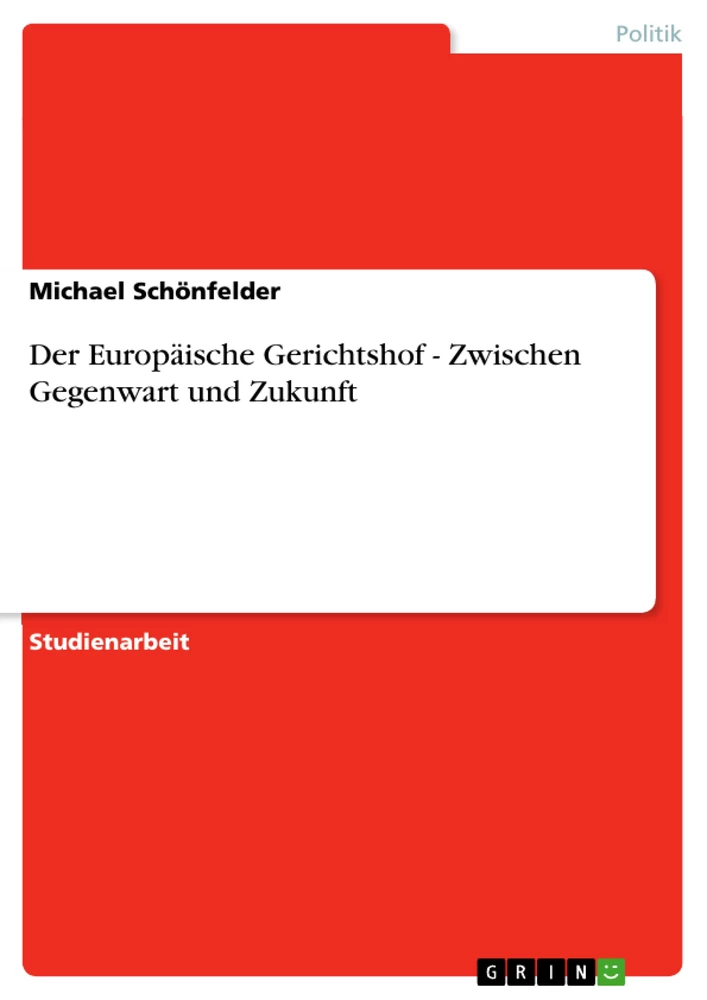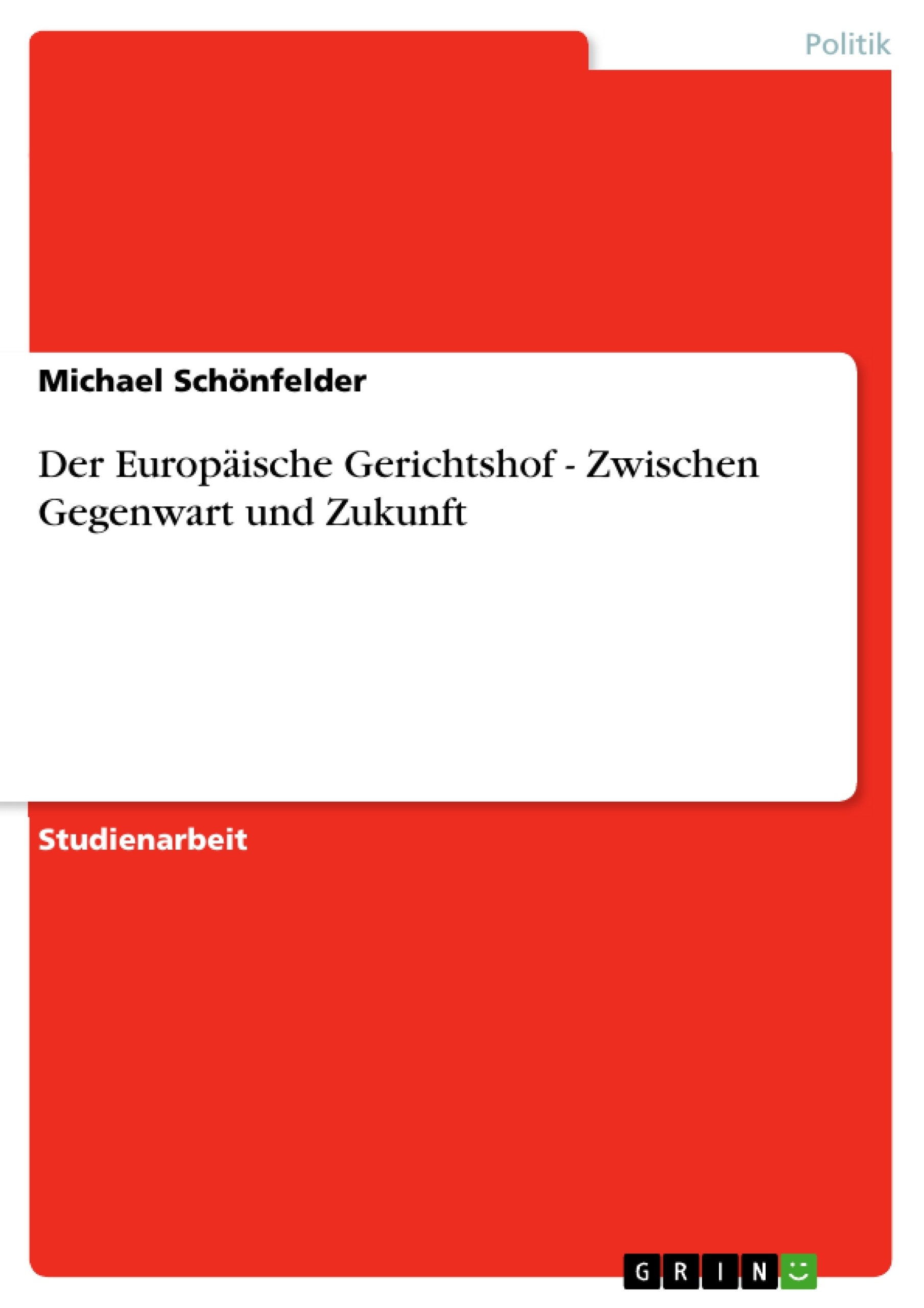I Vorwort
In der vorliegenden Hausarbeit wird der Versuch unternommen, die Funktion und die Bedeutung des Europäischen Gerichtshofes für das Leben in der Gemeinschaft zu beschreiben. Da es sich beim Europäischen Gerichtshof um ein relativ unbekanntes EU-Organ handelt, beginnt die Arbeit mit einer kleinen Einführung. Anschließend wird sowohl die Struktur als auch die Funktion des Gerichtshofes ausführlicher dargestellt.
Einen weiteren Untersuchungsgegenstand bilden die verschiedenen Klage- und Verfahrensarten, für die der Europäische Gerichtshof zuständig ist. Nach einem statistischen Überblick rücken dann die Probleme in den Vordergrund, mit denen der Gerichtshof zu kämpfen hat. Die Arbeit endet schließlich mit einer Begutachtung der erst vor kurzem in Kraft getretenen neuen Verfahrensordnung, die entworfen wurde, um die zuvor angesprochenen Probleme zu minimieren.
Da viel Wert auf Aktualität gelegt wurde, stammt ein Großteil des Quellenmaterials aus dem Internet. Aufbau und Zuständigkeit des Europäischen Gerichtshofes bzw. des Gerichtshofes erster Instanz lässt sich relativ einfach durch eine grafische Übersicht nachvollziehen, die unter http://europa.eu.int/cj/de/pres/comp.htm zu ersehen ist. Eine Liste der verwendeten Abkürzungen befindet sich am Ende der Hausarbeit.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Einführung
- Der EuGH als Organ
- Der EuGH als Verfassungsgericht
- Weitere Aufgaben des EuGH
- Der EuGH als „Hüter der Rechtsgemeinschaft“
- Die Klagearten
- Vertragsverletzungsklage
- Nichtigkeitsklage
- Untätigkeitsklage
- Schadensersatzklage
- Vorabentscheidungsverfahren
- Einheitliche Rechtsauslegung
- Kontrolle des Sekundären Gemeinschaftsrechts
- Die Tätigkeit des EuGH in Zahlen
- Forderungen des EuGH
- Konsequenzen der Forderungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit analysiert die Funktion und Bedeutung des Europäischen Gerichtshofes (EuGH) für das Leben in der Europäischen Gemeinschaft. Sie beleuchtet die Struktur und Aufgaben des Gerichtshofes sowie die verschiedenen Klage- und Verfahrensarten. Darüber hinaus werden die Herausforderungen des EuGH und die Auswirkungen der neuen Verfahrensordnung thematisiert.
- Der EuGH als Organ der Europäischen Gemeinschaft
- Die Rolle des EuGH als Verfassungsgericht
- Die verschiedenen Klage- und Verfahrensarten
- Die Herausforderungen des EuGH
- Die Auswirkungen der neuen Verfahrensordnung
Zusammenfassung der Kapitel
- Das Vorwort führt in die Thematik ein und beschreibt den Aufbau der Hausarbeit.
- Die Einführung stellt den EuGH als eines der fünf Organe der Europäischen Gemeinschaft vor und erläutert seine Aufgaben.
- Kapitel III beschreibt den EuGH als Organ der Europäischen Gemeinschaft und seine Kompetenzen.
- Kapitel IV behandelt den EuGH als Verfassungsgericht und seine Rolle bei der Anwendung der EG-Verträge.
- Kapitel V erläutert weitere Aufgaben des EuGH, wie z.B. die Überwachung von Rechtssetzungsakten der Kommission und des Rates.
- Kapitel VI beschreibt den EuGH als "Hüter der Rechtsgemeinschaft" und seine Rolle bei der Wahrung des Rechts in der Europäischen Gemeinschaft.
- Kapitel VII behandelt die verschiedenen Klagearten, die beim EuGH geltend gemacht werden können.
- Kapitel VIII behandelt das Vorabentscheidungsverfahren, ein wichtiges Instrument zur Sicherstellung der einheitlichen Rechtsauslegung in der Europäischen Gemeinschaft.
Schlüsselwörter
Europäischer Gerichtshof (EuGH), Europäische Gemeinschaft, EU-Recht, Rechtsprechung, Klagearten, Vorabentscheidungsverfahren, Verfahrensordnung, Rechtssicherheit, Rechtsschutz, Rechtsgemeinschaft.
Häufig gestellte Fragen
Welche Funktion hat der Europäische Gerichtshof (EuGH)?
Der EuGH sichert die Wahrung des Rechts bei der Auslegung und Anwendung der Verträge der Europäischen Union und fungiert als „Hüter der Rechtsgemeinschaft“.
Was ist ein Vorabentscheidungsverfahren?
Nationale Gerichte können den EuGH anrufen, um die Auslegung von EU-Recht zu klären. Dies sichert eine einheitliche Rechtsanwendung in allen Mitgliedstaaten.
Welche Klagearten gibt es beim EuGH?
Zu den wichtigsten gehören die Vertragsverletzungsklage, die Nichtigkeitsklage, die Untätigkeitsklage und die Schadensersatzklage.
Warum wird der EuGH als Verfassungsgericht bezeichnet?
Weil er über die Einhaltung der „Verfassung“ der EU (die Gründungsverträge) wacht und Streitigkeiten zwischen EU-Organen sowie zwischen Mitgliedstaaten und der EU schlichtet.
Welche Herausforderungen hat der EuGH aktuell?
Der Gerichtshof kämpft mit einer hohen Arbeitslast und langen Verfahrensdauern, weshalb regelmäßig neue Verfahrensordnungen zur Effizienzsteigerung entworfen werden.
- Quote paper
- Michael Schönfelder (Author), 2000, Der Europäische Gerichtshof - Zwischen Gegenwart und Zukunft, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/865