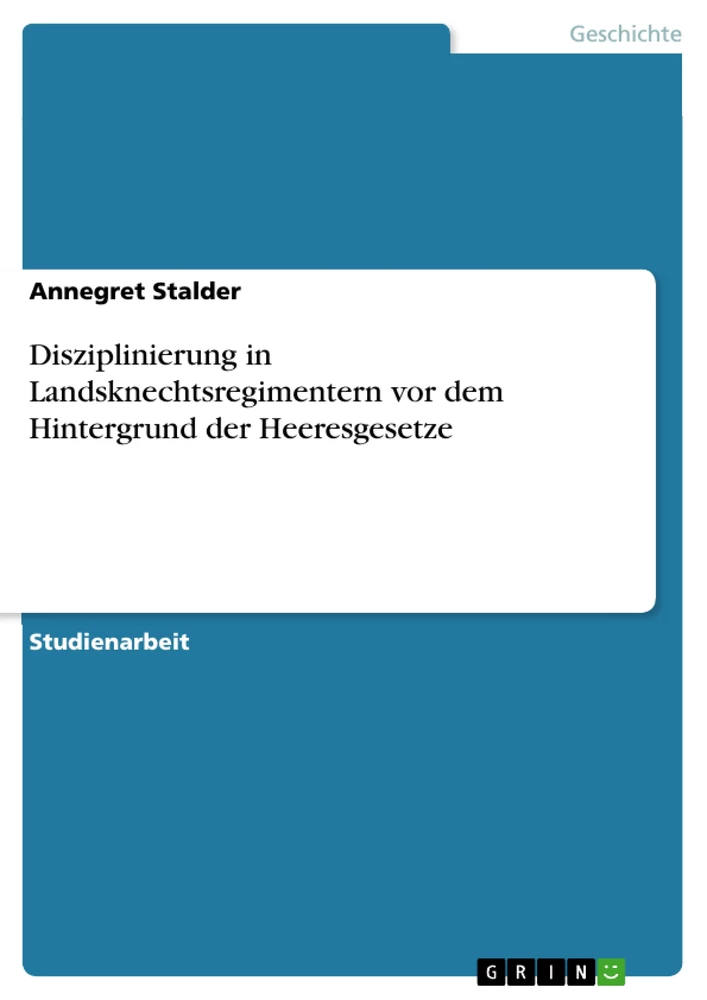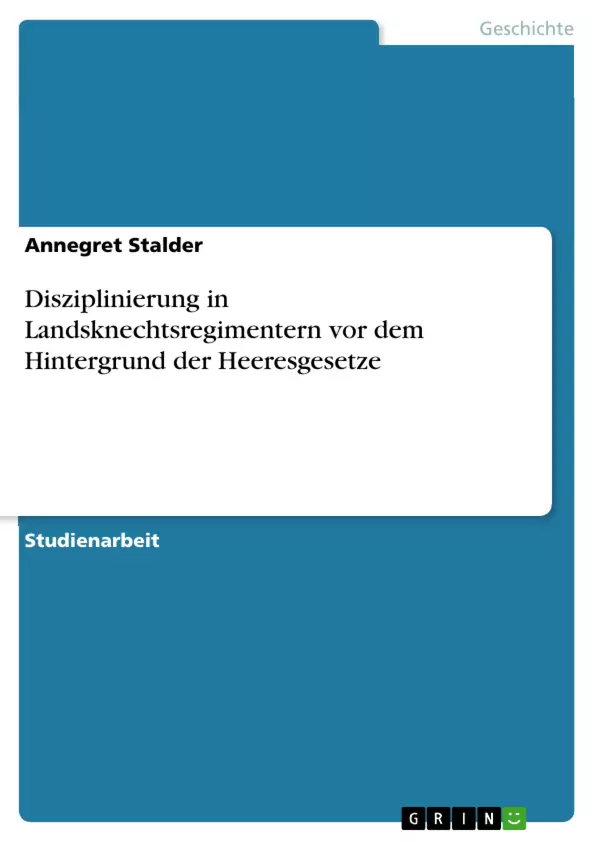Auch wenn der Erzherzog und spätere römische König Maximilan, der in der Forschung gerne als Schöpfer der Landsknechte genannt wird, mit der Einübung von Gefechtskörpern wie den bekannten Gevierthaufen und dem Igel großen Einfluss auf die Ausbildung der Landsknechte hatte, entwickelten diese im Laufe der Zeit zu erheblichen Teilen auch selbst Brauchtümer, Mitspracherechte, Verwaltungs- und Organisationsformen. Schon die unterschiedlichen Nationen innerhalb eines Trupps und die daraus entstehenden Schwierigkeiten, wie Verständigungsprobleme, machen deutlich, dass es sicherlich nicht einfach gewesen sein kann, diese verschiedenen Kriegsmänner einheitlich zu führen, Disziplin und Ordnung herzustellen und diese auch zu erhalten. Dazu kamen schließlich auch die Eigenarten und Ansprüche der einzelnen Söldnergruppen, wie speziell der Landsknechte.
Mit welchen Mitteln die Kriegsherren versuchten, die Landsknechte im 16. Jahrhundert zu disziplinieren, soll hier erörtert werden. Dabei ist es von Bedeutung sich zu vergegenwärtigen, was den Landsknecht ausmachte, wie er sich verhielt und wie er sich selbst verstand. Daraufhin soll behandelt werden, welche Ursachen Ungehorsam unter den Landsknechten erzeugten, und in welcher Form dieser auftrat. Nach der Besprechung der Rechtsordnung soll auf die Strafjustiz eingegangen werden. Auf die Disziplinierung mit religiösen Mitteln kann im Umfang dieser Arbeit nicht eingegangen werden. Es werden Quellen verwandt, um einerseits den Alltag des Knechts mit der Rechtsordnung zu schildern, auf der anderen Seite wird die rechtliche Grundlage, ein Artikelsbrief, als Bezugsort dienen.
Die Landsknechte haben sich durch eine eigene Sprache, andersartige Kleidung und Lebensstil, Lieder und Bräuche zu einer eigenen sozialen Schicht entwickelt. Sie plünderten und brandschatzten das Land auf eigene Faust, und machten den ortsansässigen Bauern das Leben zur Hölle. Ihre Trinkgelage arteten regelmäßig aus, sie waren Haudegen, denen erklärt musste, dass sie nicht wahllos mit ihren Hakenbüchsen um sich schießen konnten. Sie verspielten im Suff ihre Waffen und konnten oft wegen Trunkenheit ihren Dienst nicht antreten. Baumann beschreibt die Landsknechte bezeichnenderweise als „nicht nur “schlechte Deutsche“, sie waren auch schlechte „Soldaten“.“ Weiter beschreibt er, dass die Söldner ausdrücklich ermahnt werden mussten, den Kontakt zum Feind zu meiden und sich in die Schlachtordnung einzugliedern, wenn Alarm geschlagen wurde.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Selbstverständnis der Landsknechte
- 1.1 Motivation des Landsknechts
- 1.2 Habitus der Landsknechte
- 1.3 Organisation im Inneren des Landsknechtshaufens
- 2. Auslöser undisziplinierten Verhaltens: Der Sold
- 3. Formen der Gehorsamsverweigerung
- 3.1 Meutereien
- 3.2 Selbstversorgung durch Plünderungen
- 4. Verfassung und Organisation im Regiment
- 4.1 Heeresgesetze
- 4.2 Der Artikelsbrief
- 4.3 Regimentsämter
- 4.3.1 Der Obrist
- 4.3.2 Weitere Ämter
- 5. Rechtsprechung
- 6. Straftaten und deren Ahndung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Disziplinierung von Landsknechten in der Frühen Neuzeit. Sie untersucht, mit welchen Mitteln die Kriegsherren versuchten, diese Söldner im 16. Jahrhundert zu disziplinieren. Dabei werden das Selbstverständnis, das Verhalten und die Motivation der Landsknechte betrachtet sowie die Ursachen und Formen ihres Ungehorsams.
- Das Selbstverständnis der Landsknechte und deren eigene soziale Schicht
- Die Rolle des Soldes als Auslöser für undiszipliniertes Verhalten
- Formen der Gehorsamsverweigerung, wie Meutereien und Selbstversorgung durch Plünderungen
- Die Verfassung und Organisation im Regiment, einschließlich Heeresgesetze, Artikelsbriefe und Regimentsämter
- Die Rechtsprechung in Landsknechtsregimentern und die Ahndung von Straftaten
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Landsknechte als eigenständige Söldnergruppe ein und erläutert den Forschungsfokus auf deren Disziplinierung.
Kapitel 1 beleuchtet das Selbstverständnis der Landsknechte, ihre Motivation, ihren Habitus und ihre interne Organisation. Die Landsknechte zeichneten sich durch einen eigenen Lebensstil, Bräuche und eine eigene Sprache aus. Ihre Motivation lag in der Suche nach Arbeit, Abenteuerlust und der Aussicht auf Beute. Die interne Organisation mit ihrer eigenen Rechtsordnung und Mitsprache zeigte allerdings auch ihre Unberechenbarkeit.
Kapitel 2 analysiert den Sold als entscheidenden Faktor für Moral und Disziplin der Landsknechte. Ausbleibende Soldzahlungen führten zu Demoralisierung, Desertion und Meutereien, wodurch die Kriegsherren vor disziplinarische Probleme gestellt wurden.
Kapitel 3 widmet sich verschiedenen Formen der Gehorsamsverweigerung. Meutereien, als Zeichen des Protests gegen ausbleibende Soldzahlungen, und die Selbstversorgung durch Plünderungen, die im Artikelsbrief sogar rechtlich geregelt wurden, zeigten die Herausforderungen für die Kriegsherren bei der Disziplinierung der Landsknechte.
Kapitel 4 erläutert die Verfassung und Organisation im Regiment. Heeresgesetze, Artikelsbriefe und Regimentsämter dienten der Disziplinierung und der Rechtspflege. Der Artikelsbrief, ein Vertrag zwischen Landsknechten und Kriegsherren, regelte das Verhalten im Lager und in der Schlacht, den Schutz der Bevölkerung und die Rechte der Landsknechte. Der Obrist als Befehlshaber spielte eine zentrale Rolle bei der Führung und Disziplinierung des Regiments.
Kapitel 5 befasst sich mit der Rechtsprechung in Landsknechtsregimentern. Die Landsknechte verfügten über ein eigenes Rechtssystem, das von der Gemein ausgeübt wurde. Das Schultheißengericht, das von den Knechten selbst gewählt und vereidigt wurde, handelte nach altem Brauch und verhandelte Zivil- und Strafverfahren, einschließlich Todesstrafen. Das Recht der langen Spieße als Ehrengericht wurde hingegen als besonders grausam empfunden.
Kapitel 6 behandelt die verschiedenen Straftaten und deren Ahndung. Kleinere Vergehen wurden mit Geldstrafen bestraft, während schwerwiegendere Vergehen wie Fluchen, Misshandlung der Bevölkerung, Diebstahl, Schlägereien, Befehlsverweigerung, Fahnenflucht, Musterungsbetrug, Feigheit, Plünderungen und Verrat mit der Todesstrafe geahndet wurden. Öffentliche Strafen sollten die Macht und Autorität der Obrigkeit unter Beweis stellen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Disziplinierung von Landsknechten in der Frühen Neuzeit. Die wichtigsten Themen und Begriffe sind die Selbstorganisation, die Motivation, das Selbstverständnis der Landsknechte, der Sold als Auslöser für undiszipliniertes Verhalten, Meutereien, Plünderungen, Heeresgesetze, Artikelsbriefe, Regimentsämter, Rechtsprechung, Straftaten, Strafen und die Entwicklung von stehenden Heeren.
Häufig gestellte Fragen
Wer waren die Landsknechte im 16. Jahrhundert?
Landsknechte waren Söldner, die eine eigene soziale Schicht mit eigener Sprache, Kleidung und Bräuchen bildeten. Sie galten als kriegserfahren, aber oft schwer zu führen und undiszipliniert.
Was war die Hauptursache für Ungehorsam und Meutereien?
Der entscheidende Faktor war der Sold. Ausbleibende Zahlungen führten regelmäßig zu Demoralisierung, Desertion und gewaltsamen Meutereien gegen die Kriegsherren.
Was ist ein Artikelsbrief?
Ein Artikelsbrief war ein rechtlicher Vertrag zwischen den Söldnern und dem Kriegsherrn. Er regelte Pflichten, die Disziplin im Lager, den Schutz der Zivilbevölkerung und die Bestrafung von Vergehen.
Wie funktionierte die Rechtsprechung innerhalb der Regimenter?
Die Landsknechte hatten ein eigenes System, das Schultheißengericht. Die Richter wurden oft aus den eigenen Reihen gewählt und urteilten nach altem Brauch über Zivil- und Strafsachen.
Was versteht man unter dem „Recht der langen Spieße“?
Es war ein Ehrengericht, bei dem das gesamte Regiment über einen Kameraden richtete, der gegen die Ehre verstoßen hatte. Es galt als besonders grausam und diente der Abschreckung.
Welche Strafen drohten bei schweren Vergehen?
Schwere Straftaten wie Fahnenflucht, Verrat, Diebstahl oder Befehlsverweigerung wurden meist mit der Todesstrafe geahndet, während kleinere Delikte oft Geldstrafen nach sich zogen.
- Quote paper
- Annegret Stalder (Author), 2006, Disziplinierung in Landsknechtsregimentern vor dem Hintergrund der Heeresgesetze, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/86563