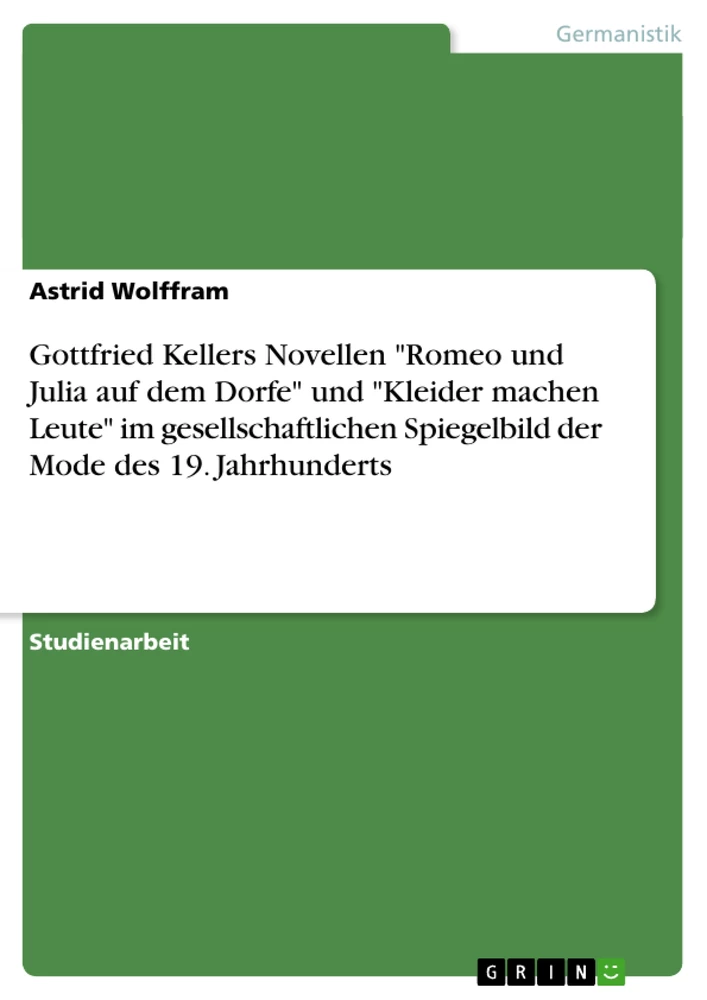In dieser Hausarbeit, die inhaltlich in drei Untersuchungsschwerpunkte gegliedert ist, werden die Novellen im Rahmen ihrer gesellschaftlichen Bezüge zur Mode des 19. Jahrhunderts betrachtet.
Im ersten Teil 'Wenzel Strapinski - ein Idealbild seiner Zeit' wird versucht dem Rätsel um die geheimnisvolle Figur Wenzel Strapinski, dem Protagonisten in Kleider machen Leute, auf die Schliche zu kommen. Das Bedeutungsspektrum dieser Figur wird in bezug auf die Modeästhetik und -entwicklung des 19. Jahrhunderts betrachtet. Bereits existierende Interpretationen zur Figur Wenzel Strapinski werden ebenso wie verschiedene Modetheorien und -geschichten in die Untersuchung mit einfließen. Zunächst wird das ästhetische Bedürfnis Strapinskis sowie sein individueller Kleidungsstil im Vergleich zur Männermode seiner Zeit analysiert.
Im zweiten Teil 'Mode versus Tracht' wird die entwicklungsspezifische Dissonanz zwischen der traditionellen Kleidung und der Mode analysiert. Zunächst wird diese in Beziehung zu den Antagonismen des 19. Jahrhunderts gesetzt und bezüglich der konträren Zeitauffassung der unterschiedlichen Kleidungsformen betrachtet. Anschließend werden die gegensätzlichen Zeichensysteme der Tracht und der Mode auf ihre Bedeutungsproblematik, die Sein-Schein Verwechslung, hin untersucht. Anhand der Gegenüberstellung der beiden Keller Novellen Kleider machen Leute und Romeo und Julia auf dem Dorfe wird der Bruch zwischen den oppositionellen Zeichensystemen veranschaulicht. Das Sein-Schein Problem, das sowohl in der Kleidung als auch in der unterschiedlichen Darstellungsweise der Häuser zu beobachten ist, wird anhand der Novellen belegt.
Im dritten Teil 'Das Fest - der Schauplatz der Mode' wird das Erzählmotiv Fest, wie es in den beiden Keller Novellen auftritt, thematisiert. Zuerst wird der von Sigmund Freud definierte Trieb des Sehens und Gesehenwerdens, der dem modischen Neugierverhalten zugrunde liegt, an der Novelle Romeo und Julia auf dem Dorfe veranschaulicht und auf seine Wurzeln hin analysiert.
Schließlich werden die Ergebnisse der Diskussion in konzentrierter Form, die essentiellen Gedankengänge aufzeichnend zusammengefaßt, um abschließend einen Überblick über die Hausarbeit zu geben.
Inhaltsverzeichnis
- Gegenstand und Zielsetzung der Arbeit
- Wenzel Strapinski - ein Idealbild seiner Zeit
- Die Kleidungsästhetik als Grundbedürfnis
- Strapinski als Individuum in der Gesellschaft
- Mode versus Tracht
- Der Kleidungsantagonismus
- Die Sein-Schein Problematik
- Das Fest - der Schauplatz der Mode
- Sehen und Gesehenwerden
- Das Ende des Festes
- Zusammenfassung der Darstellung und offene Fragen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit analysiert die Novellen "Kleider machen Leute" und "Romeo und Julia auf dem Dorfe" von Gottfried Keller im Kontext der Mode des 19. Jahrhunderts. Dabei werden die Novellen im Rahmen ihrer gesellschaftlichen Bezüge betrachtet.
- Die Bedeutung der Kleidungsästhetik und -entwicklung des 19. Jahrhunderts
- Die Figur Wenzel Strapinski als Idealbild seiner Zeit und dessen Bedeutung für das Gesellschaftssystem
- Die Dissonanz zwischen traditioneller Kleidung und Mode im 19. Jahrhundert
- Das Erzählmotiv "Fest" als Schauplatz der Mode und seine Rolle im gesellschaftlichen Kontext
- Die Vergänglichkeit und zyklische Wiederbelebung von Mode und Fest im Verhältnis zur Feuerbachschen Todesauffassung
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 legt den Fokus auf die Zielsetzung und den Gegenstand der Arbeit. Es werden die beiden Novellen "Kleider machen Leute" und "Romeo und Julia auf dem Dorfe" als Untersuchungsgegenstand vorgestellt und die Schwerpunkte der Analyse in Bezug auf die Mode des 19. Jahrhunderts erläutert.
Kapitel 2 beschäftigt sich mit der Figur Wenzel Strapinski, dem Protagonisten in "Kleider machen Leute". Es wird analysiert, wie seine Kleidung seinen Charakter und seine Rolle in der Gesellschaft widerspiegelt, sowie die Bedeutung seiner Kleidungsästhetik für das Idealbild des 19. Jahrhunderts.
Kapitel 3 beleuchtet den Gegensatz zwischen traditioneller Tracht und moderner Mode im 19. Jahrhundert. Die Analyse betrachtet die unterschiedlichen Zeichen- und Bedeutungssysteme der beiden Kleidungsformen sowie die Problematik der Sein-Schein-Verwechslung.
Kapitel 4 untersucht das Erzählmotiv "Fest" in den beiden Novellen. Es werden die Aspekte des Sehens und Gesehenwerdens im Zusammenhang mit modischem Verhalten sowie der gesellschaftliche Bedeutungsgehalt des Festes im Vergleich zum Phänomen der Mode beleuchtet.
Kapitel 5 bietet eine Zusammenfassung der Ergebnisse der Arbeit und fasst die essentiellen Gedankengänge zusammen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beleuchtet die Themen Mode, Kleidung, gesellschaftliche Bezüge, Tradition, Moderne, Idealbild, Schein und Sein, Fest, Sehen und Gesehenwerden, und Vergänglichkeit im Kontext der beiden Novellen "Kleider machen Leute" und "Romeo und Julia auf dem Dorfe" von Gottfried Keller. Die Analyse bezieht sich auf die Zeit des 19. Jahrhunderts und greift dabei auf die Modeästhetik, die Modetheorien, die Trivialliteratur und die Feuerbachsche Todesauffassung zurück.
Häufig gestellte Fragen
Welche Rolle spielt die Mode in „Kleider machen Leute“?
Die Mode ist das zentrale Motiv; durch seine edle Kleidung wird der arme Schneider Wenzel Strapinski fälschlicherweise für einen polnischen Grafen gehalten.
Was ist die „Sein-Schein-Problematik“ in Kellers Novellen?
Es beschreibt den gesellschaftlichen Konflikt, bei dem die äußere Erscheinung (Kleidung, Häuser) nicht mit der tatsächlichen sozialen oder wirtschaftlichen Realität übereinstimmt.
Wie unterscheiden sich Mode und Tracht im 19. Jahrhundert?
Tracht steht für Tradition und Beständigkeit, während Mode den schnellen Wandel und das Bedürfnis nach individueller Distinktion in der modernen Gesellschaft verkörpert.
Was bedeutet das Motiv des „Festes“ bei Gottfried Keller?
Das Fest dient als Schauplatz für das Sehen und Gesehenwerden, wo modisches Verhalten und soziale Sehnsüchte aufeinandertreffen.
Welchen Einfluss hatte Ludwig Feuerbach auf Keller?
Kellers Darstellung von Vergänglichkeit und das Verhältnis von Individuum zu Gesellschaft sind stark von Feuerbachs anthropologischer Philosophie geprägt.
- Citation du texte
- Astrid Wolffram (Auteur), 1999, Gottfried Kellers Novellen "Romeo und Julia auf dem Dorfe" und "Kleider machen Leute" im gesellschaftlichen Spiegelbild der Mode des 19. Jahrhunderts, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/86811