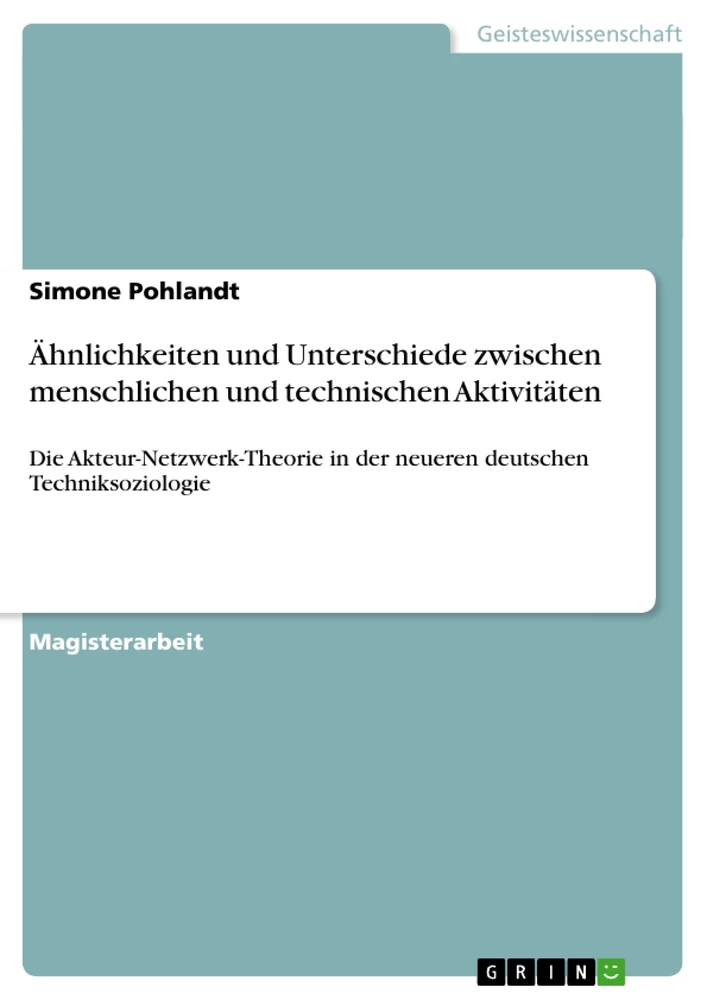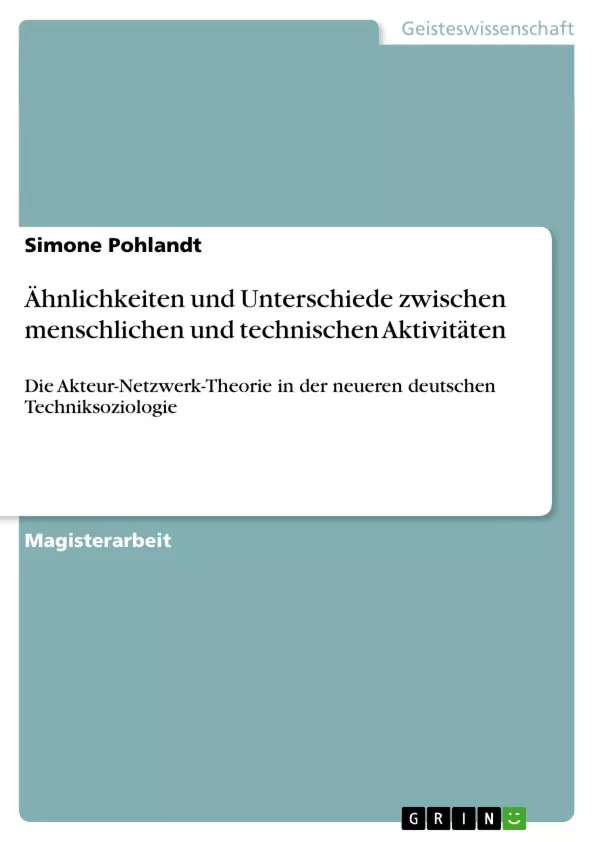Fußball spielende Roboter beim sogenannten RoboCup erregen bereits seit einiger Zeit das öffentliche Interesse. Es sind Robotertechnologien, die aus den Laboren der Forschung zur Künstlichen Intelligenz kommen. Ihre neuen Fähigkeiten bestehen darin, sich selbstständig fortzubewegen. Von diesen und anderen Entwicklungen ist die Soziologie nicht unberührt geblieben. Die neuere deutsche Techniksoziologie unternimmt schon seit längerem den Versuch, die neuen Technologien in die Sozialtheorie einzubeziehen, namentlich mit Hilfe der Akteur-Netzwerk-Theorie. Da die Roboter scheinbar immer menschlicher werden bzw. ihnen immer mehr menschliche Handlungsweisen implementiert werden, lautet die entscheidende Frage: Welche Ähnlichkeiten und welche Unterschiede bestehen (noch) zwischen menschlichen und technischen Aktivitäten? Welche Handlungseigenschaften können bei der gegenständlichen Maschinen- oder der autonom wirkenden Robotertechnik beobachtet und welche ihnen zugeschrieben werden? In Auseinandersetzung mit der ANT und ihrer holistischen Perspektive wird diesen Fragen nachgegangen und gezeigt, worin die Möglichkeiten, aber auch die Grenzen solcher Technologien bestehen und welche Ansätze es derzeit gibt, sie mit soziologischen Begriffen zu beschreiben. Selbstverständlich darf sich eine solche Fragestellung nicht davon verleiten lassen, sich ausschließlich dem Neuen zuzuwenden. Automaten oder Türschließer, d. h. Sachtechnik, die sich nicht "vom Fleck" bewegt, muss ebenso in die theoretische Perspektive eingebunden werden. An ihr reibt sich die Soziologie seit jeher und wird deshalb auch eigens thematisiert.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Das Symmetrieprinzip der Akteur-Netzwerk-Theorie
- 1.1 Die Entstehung des Symmetrieprinzips in der Wissenschaftsforschung
- 1.1.1 Die Nachahmung des Sozialkonstruktivismus in der Technikforschung
- 1.2 Das generalisierte Symmetrieprinzip
- 1.3 Netzwerkbilden als Erklärungsanspruch
- 1.3.1 Vom Öffnen und Schließen schwarzer Kisten
- 1.3.1.1 Aktanten als Agenten des Netzwerkbildens
- 1.3.1.2 Aktanten als Resultat des Netzwerkbildens
- 1.3.2 Die Dauerhaftigkeit von Netzwerken
- 1.3.1 Vom Öffnen und Schließen schwarzer Kisten
- 1.4 Das Scheitern des symmetrischen Anspruchs
- 1.4.1 Das Symmetrieprinzip in der Selbstanwendungsfalle
- 1.4.2 Eine ungerechtfertigte Symmetrisierung
- 1.5 Vom Symmetrieprinzip zu einer Soziologie der Technik?
- 1.1 Die Entstehung des Symmetrieprinzips in der Wissenschaftsforschung
- 2. Agency: Auf dem Weg zu einer Handlungstheorie der Technik
- 2.1 Die Soziologie und die Technik
- 2.1.1 Überblick über die Genese der Techniksoziologie
- 2.1.2 Überblick über techniksoziologische Theorieperspektiven
- 2.1.2.1 Technik als Materialität, Medium und in der Praxis
- 2.2 Techniksoziologie als Sozialtheorie
- 2.2.1 Technik und Gesellschaftstheorie: ein vierter Weg?
- 2.2.2 Vorbereitung: Klassifikationen zum Verhältnis von Technik und Handeln
- 2.2.2.1 Die Be- und Zuschreibungsperspektive
- 2.2.2.2 Die Beobachtungsperspektive
- 2.2.3 Erster Schritt: Das Konzept gradualisierten Handelns
- 2.2.3.1 Zuschreibung und Beobachtung als Objektivierungen
- 2.2.4 Zweiter Schritt: Technik in Aktion als distributed actions
- 2.1 Die Soziologie und die Technik
- 3. Untersuchungen zur Handlungsbeteiligung von Technik
- 3.1 Begrenzung der Handlungsfähigkeit durch Zuschreibung
- 3.2 Zuschreibung versus Beobachtung: ein Scheinproblem?
- 3.2.1 Eine kritische Begrenzung des Sozialen?
- 3.2.2 Deutungspraktiken und technische Handlungsträgerschaft
- 3.3 Eingrenzung der Handlungsfähigkeit durch den Kontext
- 3.3.1 Softwareagenten: verkörpert und körperlos
- 3.3.2 Software im engen Kontext der Teilchenphysik
- 3.4 Zwischenfazit: Stufen der Handlungsbeteiligung
- 4. Ähnlichkeiten und Unterschiede I: Sachtechnik
- 4.1 Ressourcen des Handelns als Dualität von Ressourcen und Routinen
- 4.2 Die soziale Bedeutung gegenständlicher Technik
- 4.2.1 Das soziale Verhältnis zwischen Experten und Laien
- 4.2.2 Analogie zwischen Expertenhandeln und Sachtechnik
- 4.3 Über die besondere Mitwirkung der Dinge
- 4.4 Fazit: Die Grenzen der Äquivalenz
- 5. Ähnlichkeiten und Unterschiede II: Künstliche Intelligenz
- 5.1 Die Paradigmen der klassischen KI-Forschung
- 5.2 New Artificial Intelligence und die Robotik
- 5.2.1 Grundlagen des verhaltensbasierten Ansatzes
- 5.2.1.1 Autonomie, Embodiment und Situiertheit
- 5.2.2 Koordiniertes Spiel?: Die Architektur der Fußballroboter
- 5.2.1 Grundlagen des verhaltensbasierten Ansatzes
- 5.3 Distributed Artificial Intelligence und die Sozionik
- 5.3.1 Sozionik: An der Schnittstelle von Soziologie und VKI
- 5.3.2 Innovation durch Konzepttransfer: Multiagentensysteme
- 5.3.2.1 BDI-Architektur und Offene Systeme
- 5.4 Fazit: Ähnlichkeit als Konstruktionsprinzip
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Analyse der Akteur-Netzwerk-Theorie im Kontext der neueren deutschen Techniksoziologie. Ziel ist es, die zentrale Rolle des Symmetrieprinzips in dieser Theorie zu beleuchten und die Herausforderungen zu untersuchen, die sich aus der Anwendung dieses Prinzips auf technische Aktivitäten ergeben.
- Die Entstehung und Entwicklung des Symmetrieprinzips in der Wissenschaftsforschung
- Die Anwendung des Symmetrieprinzips auf technische Aktivitäten
- Die Rolle von Handlungstheorien im Kontext der Techniksoziologie
- Die Analyse von Ähnlichkeiten und Unterschieden zwischen menschlichen und technischen Aktivitäten
- Die Erforschung der Handlungsbeteiligung von Technik in verschiedenen Kontexten
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung präsentiert die Fragestellung der Arbeit und stellt den aktuellen Forschungsstand zur Künstlichen Intelligenz dar. Sie lenkt den Fokus auf die Bedeutung von Robotern und Robotik in der heutigen Gesellschaft und setzt den thematischen Rahmen für die folgende Analyse.
- Kapitel 1: Das Symmetrieprinzip der Akteur-Netzwerk-Theorie: Dieses Kapitel behandelt das Symmetrieprinzip der Akteur-Netzwerk-Theorie und untersucht seine Entstehung und Bedeutung in der Wissenschaftsforschung. Die Autorin diskutiert die Anwendung des Prinzips auf technische Aktivitäten und beleuchtet die damit verbundenen Herausforderungen.
- Kapitel 2: Agency: Auf dem Weg zu einer Handlungstheorie der Technik: Hier geht es um die Frage, wie Technik in die Handlungstheorie integriert werden kann. Die Autorin analysiert verschiedene Perspektiven auf das Verhältnis von Technik und Handeln und entwickelt ein Konzept gradualisierten Handelns, um die Handlungsbeteiligung von Technik zu erklären.
- Kapitel 3: Untersuchungen zur Handlungsbeteiligung von Technik: Dieses Kapitel untersucht die verschiedenen Ebenen der Handlungsbeteiligung von Technik in verschiedenen Kontexten. Die Autorin analysiert die Begrenzungen der Handlungsfähigkeit von Technik durch Zuschreibung und Kontext und stellt das Konzept der „distributed actions" vor.
- Kapitel 4: Ähnlichkeiten und Unterschiede I: Sachtechnik: In diesem Kapitel geht es um die Analyse von Sachtechnik und deren Auswirkungen auf das menschliche Handeln. Die Autorin untersucht die soziale Bedeutung von Technik und diskutiert die Analogien zwischen Expertenhandeln und Sachtechnik.
- Kapitel 5: Ähnlichkeiten und Unterschiede II: Künstliche Intelligenz: Hier geht es um die Analyse von künstlicher Intelligenz und ihrer Entwicklung. Die Autorin beleuchtet die verschiedenen Paradigmen der KI-Forschung und analysiert den aktuellen Stand der Robotik und ihrer Anwendung in verschiedenen Bereichen, wie z.B. im Fußball.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beleuchtet die Kernbegriffe der Akteur-Netzwerk-Theorie, die Handlungstheorie im Kontext der Techniksoziologie, die Rolle von Technik in der Gesellschaft und die Analyse von Ähnlichkeiten und Unterschieden zwischen menschlichen und technischen Aktivitäten. Wichtige Schlüsselwörter sind Symmetrieprinzip, Handlungstheorie, Techniksoziologie, Künstliche Intelligenz, Robotik, Distributed Actions, Sachtechnik, Expertenhandeln und Laienwissen.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Symmetrieprinzip der Akteur-Netzwerk-Theorie (ANT)?
Das Symmetrieprinzip besagt, dass menschliche und nicht-menschliche Akteure (Technik, Dinge) in soziologischen Analysen gleichberechtigt behandelt werden sollten, um Netzwerke zu erklären.
Können Roboter „handeln“?
Die Arbeit untersucht, welche Handlungseigenschaften Robotern zugeschrieben werden können. Dabei wird zwischen menschlicher Intentionalität und technischer Agency (Handlungsträgerschaft) unterschieden.
Was versteht man unter „Distributed Actions“?
Dieser Begriff beschreibt Handlungen, die nicht allein von einem Menschen ausgehen, sondern durch das Zusammenwirken von Menschen und technischen Systemen (z.B. Softwareagenten) entstehen.
Welche Rolle spielt die Künstliche Intelligenz in der Techniksoziologie?
KI-Systeme fordern die Soziologie heraus, da sie zunehmend autonom wirken. Die Forschung untersucht, wie diese „Aktanten“ soziale Strukturen beeinflussen und verändern.
Was ist der Unterschied zwischen Sachtechnik und Robotik?
Sachtechnik (wie Türschließer) ist statisch und dient als Ressource, während moderne Robotik und Softwareagenten durch Embodiment und Situiertheit eine dynamischere Form der Handlungsbeteiligung zeigen.
Was ist Sozionik?
Sozionik ist ein interdisziplinäres Feld an der Schnittstelle von Soziologie und Verteilter Künstlicher Intelligenz (VKI), das soziale Konzepte auf Multiagentensysteme überträgt.
- Quote paper
- Master of Arts Simone Pohlandt (Author), 2006, Ähnlichkeiten und Unterschiede zwischen menschlichen und technischen Aktivitäten, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/86830