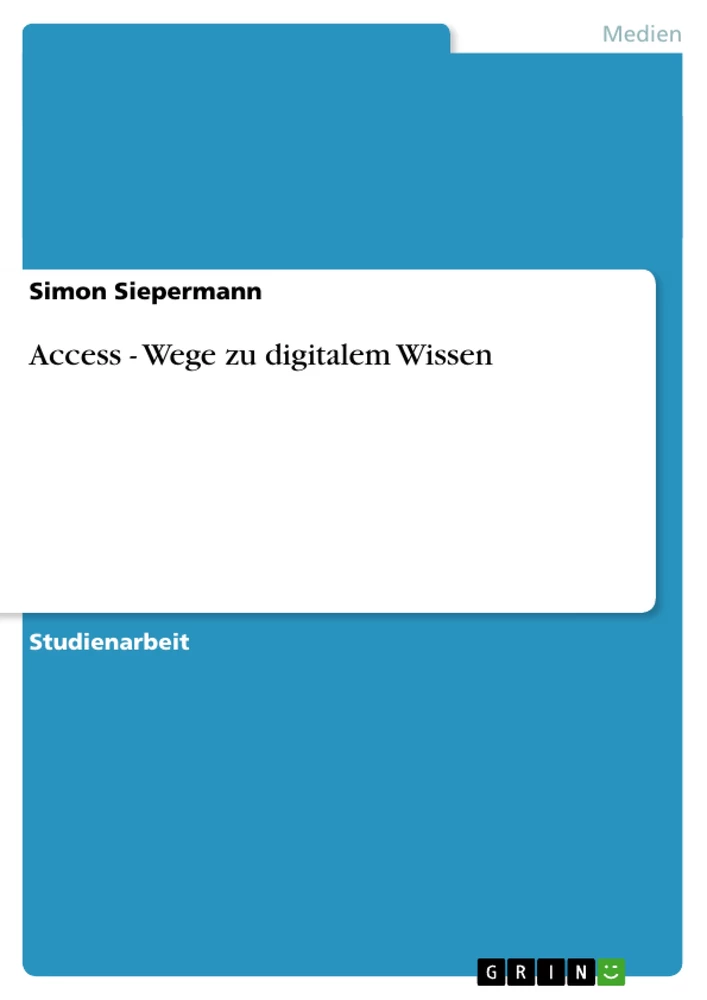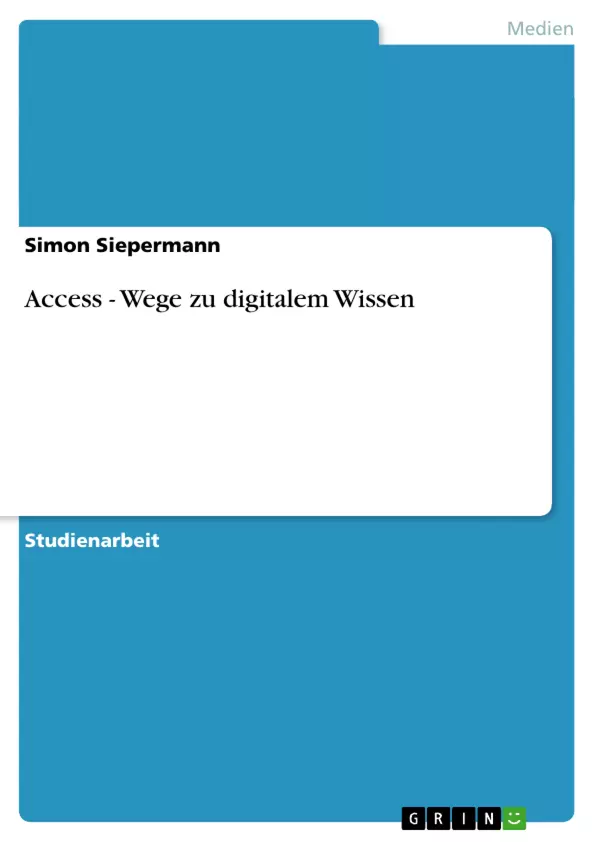In der folgenden Arbeit soll nun der gesellschaftliche Rahmen dargestellt werden, in dem sich der Wandel des Wissens vollzieht. Wissen ist seit Menschengedenken konstitutiv für den gesellschaftlichen Wandel, doch hat der Wandel von den analogen zu den digitalen Medien eine neue Wissensordnung hervor gebracht, die uns aus heutiger Sicht die nötigen Anzeichen dafür bietet, dass wir in einer so genannten Wissensgesellschaft leben. Davon ausgehend, soll die neue Wissensordnung näher beleuchtet und das Internet als Ort der Speicherung, als globale Bibliothek des Wissens diskutiert werden. Die Digitalisierung von Wissen hat zu einer schier unendlichen Vielfalt von Informationen geführt, die besondere Anforderungen an deren Nutzung stellt. Verändert haben sich auch die Eigentumsverhältnisse von Wissen, die im Wesentlichen den Zugang zu diesem restriktiv bestimmen. Die Suchmaschine bietet dabei den entscheidenden Metainformationsdienst, der den Zugriff auf die Informationsprodukte ermöglicht. Den Anbietern der entsprechenden Suchdienste kommt damit eine bedeutende Gatekeeperfunktion zwischen den Informationsanbietern und -nutzern zu, die ihnen zunehmend Macht und damit auch eine große Verantwortung verleiht. In diesem Zusammenhang sollen die Chancen und Probleme des weltweiten Zugriffs auf Wissen angeführt und besonders auf die Gefahren der Manipulation von Wissen hingewiesen werden. Im letzten Teil der Arbeit schließen sich Ansätze zur Sicherung eines freien Zugriffs auf Wissen an, wobei auf die Open Access Bewegung im wissenschaftlichen Bereich besonderes Augenmerk gelegt werden soll.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Von der Wissensgesellschaft
- Der mediale Wandel
- Eigentum von Wissen
- Die Macht der Gatekeeper
- Manipulation von Information
- Ansätze zur Sicherung des »freien Zugangs«
- »Open Access<< Bewegung
- Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit befasst sich mit dem Wandel des Wissens im Kontext der Digitalisierung. Sie analysiert die Entwicklung einer neuen Wissensordnung, die sich durch den Übergang von analogen zu digitalen Medien ergibt und charakterisiert die heutige Gesellschaft als Wissensgesellschaft.
- Die Entstehung der Wissensgesellschaft
- Die Bedeutung des Internets als globale Bibliothek des Wissens
- Die Eigentumsverhältnisse und der Zugang zu Wissen in der digitalen Welt
- Die Rolle von Suchmaschinen als Gatekeeper und die damit verbundenen Chancen und Gefahren
- Ansätze zur Sicherung eines freien Zugangs zu Wissen, insbesondere die Open Access Bewegung
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt die Kernthese der Arbeit vor: Die Digitalisierung hat zu einer tiefgreifenden Veränderung der Wissensordnung geführt, die den Übergang in eine Wissensgesellschaft markiert. Die Arbeit untersucht den Einfluss der Digitalisierung auf Wissen und diskutiert die damit verbundenen Chancen und Herausforderungen.
Von der Wissensgesellschaft
Dieses Kapitel definiert den Begriff der Wissensgesellschaft und beleuchtet seine historische Entwicklung. Es werden klassische Analysen der Wissensgesellschaft und ihre Kennzeichen vorgestellt.
Der mediale Wandel
Dieses Kapitel behandelt die Bedeutung des medialen Wandels für die Entwicklung der Wissensgesellschaft. Es stellt die Auswirkungen der Digitalisierung auf die Speicherung, Verbreitung und Nutzung von Wissen heraus.
Eigentum von Wissen
Dieses Kapitel analysiert die Eigentumsverhältnisse von Wissen in der digitalen Welt und die damit verbundenen Zugangsbeschränkungen.
Die Macht der Gatekeeper
Dieses Kapitel untersucht die Rolle von Suchmaschinen als Gatekeeper im Informationsfluss und die damit verbundene Macht und Verantwortung.
Manipulation von Information
Dieses Kapitel befasst sich mit den Gefahren der Manipulation von Informationen im digitalen Raum und den Herausforderungen, die sich daraus ergeben.
Ansätze zur Sicherung des »freien Zugangs«
Dieses Kapitel präsentiert Ansätze zur Sicherung eines freien Zugangs zu Wissen und beleuchtet die Bedeutung der Open Access Bewegung in der wissenschaftlichen Welt.
Schlüsselwörter
Die Arbeit fokussiert auf die Themen Digitalisierung, Wissensgesellschaft, Information, Zugang zu Wissen, Gatekeeper, Open Access, Manipulation von Information, Medienwandel.
Häufig gestellte Fragen
Was kennzeichnet eine „Wissensgesellschaft“?
Eine Wissensgesellschaft ist durch den Wandel von analogen zu digitalen Medien und die zentrale Bedeutung von Information als wichtigste Ressource geprägt.
Welche Macht haben Suchmaschinen als „Gatekeeper“?
Suchmaschinen bestimmen den Zugriff auf Informationen und haben dadurch eine enorme Verantwortung sowie die Macht, Wissen zu filtern oder zu manipulieren.
Was ist die „Open Access“ Bewegung?
Eine Bewegung im wissenschaftlichen Bereich, die sich für den freien und kostenlosen Zugang zu wissenschaftlichen Erkenntnissen und Publikationen einsetzt.
Wie haben sich die Eigentumsverhältnisse von Wissen verändert?
Die Digitalisierung erschwert klassische Urheberrechtsmodelle, führt aber auch zu restriktiven Zugriffsbeschränkungen durch kommerzielle Anbieter.
Welche Gefahren birgt der weltweite Zugriff auf Wissen?
Neben der Informationsflut besteht die Gefahr der gezielten Manipulation von Wissen und der Verbreitung von Falschinformationen im digitalen Raum.
Ist das Internet eine „globale Bibliothek“?
Ja, das Internet fungiert als Ort der Speicherung für nahezu unendliche Mengen an Informationen, erfordert aber neue Metainformationsdienste zur Orientierung.
- Quote paper
- Simon Siepermann (Author), 2006, Access - Wege zu digitalem Wissen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/86879