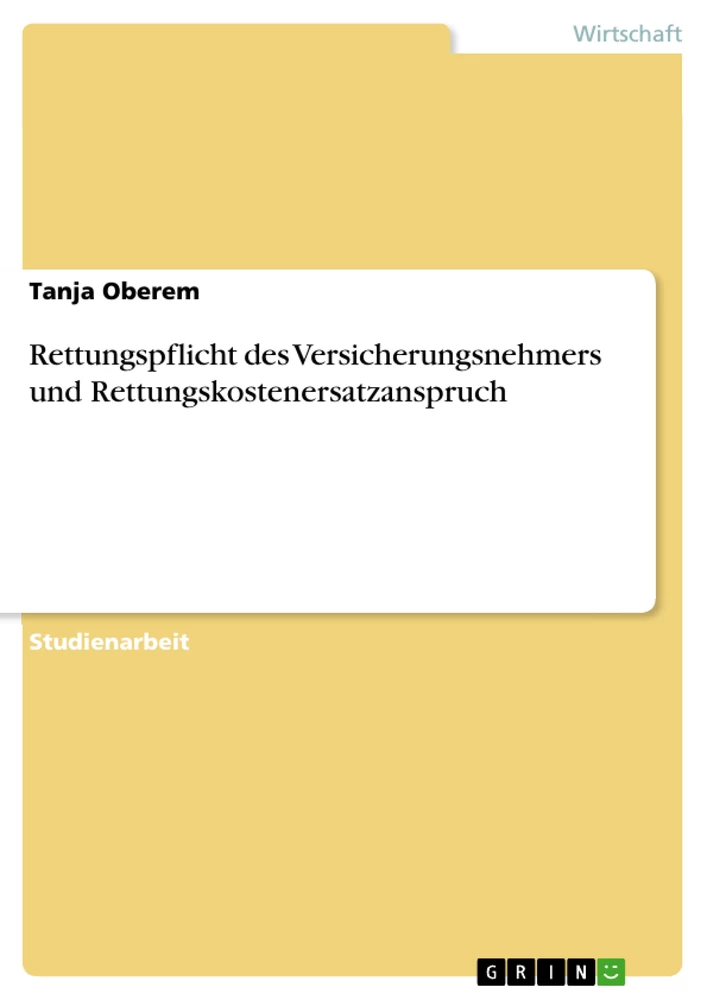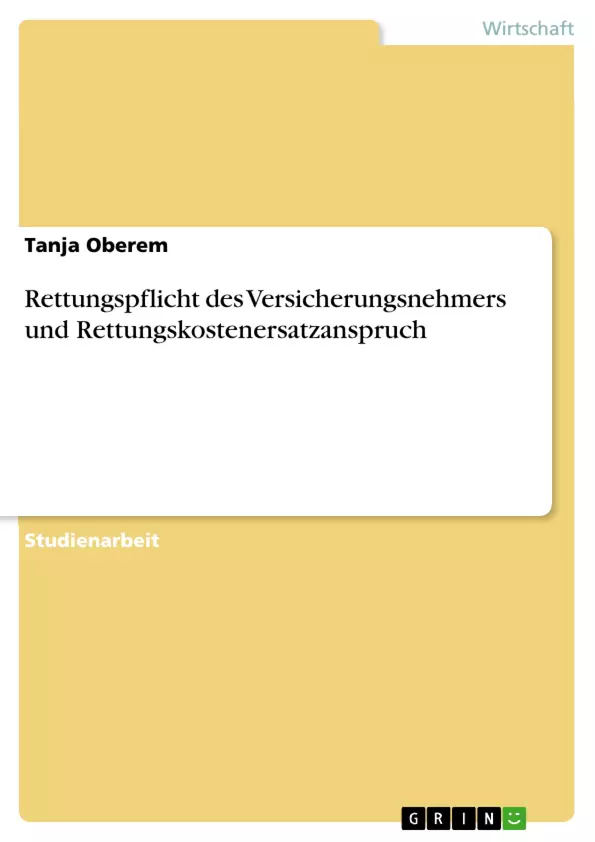Was würden die Menschen tun, gäbe es keine Versicherungen, um alles Hab und Gut gegen die Gefahren des täglichen Lebens zu schützen? Was würde jeder Einzelne tun, wenn z.B. ein Feuer ausbräche und alles zu zerstören drohte, was ihm gehört und er sich hart im Laufe der Zeit erarbeitet hat? – Er würde sicherlich versuchen, den Schaden so gering wie möglich zu halten, indem er die Feuerwehr ruft oder versucht, das Feuer mit einem Feuerlöscher zu löschen. Dennoch ist der Mensch grundsätzlich bequemer Natur in seinem Handeln und Denken. Ist das Hab und Gut rundum versichert, kann auch ein Feuer kein existenzielles Problem darstellen – zumindest in der Denkweise des Versicherten. Doch wie ergeht es dem Versicherer (VR), wenn kein Einziger mehr daran denkt, einen Schaden abzuwenden oder so gering wie möglich zu halten, wie er es auch ohne eine Versicherung tun würde? Rettungspflichten verhindern eine ausufernde Bequemlichkeit der Versicherten und bieten zugleich einen Anreiz, entsprechende Rettungsmaßnahmen zu ergreifen. Obliegenheiten bestimmen Verhaltensregeln, die der Versicherungsnehmer (VN) in gewissen Situationen zu befolgen hat. Es handelt sich also um Verhaltenspflichten, die zwar nicht eingeklagt werden können, aber bei Nichtbefolgen durchaus rechtliche Nachteile mit sich ziehen können (z.B. Leistungsfreiheit des VR). Die Rettungspflicht ist in
§ 62 VVG geregelt und beschreibt die Pflicht des VN einen Schaden abzuwenden und zu mindern. Die Rettungspflicht des VN ist Ausdruck des Grundsatzes von Treu und Glauben gemäß § 242 BGB: Vom VN wird erwartet, dass er sich so verhält, als sei er nicht versichert. Insbesondere soll der VN dazu angehalten werden, die Entwicklung des Schadens mit Blick auf die bestehende Deckung nicht sich selbst zu überlassen, sondern in jedem Fall um seine Abwendung oder Eindämmung bemüht zu sein, d. h. die sich hierfür anbietenden und zumutbaren Möglichkeiten, die generell geeignet sind, einen Schaden abzuwenden oder zu mindern, nicht unversucht zu lassen . Im Prinzip verpflichtet das VVG nach § 62 den VN zur Schadenabwendung und -minderung, sanktioniert die Missachtung der Obliegenheit mit Leistungsfreiheit und honoriert die Erfüllung der Rettungspflicht mit Kostenerstattung nach § 63 VVG. Der VN muss sich so verhalten, wie sich jeder Unversicherte und selbständig denkende Mensch verhalten würde. Die Schadenabwendungs und -minderungspflicht beginnt gemäß § 62 Abs. 1 Satz 1 VVG bei Eintritt des Versicherungsfalles.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Rettungspflicht als Obliegenheit
- Zweck
- Beginn und Dauer
- Versicherungsfall
- Vorerstreckungstheorie
- Inhalt der Rettungsobliegenheit
- Grundsatz der Selbstverantwortlichkeit
- Schadenbegriff
- Weisungen des VRS
- Definition Weisung
- Weisungserteilung
- Weisungsbefolgung
- Rechtsfolgen bei Obliegenheitsverletzung
- Vorsatz
- Grobe Fahrlässigkeit
- Beweislast
- Abdingbarkeit
- Rettungskostenersatzanspruch
- Zweck
- Voraussetzungen für die Erstattung von Rettungskosten
- Maximierung
- Rettungsmaßnahmen ohne Weisung des VR
- Rettungsmaßnahmen mit Weisung des VR
- Unterversicherung
- Selbstbeteiligung
- Teilersatz
- Vorschuss
- Fälligkeit
- Verjährung
- Beweislast
- Abdingbarkeit
- VVG-Reform
- Abwendung und Minderung des Schadens
- Aufwendungsersatz
- Sonstiges
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Rettungspflicht des Versicherungsnehmers und dem Rettungskostenersatzanspruch im Versicherungsvertragsrecht. Dabei werden die rechtlichen Grundlagen und die praktischen Auswirkungen dieser beiden Themengebiete untersucht.
- Die Rettungspflicht als Obliegenheit des Versicherungsnehmers
- Der Beginn und die Dauer der Rettungspflicht
- Der Inhalt der Rettungsobliegenheit und die Rechtsfolgen bei deren Verletzung
- Der Rettungskostenersatzanspruch des Versicherungsnehmers
- Die Auswirkungen der VVG-Reform auf die Rettungspflicht und den Rettungskostenersatzanspruch
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Einleitung erläutert die Bedeutung der Rettungspflicht im Kontext der Versicherungspraxis und stellt den Zusammenhang zwischen Bequemlichkeit und Schadensabwendung heraus.
- Das Kapitel über die Rettungspflicht als Obliegenheit beleuchtet den rechtlichen Rahmen und die praktische Bedeutung der Schadenabwendungspflicht des Versicherungsnehmers. Es wird die Unterscheidung zwischen Versicherungsfall und Vorerstreckungstheorie sowie die verschiedenen Inhalte der Rettungsobliegenheit, wie beispielsweise den Schadenbegriff und Weisungen des Versicherers, diskutiert.
- Der Abschnitt über den Rettungskostenersatzanspruch befasst sich mit den Voraussetzungen für die Erstattung von Rettungskosten durch den Versicherer. Es werden Themen wie Maximierung der Rettungskosten, Rettungsmaßnahmen mit und ohne Weisung des Versicherers, Unterversicherung und Selbstbeteiligung behandelt.
- Die VVG-Reform wird im letzten Kapitel thematisiert, wobei die Auswirkungen auf die Abwendung und Minderung des Schadens sowie den Aufwendungsersatz im Fokus stehen.
Schlüsselwörter
Rettungspflicht, Obliegenheit, Versicherungsnehmer, Versicherer, Versicherungsfall, Schadenabwendung, Schadenminderung, Rettungskosten, Rettungskostenersatzanspruch, Unterversicherung, Selbstbeteiligung, VVG-Reform, Treu und Glauben, Schadenbegriff, Weisungen.
- Citation du texte
- Tanja Oberem (Auteur), 2006, Rettungspflicht des Versicherungsnehmers und Rettungskostenersatzanspruch, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/86882