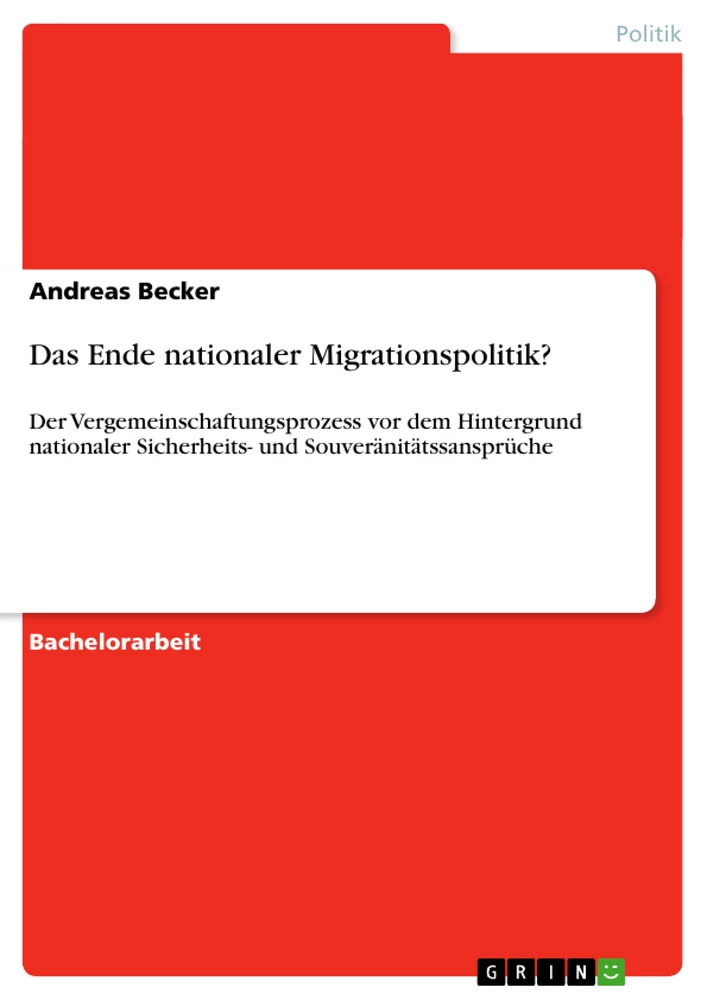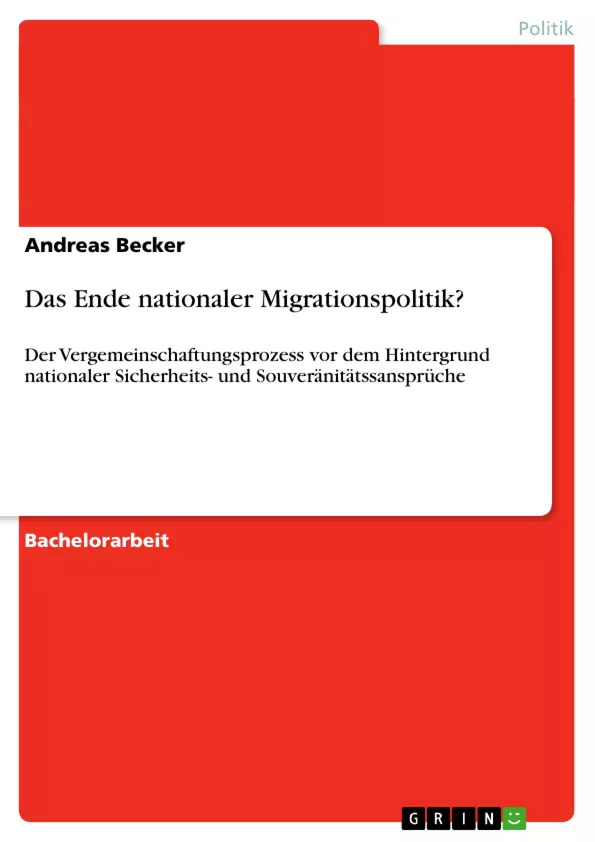Ziel dieser Bachelorarbeit ist eine umfassende Analyse, inwiefern man vor dem Hintergrund der europäischen Vergemeinschaftung vom Ende nationaler Migrationspolitik sprechen kann. Thematisiert wird in diesem Zusammenhang zum einen das Spannungsverhältnis zwischen Kooperationswillen und Souveränitätsansprüchen der Nationalstaaten. Dazu gilt es zu klären, inwieweit eine gemeinsame europäische Migrationspolitik existiert, welche denkbaren Motive einer supranationalen Kooperation zugrunde liegen könnten und warum diese Thematik, trotz „Souveränitätsgeladenheit“ (Knelangen 2001, S. 32) des Politikfeldes, vermehrt Eingang auf die europäischer Ebene findet. Zum anderen wird das angesprochene Spannungsverhältnis durch nationalstaatliche Sicherheitsbedürfnisse erweitert. Diese Dimension manifestiert sich einerseits in der Absicht der EU-Mitgliedstaaten, Kontrolle darüber auszuüben, wer auf ihr Territorium einreist und wer sich dort aufhält (Tomei 1997, S. 65), denn der Umgang mit nicht gesteuerten, grenzüberschreitenden Migrationsströmen berührt Kernbereiche der staatlichen Souveränität, wenn zu befürchten ist, dass die gesellschaftliche Ordnung oder die innere Sicherheit bedroht sein könnten. Andererseits resultiert daraus die Einsicht, dass die nationalstaatliche Sicherheit in Anbetracht der neuen Qualität der Migration im Schengen-Raum gegebenenfalls durch eine europäische Zusammenarbeit bestmöglich gewährleistet wird.
Inhaltsverzeichnis
- 1 EINLEITUNG
- 2 THEORETISCHER HINTERGRUND
- 2.1 THEORIEN ZUR EUROPÄISIERUNG
- 2.2 MIGRATIONSFORMEN
- 2.2.1 Flüchtlingsmigration
- 2.2.2 Arbeitsmigration
- 2.2.3 Irreguläre Migration
- 2.3 THEORIEN ZUR MIGRATION
- 2.3.1 Push- und Pullfaktoren
- 3 NATIONALSTAATLICHE INTERESSEN
- 3.1 SICHERHEITSRELEVANZ DER MIGRATIONSPOLITIK
- 3.2 SOUVERÄNITÄTSRELEVANZ DER MIGRATIONSPOLITIK
- 3.3 NATIONALSTAATLICHE KONTROLLE
- 4 EUROPÄISCHE UNION
- 4.1 KOOPERATIONSTHEORETISCHE AUSGANGSÜBERLEGUNGEN
- 4.2 SICHERHEITS- UND SOUVERÄNITÄTSRELEVANZ
- 4.3 EUROPÄISCHE MIGRATIONSPOLITIK VON SCHENGEN BIS ZUM HAAGER PROGRAMM
- 4.3.1 Das Schengener Abkommen
- 4.3.2 Das Schengener Durchführungsübereinkommen
- 4.3.3 Das Dubliner Abkommen
- 4.3.4 Der Maastrichter Vertrag
- 4.3.5 Der Amsterdamer Vertrag
- 4.3.6 Der Vertrag von Nizza
- 4.3.7 Das Haager Programm
- 5 DER „EUROPÄISCHE HAFTBEFEHL“ ALS SPEZIFISCHES BEISPIEL FÜR EUROPÄISCHE KOOPERATION
- 5.1 VERSTÄRKTE ZUSAMMENARBEIT
- 5.2 ERSTE PHASE: MOTIVATION
- 5.3 ZWEITE PHASE: BESCHLUSSFASSUNG
- 5.4 DRITTE PHASE: IMPLEMENTIERUNG
- 6 FAZIT
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Ziel dieser Bachelorarbeit ist die Analyse, ob vom Ende nationaler Migrationspolitik vor dem Hintergrund der europäischen Vergemeinschaftung gesprochen werden kann. Die Arbeit untersucht das Spannungsverhältnis zwischen dem Kooperationswillen und den Souveränitätsansprüchen der Nationalstaaten. Sie analysiert die Motive einer supranationalen Zusammenarbeit im Bereich der Migrationspolitik und beleuchtet, warum diese Thematik trotz der „Souveränitätsgeladenheit“ (Knelangen 2001, S. 32) zunehmend auf europäischer Ebene behandelt wird. Darüber hinaus wird das Spannungsverhältnis durch nationalstaatliche Sicherheitsbedürfnisse erweitert.
- Die Bedeutung von Sicherheits- und Souveränitätsinteressen der Nationalstaaten im Kontext der Migrationspolitik
- Die Entwicklung der europäischen Migrationspolitik von den Anfängen bis zum Haager Programm
- Die Rolle des „Europäischen Haftbefehls“ als Beispiel für die Herausforderungen und Möglichkeiten der supranationalen Zusammenarbeit
- Die Herausforderungen und Chancen der Vergemeinschaftung der Migrationspolitik
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung: Die Einleitung stellt das Thema der Bachelorarbeit vor und skizziert die zentrale Forschungsfrage: Kann man vom Ende nationaler Migrationspolitik sprechen, angesichts der europäischen Vergemeinschaftung? Sie beleuchtet das Spannungsverhältnis zwischen Kooperationswillen und Souveränitätsansprüchen der Nationalstaaten und stellt die Bedeutung der europäischen Migrationspolitik im Kontext von Sicherheits- und Souveränitätsbedenken heraus.
- Kapitel 2: Theoretischer Hintergrund: Dieses Kapitel bietet die theoretischen Grundlagen zur Erklärung von Wanderungsbewegungen und Harmonisierungsprozessen. Es werden Theorien zur Europäisierung im Bereich der Migrationspolitik erläutert und der aktuelle Forschungsstand zu Migrationsformen und deren Ursachen dargestellt.
- Kapitel 3: Nationalstaatliche Interessen: Dieses Kapitel analysiert die nationalstaatlichen Interessen im Bereich der Migrationspolitik, fokussiert auf innere Sicherheit und Souveränität. Es wird gezeigt, dass in den 1990er Jahren die Einwanderung und das Asyl- und Flüchtlingswesen als originäre Aufgaben der Nationalstaaten angesehen wurden. Die Bedeutung der zwischenstaatlichen Dimension wurde dabei zunächst unterschätzt, die sicherheits- und souveränitätsrelevanten Aspekte standen im Vordergrund.
- Kapitel 4: Europäische Union: Dieses Kapitel untersucht die Entwicklung der europäischen Zusammenarbeit im Bereich der Migrationspolitik, vom Schengener Abkommen bis zum Haager Programm. Es werden die Motive für die Kooperation und die Herausforderungen, denen sich die Mitgliedstaaten gegenüber sahen, erläutert.
- Kapitel 5: Der „Europäische Haftbefehl“: Dieses Kapitel betrachtet den „Europäischen Haftbefehl“ als Beispiel für die Herausforderungen und Chancen der supranationalen Zusammenarbeit. Es wird gezeigt, dass trotz einer prinzipiellen Einigung zur Zusammenarbeit nicht alle Probleme gelöst werden und der Prozess der Aushandlung von Richtlinien und Rahmenbeschlüssen auf europäischer Ebene aufgrund divergierender Interessen oft komplex und langwierig ist.
Schlüsselwörter
Die Arbeit behandelt zentrale Themen wie Europäisierung, Migrationspolitik, Souveränität, Sicherheit, Nationalstaat, EU, Schengener Abkommen, Haager Programm, Europäischer Haftbefehl, Kooperationsformen und Vergemeinschaftungsprozesse. Der Fokus liegt auf der Analyse der Spannungen zwischen den nationalstaatlichen Interessen und den Herausforderungen der europäischen Integration im Bereich der Migrationspolitik. Die Arbeit befasst sich außerdem mit den theoretischen Grundlagen von Migrationsformen und deren Ursachen.
Häufig gestellte Fragen
Bedeutet die EU-Vergemeinschaftung das Ende nationaler Migrationspolitik?
Die Arbeit analysiert das Spannungsverhältnis zwischen dem Souveränitätsanspruch der Nationalstaaten und der Notwendigkeit supranationaler Kooperation in der EU.
Warum geben Staaten Kompetenzen in der Migrationspolitik an die EU ab?
Ein Hauptmotiv ist die Einsicht, dass nationale Sicherheit im Schengen-Raum angesichts grenzüberschreitender Migration oft nur durch europäische Zusammenarbeit gewährleistet werden kann.
Welche Rolle spielt das Schengener Abkommen?
Es markiert den Beginn einer verstärkten Zusammenarbeit und den Abbau von Binnengrenzkontrollen, was eine gemeinsame europäische Migrationsstrategie erforderte.
Was ist der "Europäische Haftbefehl" in diesem Kontext?
Er dient als Beispiel für die Herausforderungen der Kooperation, bei der trotz prinzipieller Einigung oft komplexe Verhandlungen aufgrund divergierender nationaler Interessen nötig sind.
Welche Migrationsformen werden unterschieden?
Die Arbeit differenziert zwischen Flüchtlingsmigration, Arbeitsmigration und irregulärer Migration sowie deren jeweiligen Push- und Pullfaktoren.
- Quote paper
- BA of Arts Andreas Becker (Author), 2007, Das Ende nationaler Migrationspolitik?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/86969