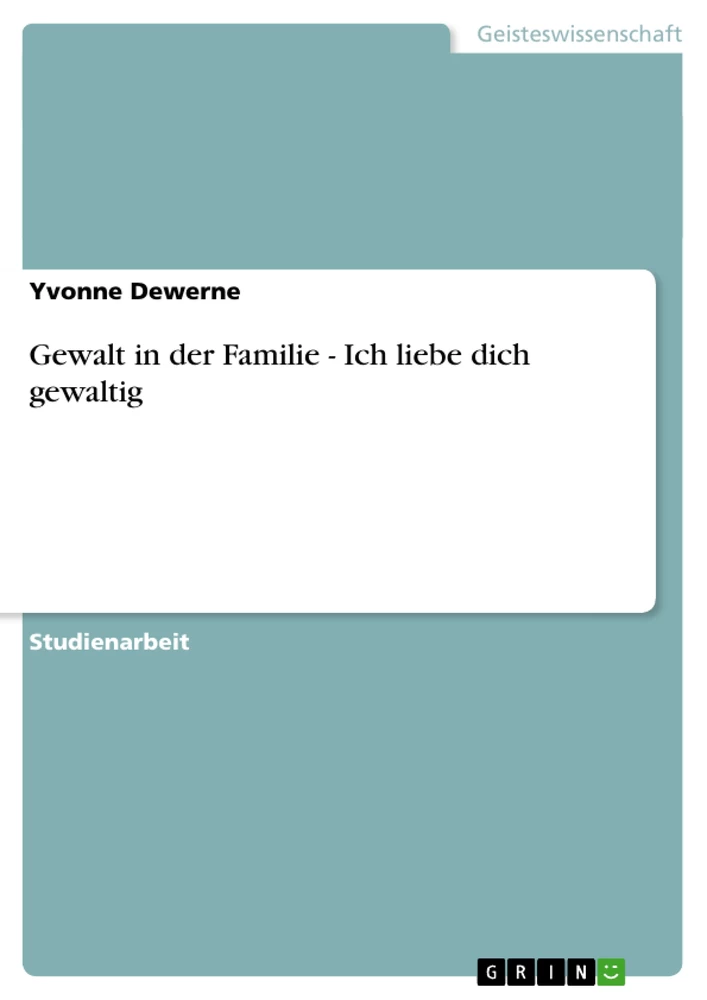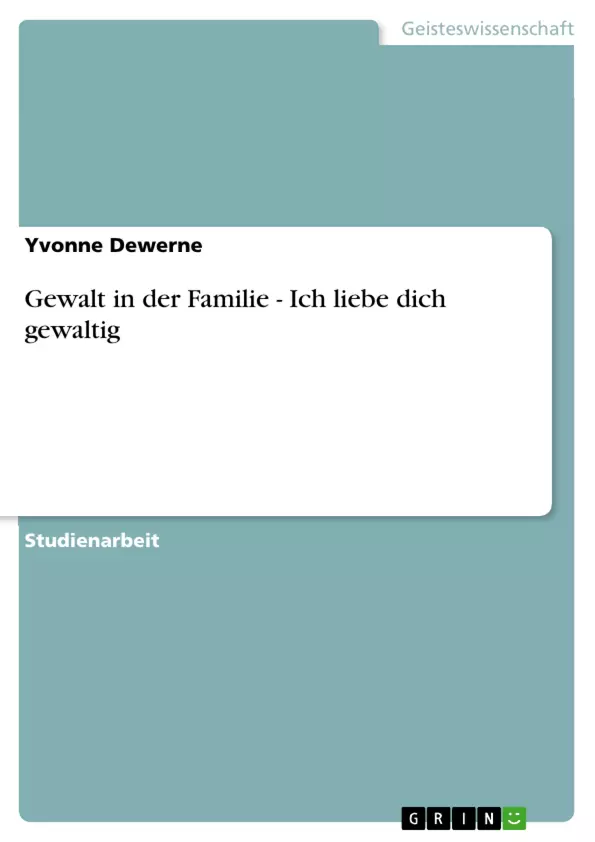Die meisten Frauen werden auf etwas hin erzogen, das eher Mythos als Realität ist: die glückliche Familie. Nicht umsonst hören Spielfilme und Romane dort auf, wo die schlimme Wahrheit beginnt.
Viele Menschen befürworten körperliche Bestrafung bei Kindern, frei nach dem Motto: ein Klaps hat noch keinem geschadet (Hirsch 1981, S. 169). Die physische Bestrafung von Kindern ist gesellschaftlich geduldet, das Schlagen von erwachsenen Frauen ist es nicht. Obwohl zwischen diesen beiden Aspekten kein Unterschied besteht. In beiden Fällen werden Menschen verletzt.
Meist beginnt die Gewalt gegen Frauen in der Familie als emotionale Überreaktion, eine Ohrfeige im Streit und danach die Beteuerung dass das niemals wieder geschehen werde. Allerdings wird kein Mensch gewalttätig geboren. Gewalt ist ein erlerntes Verhalten. Eltern und die Familie sind sowohl die wichtigsten Vorbilder als auch die primären Sozialisationsinstanzen. Von ihnen sollen Kinder soziales Verhalten und Normen lernen, wobei zwischen gesellschaftlichen akzeptierten Normen und gelebten Normen ein Unterschied besteht (Hirsch 1981, S. 180). Familie hat die Funktion, Kinder zur Selbstsicherheit und Gewissensbildung zu erziehen. Ebenfalls sollen Kinder Konfliktfähigkeit, Empathie und Frustrationstoleranz, sowie Rolledistanz lernen (Hirsch 1981, S. 60/61). Diese Arbeit setzt sich mit den Folgen auseinander, wenn Menschen diese Eigenschaften nicht gelernt haben.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Probleme bei der Erforschung von Gewalt in der Familie
- Gewalt in der Familie
- Gewalt gegen Frauen in der Partnerschaft
- Das Battered-Women-Syndrom
- Die Täter von Gewalt
- Wege aus der Gewalt
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit befasst sich mit dem Thema Gewalt in der Familie, insbesondere mit Gewalt gegen Frauen in der Partnerschaft. Sie untersucht die Probleme bei der Erforschung von Familiengewalt, analysiert die Ursachen und Folgen von Gewalt, insbesondere das Battered-Women-Syndrom, und zeigt Wege aus der Gewalt auf.
- Definition und Erforschung von Gewalt in der Familie
- Gewalt gegen Frauen in der Partnerschaft: Ursachen und Folgen
- Das Battered-Women-Syndrom: Symptome und Entstehung
- Die Rolle von Täterpersönlichkeiten und gesellschaftlichen Normen
- Möglichkeiten zur Prävention und Intervention bei Familiengewalt
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung führt in das Thema Gewalt in der Familie ein und beleuchtet die gesellschaftliche Akzeptanz von physischer Gewalt gegen Kinder im Vergleich zur gesellschaftlichen Ablehnung von Gewalt gegen Frauen. Sie stellt die These auf, dass Gewalt ein erlerntes Verhalten ist und die Familie eine entscheidende Rolle in der Sozialisation spielt.
Probleme bei der Erforschung von Gewalt in der Familie
Dieses Kapitel analysiert die Schwierigkeiten bei der Erforschung von Familiengewalt. Es diskutiert die mangelnde Einheitlichkeit in der Definition von Gewalt und Aggression, sowie die Herausforderungen bei der Datenerhebung aufgrund der Privatheit des Familienlebens.
Gewalt in der Familie
Gewalt gegen Frauen in der Partnerschaft
Dieses Unterkapitel befasst sich mit den häufigsten Formen von Gewalt gegen Frauen in der Partnerschaft, wie z.B. körperliche Übergriffe und sexuelle Gewalt. Es beleuchtet die physischen und psychischen Folgen von Gewalt und thematisiert die mangelnde juristische Regulierung von Gewalt in der Ehe.
Wege aus der Gewalt
Dieses Kapitel behandelt verschiedene Möglichkeiten, aus der Gewalt herauszufinden, wie z.B. die Inanspruchnahme von Hilfestellen, die Arbeit mit Tätergruppen und die Förderung von Gewaltpräventionsprogrammen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit dem Thema Gewalt in der Familie, insbesondere mit Gewalt gegen Frauen in der Partnerschaft, dem Battered-Women-Syndrom, Täterpersönlichkeiten, Sozialisation, gesellschaftliche Normen, Prävention und Intervention.
Häufig gestellte Fragen
Ist Gewalt in der Familie angeboren?
Nein, Gewalt ist ein erlerntes Verhalten. Die Familie fungiert als primäre Sozialisationsinstanz, in der Kinder soziales Verhalten und Normen erlernen.
Was ist das Battered-Women-Syndrom?
Es handelt sich um ein psychologisches Muster bzw. Symptombild, das bei Frauen auftritt, die über längere Zeit körperlicher und psychischer Gewalt durch ihren Partner ausgesetzt sind.
Warum wird Gewalt gegen Kinder oft anders bewertet als gegen Frauen?
Die Arbeit thematisiert, dass körperliche Bestrafung von Kindern gesellschaftlich oft noch geduldet wird ("ein Klaps hat noch keinem geschadet"), während das Schlagen von Erwachsenen abgelehnt wird, obwohl beides Menschen verletzt.
Welche Probleme gibt es bei der Erforschung von Familiengewalt?
Schwierigkeiten ergeben sich durch mangelnde einheitliche Definitionen von Gewalt sowie die Herausforderung, Daten im privaten, geschützten Raum der Familie zu erheben.
Welche Wege gibt es aus der Gewalt?
Mögliche Auswege umfassen die Inanspruchnahme von Hilfestellen, die Arbeit mit Tätergruppen sowie die Förderung von Gewaltpräventionsprogrammen.
- Citar trabajo
- Yvonne Dewerne (Autor), 2001, Gewalt in der Familie - Ich liebe dich gewaltig, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/8699