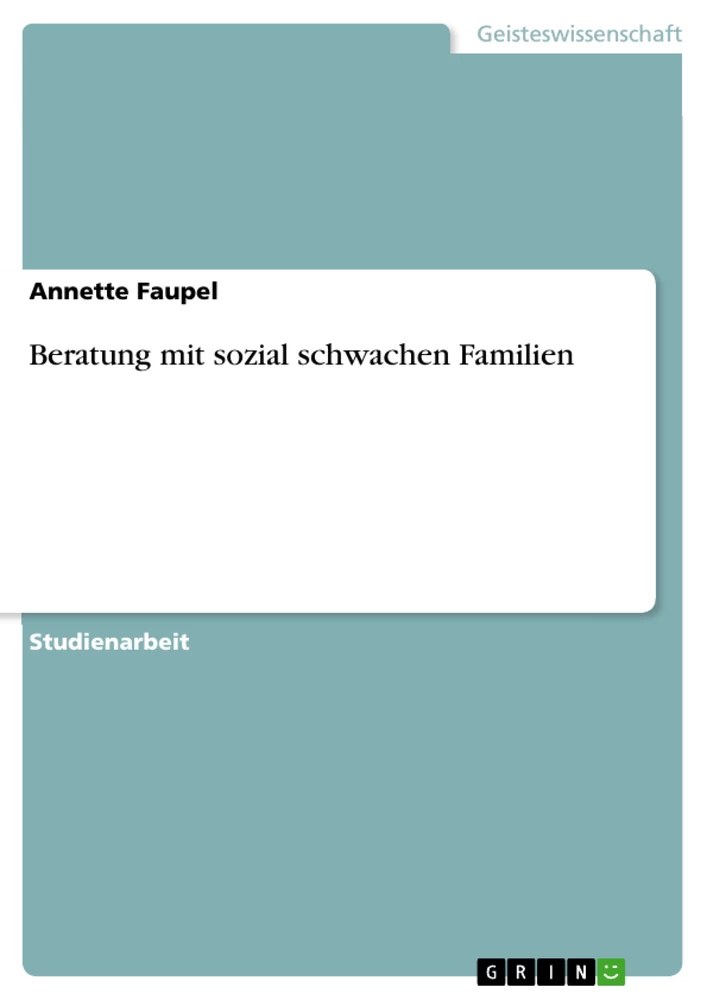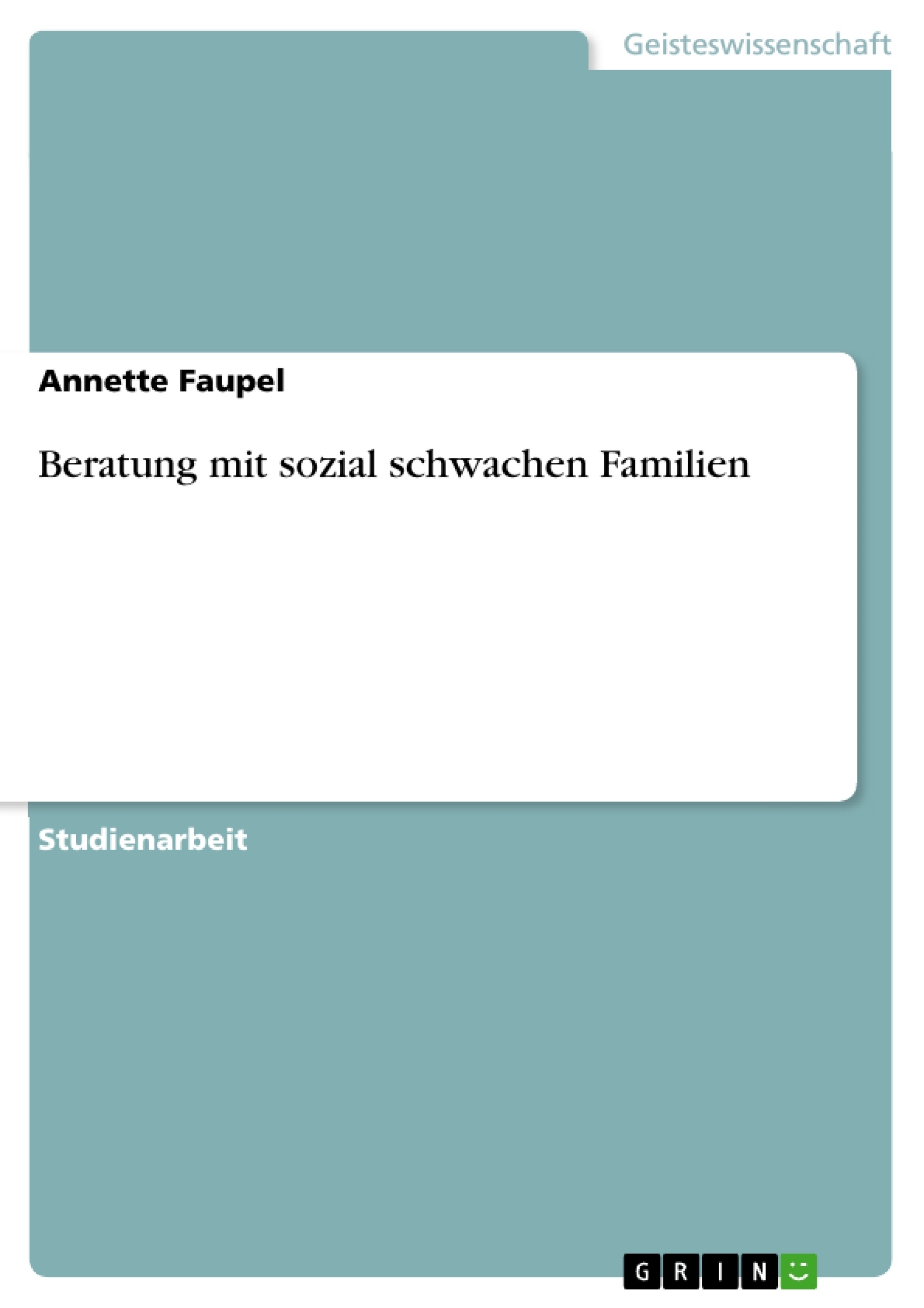Das Bild der deutschen Wohlstandsgesellschaft ist längst nicht mehr ungetrübt. Jeder weiß, dass es eine wachsende Bevölkerungsschicht gibt, die zunehmend verarmt. Trotzdem wird bei dem Begriff Armut zunächst an Entwicklungsländer gedacht, wo Menschen wirklich ums nackte Überleben kämpfen müssen. Deutschland dagegen zählt noch zu den reichsten Länder dieser Erde. Viele Menschen leben in Wohlstand, einige sind fast unvorstellbar reich. Auch der Kampf ums Überleben ist bei uns nicht gegeben. Der Staat garantiert allen seinen Einwohnern eine Sicherung des Existenzminimums, bei dem auch das psychische Existenzminimum abgesichert werden soll, nämlich die Teilhabe an soziokulturellem Leben. Wenn es also keine existenzgefährdende physische Not gibt, was bedeutet Armut in unserem Land denn dann überhaupt? Auf diese Frage werde ich in folgendem Punkt eingehen. Zunächst will ich aber auf die Zahlen zur Armut in Deutschland eingehen um das Ausmaß dieses Problems zu verdeutlichen: Die hilfebedürftigen Menschen, die die Hilfe zum Lebensunterhalt bezogen, betrug im Jahre 1975 0,7 Mio. und im Jahre 1998 schon das Dreifache, nämlich 2,5 Mio. Dabei nahm der Anteil der älteren Menschen deutlich ab, während immer mehr Kinder und Jugendliche Sozialhilfe beziehen. Ein zweiter Punkt, der die 90er Jahre prägt, ist die zunehmende Überschuldung privater Haushalte: In Westdeutschland stieg von 1989 bis 1999 die Zahl der überschuldeten Privathaushalte über 50 Prozent (von 1,2 Mio. auf 1,9 Mio). Als Hintergrund für diese Entwicklung werden vor allem ein niedriges Arbeitseinkommen und Arbeitslosigkeit angegeben.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Was bedeutet sozial schwach?
- Arbeitslosigkeit und Armut
- Isolation und Ohnmacht
- Suchtproblematik
- Welche Auswirkungen hat soziale Schwäche für Familien?
- Der Weg zum autoritären Erziehungsstil
- Der Weg zum vernachlässigenden Erziehungsstil
- Was muss beachtet werden bei Beratung von sozial schwachen Familien?
- Besonderheiten des Klientel
- Was sollte der Berater beachten?
- Wie verläuft eine Beratung mit sozial schwachen Familien?
- Die „erste Hilfe“ bei der Beratung
- Die Anfangsphase - Das Erstgespräch
- Allgemeine Informationen
- Der Beratungsauftrag
- Weitergehende Hilfen
- Mögliche Methoden bei der Familienberatung
- Der Abschluss einer Beratung
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die Beratung sozial schwacher Familien. Ziel ist es, die Herausforderungen dieser Beratungsform zu beleuchten und mögliche Vorgehensweisen zu skizzieren. Die Arbeit analysiert die komplexen Faktoren, die soziale Schwäche definieren und wie diese sich auf Familien auswirken.
- Definition von sozialer Schwäche und deren multifaktoriellen Ursachen
- Auswirkungen sozialer Schwäche auf Familienstrukturen und -dynamiken
- Besonderheiten der Beratung sozial schwacher Familien
- Methoden und Vorgehensweisen in der Familienberatung
- Herausforderungen und ethische Aspekte der Beratung
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung stellt das Thema der Hausarbeit, die Beratung sozial schwacher Familien, vor und hebt die wachsende Armut in der deutschen Gesellschaft hervor, trotz des allgemeinen Wohlstands. Sie führt in die Problematik ein und kündigt die folgenden Kapitel an, welche sich mit der Definition von sozialer Schwäche und deren Auswirkungen auf Familien sowie der Beratungspraxis befassen.
Was bedeutet sozial schwach?: Dieses Kapitel beleuchtet die komplexen Aspekte des Begriffs „sozial schwach“. Es wird betont, dass soziale Schwäche nicht eindimensional ist, sondern sich aus einem Geflecht von Arbeitslosigkeit, Armut, Isolation, Ohnmacht und möglicher Suchtproblematik zusammensetzt. Diese Faktoren bedingen sich oft gegenseitig und bilden ein komplexes Problemfeld. Der Text weist darauf hin, dass eine ganzheitliche Betrachtung in der Beratung unabdingbar ist.
Welche Auswirkungen hat soziale Schwäche auf Familien?: Dieses Kapitel beschreibt die Folgen sozialer Schwäche für betroffene Familien. Armut wird als Demütigung und Deklassierung erfahren, was zu extremen Druck auf die Eltern führt. Die daraus resultierenden Spannungen beeinflussen die Familienbeziehungen und das Familienklima negativ. Es wird der Einfluss auf den Erziehungsstil thematisiert.
Was muss beachtet werden bei Beratung von sozial schwachen Familien?: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die Besonderheiten der Beratung sozial schwacher Familien. Es betont die Notwendigkeit, das spezifische Klientel und die damit verbundenen Herausforderungen zu berücksichtigen. Der Text hebt die Bedeutung einer ganzheitlichen Betrachtung und eines sensitiven Umgangs mit den Klienten hervor.
Wie verläuft eine Beratung mit sozial schwachen Familien?: Dieses Kapitel beschreibt den Ablauf einer Beratung, beginnend mit der „ersten Hilfe“ bis zum Abschluss. Es beleuchtet verschiedene Phasen des Beratungsprozesses, wie das Erstgespräch, die Klärung des Beratungsauftrags und die Auswahl geeigneter Methoden. Die Notwendigkeit weiterer Hilfen und der sensible Umgang mit den Klienten werden hervorgehoben.
Schlüsselwörter
Soziale Schwäche, Armut, Arbeitslosigkeit, Isolation, Ohnmacht, Sucht, Familienberatung, Erziehungsstil, Multiproblemfamilien, Beratungsprozess, soziale Ressourcen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Hausarbeit: Beratung sozial schwacher Familien
Was ist der Hauptfokus dieser Hausarbeit?
Die Hausarbeit konzentriert sich auf die Beratung sozial schwacher Familien. Sie untersucht die Herausforderungen dieser Beratungsform, skizziert mögliche Vorgehensweisen und analysiert die komplexen Faktoren, die soziale Schwäche definieren und deren Auswirkungen auf Familien.
Was versteht die Hausarbeit unter „sozial schwach“?
Soziale Schwäche wird nicht eindimensional definiert, sondern als ein Geflecht aus Arbeitslosigkeit, Armut, Isolation, Ohnmacht und möglicher Suchtproblematik verstanden. Diese Faktoren beeinflussen sich gegenseitig und erfordern eine ganzheitliche Betrachtungsweise in der Beratung.
Welche Auswirkungen hat soziale Schwäche auf Familien?
Soziale Schwäche führt zu extremen Druck auf die Eltern, beeinflusst die Familienbeziehungen und das Familienklima negativ. Armut wird als Demütigung und Deklassierung erlebt, was den Erziehungsstil stark beeinflusst und zu autoritären oder vernachlässigenden Erziehungsmustern führen kann.
Welche Besonderheiten sind bei der Beratung sozial schwacher Familien zu beachten?
Die Beratung sozial schwacher Familien erfordert ein besonderes Augenmerk auf das spezifische Klientel und seine Herausforderungen. Eine ganzheitliche Betrachtungsweise und ein sensibler Umgang mit den Klienten sind unerlässlich. Der Berater muss die komplexen Lebensumstände der Familien verstehen und berücksichtigen.
Wie verläuft eine Beratung mit sozial schwachen Familien?
Der Beratungsprozess umfasst verschiedene Phasen, beginnend mit der „ersten Hilfe“ und dem Erstgespräch (Klärung des Beratungsauftrags, Informationen, Weitergehende Hilfen). Es werden geeignete Methoden ausgewählt, und der Prozess endet mit einem Abschlussgespräch. Der sensible Umgang mit den Klienten und die Berücksichtigung weiterer benötigter Hilfen sind essentiell.
Welche Methoden werden in der Familienberatung eingesetzt (laut Hausarbeit)?
Die Hausarbeit erwähnt verschiedene Methoden, die im Beratungsprozess eingesetzt werden können, benennt sie aber nicht explizit. Der Fokus liegt auf dem Ablauf und den Herausforderungen der Beratung, nicht auf der detaillierten Beschreibung spezifischer Methoden.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Hausarbeit?
Schlüsselwörter sind: Soziale Schwäche, Armut, Arbeitslosigkeit, Isolation, Ohnmacht, Sucht, Familienberatung, Erziehungsstil, Multiproblemfamilien, Beratungsprozess, soziale Ressourcen.
Welche Kapitel umfasst die Hausarbeit?
Die Hausarbeit beinhaltet eine Einleitung, Kapitel zu dem Verständnis von sozialer Schwäche und deren Auswirkungen auf Familien, Kapitel zur Besonderheiten der Beratung sozial schwacher Familien, ein Kapitel zum Ablauf einer Beratung und einen Schluss. Jedes Kapitel wird in der Zusammenfassung der Kapitel kurz beschrieben.
Welche Zielsetzung verfolgt die Hausarbeit?
Die Hausarbeit hat zum Ziel, die Herausforderungen der Beratung sozial schwacher Familien zu beleuchten und mögliche Vorgehensweisen zu skizzieren. Sie analysiert die Definition von sozialer Schwäche und deren Auswirkungen auf Familienstrukturen und -dynamiken.
- Quote paper
- Annette Faupel (Author), 2006, Beratung mit sozial schwachen Familien, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/87068