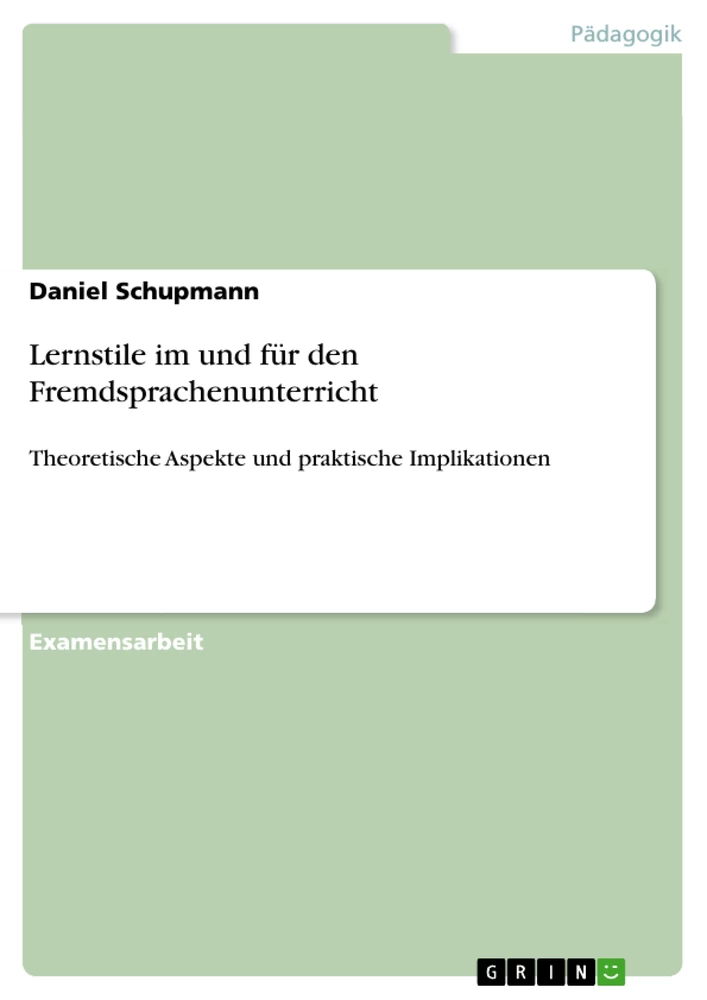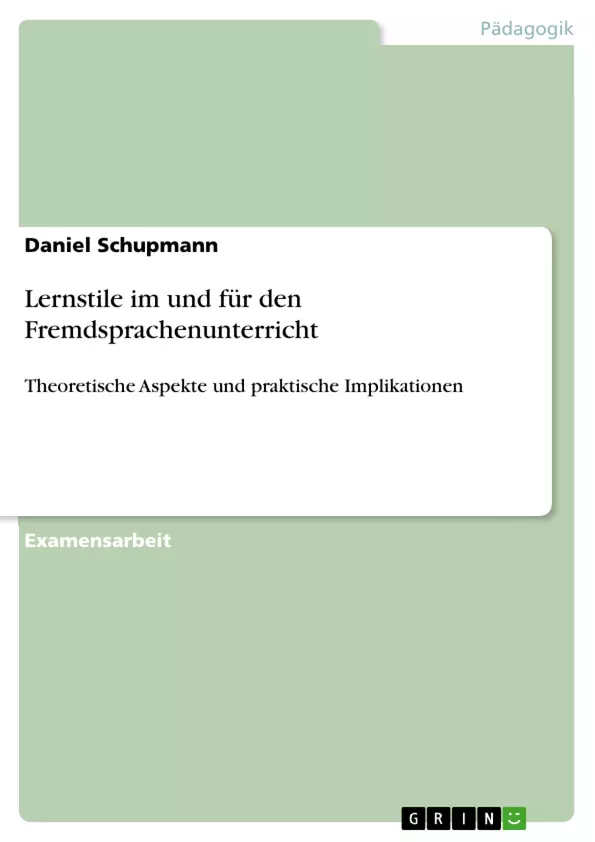Im Laufe der letzten Jahrzehnte hat das Wissenschaftsgebiet der Lernpsychologie zahlreiche Faktoren ausgemacht, die die mitunter stark variierenden Resultate menschlichen Lernens beeinflussen. Als Auslöser für ein gesteigertes Interesse an den Bedingungen von Denk- und Verstehensprozessen gilt dabei der Paradigmenwechsel vom Behaviorismus zum Kognitivismus, der so genannten Kognitiven Wende.
Während sich manche Wissenschaftler/innen auf die Betrachtung von Einflussgrößen wie beispielsweise die Intelligenz, Motivation oder soziokulturelle Hintergründe konzentrieren, hat sich eine Forschungsrichtung entwickelt, die sich der Charakteristik unterschiedlicher Lernzugänge widmet, d. h. dem Wie des Lernens. Im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen diesbezüglich verschiedene Modalitäten der Aneignung, Strukturierung und des Abrufs neuer Informationen – Komponenten des Lernens, deren je spezifische Ausprägungen unter dem Begriff des individuellen Lernstils subsumiert werden.
Darüber hinaus werden in zahlreichen Publikationen auch sozial-affektive Beschreibungsgrößen als lernstilbestimmend angesehen. Eine solche weite Definition vertritt z. B. Grotjahn (1998:11). Er sieht Lernstile
„im Sinne von intraindividuell relativ stabilen, zunächst situations- und aufgabenunspezifischen Präferenzen (Dispositionen, Gewohnheiten) von Lernern sowohl bei der Verarbeitung (Aufnahme, Strukturierung, Speicherung ...) von Informationen als auch bei der sozialen Interaktion.“
Das Postulat einer Existenz stilgeprägter Lernwege ruft Vertreter verschiedenster Interessensgemeinschaften auf den Plan, die hierin ein theoretisches Konstrukt besonderer Relevanz vermuten. Insbesondere im Bereich der Pädagogik bzw. der mit ihr verkoppelten Fachdidaktiken hat sich ein mittlerweile breiter Diskurs entfaltet, dessen inhaltlicher Schwerpunkt auf der Besprechung lehrpraktischer Auswirkungen liegt.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Begriffsklärung
- 2.1 Kognitiver Stil oder Lernstil?
- 2.2 Lernstrategien
- 2.3 Lern(er)typen
- 2.4 Stile in Abgrenzung zu Fähigkeiten
- 3 Stand der Lernstilforschung und ausgewählte Vertreter einflussreicher Konzepte sowie deren Relevanz für die Fremdsprachenforschung
- 3.1 Lernstile – Versuch einer Kategorisierung
- 3.2 Ausgewählte Vertreter einflussreicher Lernstilkonzepte
- 3.2.1 Lernstile sind weitestgehend genetisch bedingte, schwer beeinflussbare Persönlichkeitsmerkmale
- 3.2.1.1 Gregorc
- 3.2.1.2 Dunn & Dunn
- 3.2.2 Lernstile beruhen auf den kognitiven Strukturen eines Individuums
- 3.2.2.1 Witkin
- 3.2.2.2 Riding
- 3.2.3 Lernstile sind Teil eines relativ stabilen Persönlichkeitstypus - Der Myers-Briggs-Typenindikator (MBTI)
- 3.2.4 Lernstile sind flexible, aber dennoch solide Lernvorlieben – Kolbs Experiential Learning Theory
- 3.2.5 Lernorientierungen, -einstellungen und -strategien als konstitutive Größen von Lernstilen am Beispiel Entwistles
- 3.2.6 Weitere Einflussgrößen im Fokus der Fremdsprachendidaktik
- 3.2.6.1 Ambiguitätstoleranz/-intoleranz
- 3.2.6.2 Induktion/Deduktion
- 3.3 Abschließende Bewertung der stilbezogenen Fremdsprachenforschung
- 4 Unterrichtspraktische Konsequenzen
- 4.1 Identifikation von Lernstilen
- 4.1.1 Konstruktinhärente Limitationen
- 4.1.2 Fragebögen zur Erhebung bevorzugter Lernstrategien am Beispiel des Strategy Inventory for Language Learning
- 4.1.3 Lernertagebücher und Sprachlernerinnerungen
- 4.1.4 Lautes Denken
- 4.1.5 Weitere Alternativen zum Zwecke der Thematisierung unterschiedlicher Lernstile
- 4.2 Matching oder Stretching?
- 4.3 Lerninhalte vor dem Hintergrund eines stilorientierten Lehrstils
- 4.3.1 Integrative Berücksichtigung stilrelevanter Faktoren
- 4.3.2 Gezieltes Strategietraining
- 5 Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Relevanz von Lernstilen im Fremdsprachenunterricht. Ziel ist es, theoretische Konzepte zu Lernstilen zu analysieren und deren praktische Implikationen für den Unterricht aufzuzeigen. Dabei wird der Fokus auf die Identifikation von Lernstilen und die Frage gelegt, wie diese im Unterricht berücksichtigt werden können.
- Definition und Abgrenzung von Lernstilen
- Überblick über verschiedene Lernstilmodelle und deren Relevanz für den Fremdsprachenunterricht
- Methoden zur Identifikation von Lernstilen
- Unterrichtspraktische Konsequenzen der Berücksichtigung von Lernstilen
- Diskussion von "Matching" und "Stretching"-Ansätzen im Umgang mit Lernstilen
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Lernstile im Fremdsprachenunterricht ein. Sie beschreibt den Paradigmenwechsel vom Behaviorismus zum Kognitivismus und die daraus resultierende Fokussierung auf individuelle Lernzugänge. Es wird die Bedeutung der Berücksichtigung von Lernstilen im Unterricht hervorgehoben und die Forschungslücke bezüglich des Verhältnisses von allgemeinen Lernpräferenzen und spezifischen Fremdsprachenlernpräferenzen benannt. Die Arbeit skizziert ihre Zielsetzung, die Klärung stilprägender Merkmale für die Verarbeitung fremdsprachlicher Informationen und die Ableitung unterrichtspraktischer Konsequenzen. Die vorwiegend englischsprachige Literatur zum Thema wird erwähnt.
2 Begriffsklärung: Dieses Kapitel klärt grundlegende Begriffe und wichtige Differenzierungen im Kontext von Lernstilen. Es werden die Begriffe "kognitiver Stil" und "Lernstil" abgegrenzt, Lernstrategien und -typen definiert und Lernstile von Fähigkeiten unterschieden. Das Kapitel legt somit das terminologische Fundament für die weitere Arbeit.
3 Stand der Lernstilforschung und ausgewählte Vertreter einflussreicher Konzepte sowie deren Relevanz für die Fremdsprachenforschung: Kapitel 3 bietet einen Überblick über die Lernstilforschung. Es präsentiert eine Kategorisierung von Lernstilkonzepten und stellt einflussreiche Vertreter vor, die Lernstile als genetisch bedingt, auf kognitiven Strukturen basierend, Teil eines Persönlichkeitstypus oder als flexible Lernvorlieben betrachten. Die Konzepte von Gregorc, Dunn & Dunn, Witkin, Riding, Kolb und Entwistle werden detailliert beschrieben und ihre Relevanz für den Fremdsprachenunterricht diskutiert. Schließlich wird eine abschließende Bewertung der stilbezogenen Fremdsprachenforschung gegeben.
4 Unterrichtspraktische Konsequenzen: Dieses Kapitel widmet sich den praktischen Implikationen der Lernstilforschung für den Unterricht. Es diskutiert verschiedene Methoden zur Identifikation von Lernstilen, einschließlich Fragebögen, Lernertagebüchern, lauten Denken und weiteren Alternativen. Zentral ist die Frage nach "Matching" (Anpassung des Unterrichts an Lernstile) und "Stretching" (Förderung der Entwicklung von Lernstrategien). Schließlich werden Möglichkeiten zur Integration stilrelevanter Faktoren in den Unterricht und gezieltes Strategietraining behandelt.
Schlüsselwörter
Lernstile, Fremdsprachenunterricht, Sprachlernstrategien, Kognitive Stile, Lerntypen, Fremdsprachenforschung, Unterrichtsgestaltung, Strategietraining, Matching, Stretching, Gregorc, Dunn & Dunn, Witkin, Riding, Kolb, Entwistle.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Relevanz von Lernstilen im Fremdsprachenunterricht
Was ist der Hauptfokus dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Relevanz von Lernstilen im Fremdsprachenunterricht. Das Ziel ist die Analyse theoretischer Konzepte zu Lernstilen und die Darstellung ihrer praktischen Implikationen für den Unterricht. Im Mittelpunkt stehen die Identifikation von Lernstilen und deren Berücksichtigung im Unterricht.
Welche Themen werden im Einzelnen behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Definition und Abgrenzung von Lernstilen, Überblick über verschiedene Lernstilmodelle und deren Relevanz für den Fremdsprachenunterricht, Methoden zur Identifikation von Lernstilen, unterrichtspraktische Konsequenzen der Berücksichtigung von Lernstilen und eine Diskussion von "Matching" und "Stretching"-Ansätzen im Umgang mit Lernstilen.
Welche Lernstilmodelle werden vorgestellt?
Die Arbeit präsentiert und diskutiert verschiedene einflussreiche Lernstilkonzepte, darunter die Modelle von Gregorc, Dunn & Dunn, Witkin, Riding, Kolb und Entwistle. Diese Modelle betrachten Lernstile unter verschiedenen Perspektiven: als genetisch bedingt, auf kognitiven Strukturen basierend, als Teil eines Persönlichkeitstypus oder als flexible Lernvorlieben.
Wie können Lernstile im Unterricht identifiziert werden?
Die Arbeit beschreibt verschiedene Methoden zur Identifikation von Lernstilen, wie z.B. Fragebögen (am Beispiel des Strategy Inventory for Language Learning), Lernertagebücher, lautes Denken und weitere Alternativen. Die Limitationen der Konstrukte werden dabei ebenso berücksichtigt.
Was bedeuten "Matching" und "Stretching" im Kontext von Lernstilen?
„Matching“ bezeichnet die Anpassung des Unterrichts an die identifizierten Lernstile der Schüler. „Stretching“ hingegen beschreibt die Förderung der Entwicklung von Lernstrategien, um die Lernenden über ihre bevorzugten Stile hinaus zu fordern und zu fördern.
Welche praktischen Konsequenzen ergeben sich aus der Berücksichtigung von Lernstilen?
Die Arbeit beschreibt Möglichkeiten zur integrativen Berücksichtigung stilrelevanter Faktoren im Unterricht und zeigt Strategien für gezieltes Strategietraining auf. Sie betont die Bedeutung einer differenzierten Unterrichtsgestaltung, die auf die individuellen Lernbedürfnisse der Schüler eingeht.
Welche Kapitel beinhaltet die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Begriffsklärung, Stand der Lernstilforschung und ausgewählte Vertreter einflussreicher Konzepte sowie deren Relevanz für die Fremdsprachenforschung, Unterrichtspraktische Konsequenzen und Schlussbetrachtung. Jedes Kapitel wird in der Zusammenfassung der Kapitel detailliert beschrieben.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für diese Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Lernstile, Fremdsprachenunterricht, Sprachlernstrategien, Kognitive Stile, Lerntypen, Fremdsprachenforschung, Unterrichtsgestaltung, Strategietraining, Matching, Stretching, Gregorc, Dunn & Dunn, Witkin, Riding, Kolb, Entwistle.
Welche Forschungslücke wird angesprochen?
Die Arbeit benennt eine Forschungslücke bezüglich des Verhältnisses von allgemeinen Lernpräferenzen und spezifischen Fremdsprachenlernpräferenzen.
Welche Literatur wird hauptsächlich verwendet?
Die Arbeit bezieht sich hauptsächlich auf englischsprachige Literatur zum Thema Lernstile.
- Quote paper
- Daniel Schupmann (Author), 2007, Lernstile im und für den Fremdsprachenunterricht, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/87082