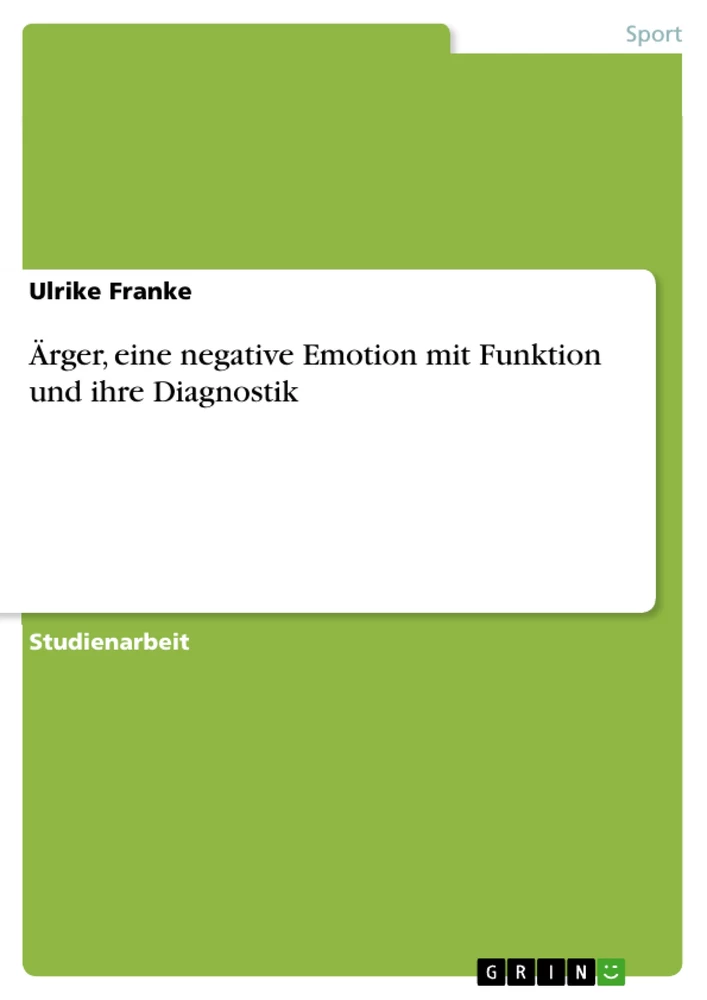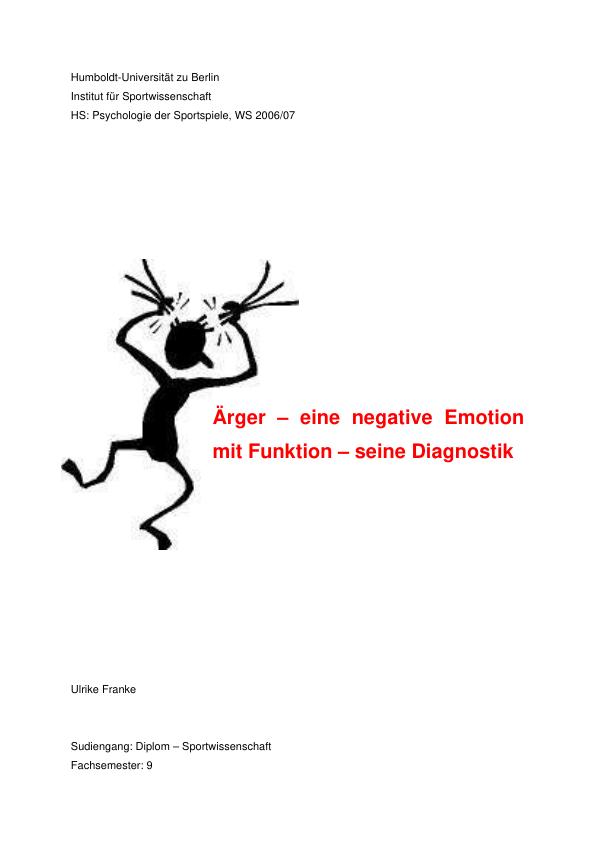1 Mensch ärger dich nicht ?!
Man regt sich auf, man ärgert sich - bekommt gesagt, man solle sich zügeln, denn sonst drohe bald ein Herzinfarkt. Dieser, oftmals nur so dahin gesagten Floskel, geht die Wissenschaft jedoch schon länger nach. Seit nunmehr 65 Jahren wird in psychosomatischer Forschungsliteratur intensiv die Beziehung zwischen negativen Emotionen und gesundheitlichen Problemen diskutiert.
Es stellt sich also die Frage ob Ärger zu den negativen Emotionen gehört und die Gesundheit ebenso beeinflusst. Diese und die Frage nach den Funktionen des Ärgers soll in vorliegender Seminararbeit geklärt werden. Ein weiteres Problemfeld ist die Diagnostik des Ärgers, welche sich, aufgrund gesellschaftlicher Zwänge und Kontrollsucht, nicht einfach gestaltet.
2 Ärger – eine Frage der Definition und seine Entstehung
Ärger eine Emotion, welche kaum aus dem Alltag wegzudenken ist. Selbst ein psychologischer Laie weiß sich unter diesem Begriff etwas vorzustellen. Ärger ist eine fundamentale Emotion, jedem Kulturkreis bekannt und macht auch vor dem Tierreich nicht halt.
Die Korrelation zum negativen Emotionshaushalt eines Tiers, wird bei Plutchiks (1980) Auffassung von Ärger deutlich. Nach ihm ist Ärger eine primäre, prototypische Emotion, welcher er eine evolutionäre Geschichte zuschreibt. Alle Emotionen ermöglichen dem Organismus die Bewältigung überlebensrelevanter Situationen. Diese tritt im Regelfall bei der Emotion Ärger in einer bestimmten Reihenfolge auf. Zunächst nimmt der Organismus einen Reiz wahr und interpretiert ihn als Hindernis oder Feind. Um dieses Hindernis oder gar den Feind zu beseitigen, wird eine negative Emotion wie Ärger oder Wut ausgelöst. Resultat daraus ist eine destruktive Handlung.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Mensch ärger dich nicht ?!
- 2 Ärger - eine Frage der Definition und seine Entstehung
- 3 Die funktionale Bedeutung des Ärgers
- 4 Die Diagnostik von Ärger
- 4.1 Fragebogen zu Ärger und Ärgerausdruck
- 4.2 Interviewgestützte Verfahren
- 4.3 Probleme der Ärgerdiagnostik
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit befasst sich mit der Emotion Ärger, ihrer Entstehung, ihren Funktionen und ihrer Diagnostik. Die Arbeit beleuchtet die Frage, ob Ärger zu den negativen Emotionen gehört und wie er sich auf die Gesundheit auswirken kann. Darüber hinaus wird untersucht, welche Schwierigkeiten bei der Diagnostik von Ärger aufgrund gesellschaftlicher Zwänge und Kontrollsucht bestehen.
- Definition und Entstehung von Ärger
- Funktionale Bedeutung von Ärger, inklusive adaptiver und maladaptiver Aspekte
- Diagnostik von Ärger mittels Fragebögen und Interviewverfahren
- Probleme der Ärgerdiagnostik
- Beziehung zwischen Ärger und Gesundheit
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 führt in das Thema Ärger ein und stellt die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit der Beziehung zwischen negativen Emotionen und Gesundheitsproblemen in den Kontext. Kapitel 2 beleuchtet die Definition von Ärger und seine Entstehung. Es werden verschiedene theoretische Ansätze von Plutchik, Averill und Mees vorgestellt, die die psychologische und soziale Komponente von Ärger beleuchten. Kapitel 3 beschäftigt sich mit der funktionalen Bedeutung von Ärger und thematisiert sowohl adaptive als auch maladaptive Funktionen. Es werden verschiedene Theorien von Berkowitz und Bandura vorgestellt, die die Rolle von Ärger bei Aggression und Energiebereitstellung beleuchten. Kapitel 4 behandelt die Diagnostik von Ärger und stellt verschiedene Fragebögen (STAXI, MAI, Ärgerverarbeitungsskala, JAS, FPI) und Interviewverfahren vor. Zudem werden die Probleme der Ärgerdiagnostik aufgrund von gesellschaftlichen Zwängen und Kontrollsucht thematisiert.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Emotion Ärger, ihre Entstehung, Funktionen und Diagnostik. Wichtige Themen sind: Ärgerdefinition, Emotionstheorien, adaptive und maladaptive Funktionen von Ärger, Aggression, Energiebereitstellung, Fragebögen und Interviewverfahren, Probleme der Ärgerdiagnostik, gesellschaftliche Zwänge und Kontrollsucht, Gesundheit und negative Emotionen.
Häufig gestellte Fragen
Ist Ärger grundsätzlich eine negative Emotion?
Ärger wird oft als negativ empfunden, hat aber laut Plutchik eine evolutionäre Funktion, um Hindernisse oder Feinde zu beseitigen und Überleben zu sichern.
Welche gesundheitlichen Folgen kann unterdrückter Ärger haben?
Die psychosomatische Forschung diskutiert seit Jahrzehnten den Zusammenhang zwischen chronischem Ärger und gesundheitlichen Problemen wie Herzinfarkten.
Was ist der Unterschied zwischen adaptiven und maladaptiven Funktionen von Ärger?
Adaptive Funktionen helfen bei der Problembewältigung und Energiebereitstellung, während maladaptive Funktionen zu destruktiver Aggression und sozialer Isolation führen.
Welche Fragebögen werden zur Diagnostik von Ärger eingesetzt?
Eingesetzt werden unter anderem das STAXI (State-Trait-Ärgerausdrucks-Inventar), der MAI und die Ärgerverarbeitungsskala.
Warum ist die Diagnostik von Ärger schwierig?
Gesellschaftliche Zwänge zur Emotionskontrolle führen oft dazu, dass Probanden ihren tatsächlichen Ärger in Befragungen unterdrücken oder verharmlosen.
Was besagt die Theorie von Averill über Ärger?
Averill sieht Ärger als eine soziale Rolle, die bestimmten Regeln unterliegt und oft dazu dient, soziale Gerechtigkeit oder Normen wiederherzustellen.
- Citation du texte
- Ulrike Franke (Auteur), 2007, Ärger, eine negative Emotion mit Funktion und ihre Diagnostik, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/87172