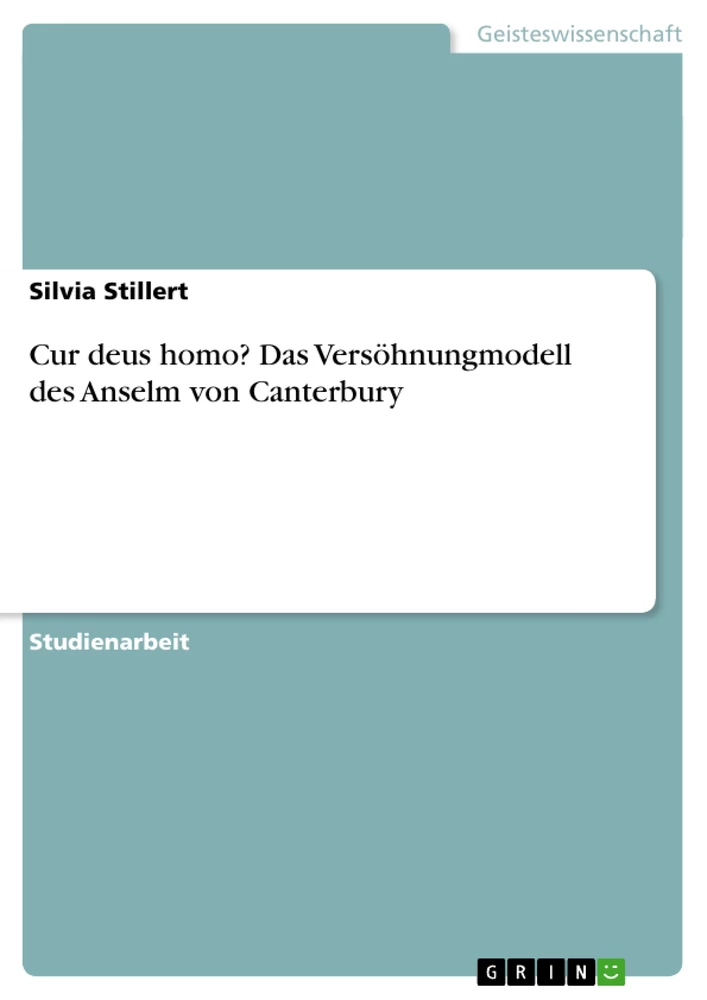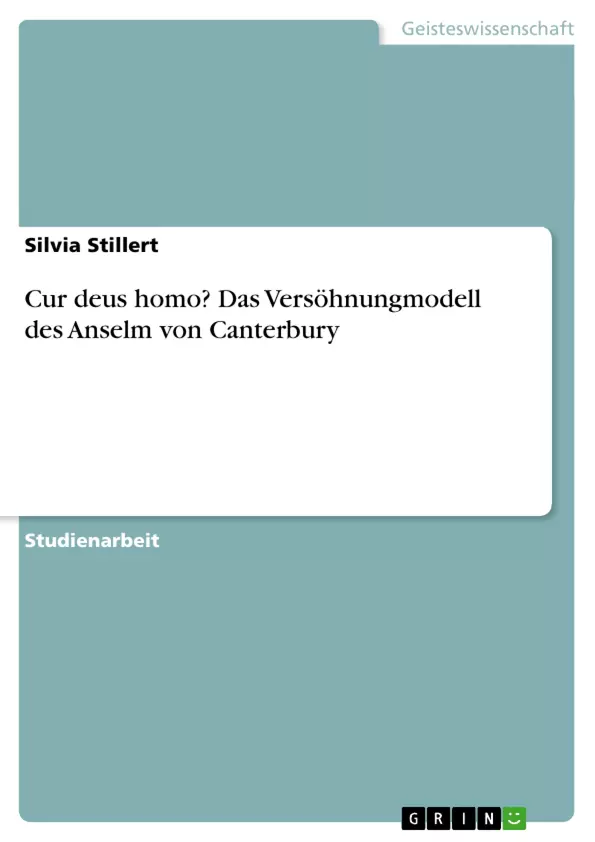Anselm, 1033 in Italien geboren, wurde 1093 zum Erzbischof von Canterbury/England berufen und war einer der größten mittelalterlichen Theologen mit weit reichendem Einfluss - er gilt als Vater der Scholastik.
Anselm war bestrebt, Glaubensdogmen rational zu begründen. Sein Grundsatz betont den Stellenwert der Vernunft: „Credo, ut intelligam.“ („Ich glaube, damit ich erkenne.“).
In seinem Hauptwerk „Cur Deus homo?“ („Warum ist Gott Mensch geworden?“) versucht Anselm mit bloßen Vernunftgründen die Notwendigkeit der Menschwerdung Gottes zur Erlösung der Menschen nachzuvollziehen. Zielpunkt ist dabei die Versöhnung Gottes mit den Menschen. Prägnant ist der dialogische Charakter des Werkes: Anselm redet als Lehrer mit Boso, seinem Klosterschüler. Boso vertritt in seinen Äußerungen sowohl die „fideles“ („Gläubigen“) als auch die „infideles“ („Ungläubigen“), denn die Frage ist für beide Gruppen ein Problem, nur die Gläubigen erwägen sie in ihren Herzen, aber die Ungläubigen werfen sie vor. Dass Boso die Worte der Ungläubigen benutzt, derer, die keineswegs dem Glauben ohne Begründung zustimmen wollen, macht die Fragen also präzise. Die Dialogform verhilft zu besserem Verständnis, da auch Einwände hervorgebracht und diskutiert werden. Die Antwort auf die Frage ergibt sich aus dem ganzen Werk und ist als Ergebnis des gesamten Gesprächsverlaufs zu sehen. Einzelaussagen sind immer im Kontext des ganzen Dialogs zu interpretieren.
Anselm stellt ganz an den Anfang seiner Arbeit die Einschränkungen, dass alles, was er sagt, auch ein Weiserer vervollständigen oder verbessern kann und dass solch ein Thema noch tiefere Gründe in sich birgt, als es ein Mensch überhaupt offenbaren kann. Zudem verweist er auf eine höhere Autorität. Falls diese seinen Vernunftgründen gegenüber steht, hat sie auf jeden Fall Recht. Als Autorität gilt allem voran die Bibel, die ein unumstößliches Fundament für die Wahrheit darstellt.
Diese Arbeit stützt sich zum größten Teil auf die Interpretation von Georg Plasger und stellt das Versöhnungsmodell Anselms von Canterbury verständlich dar, indem sie anhand der Kernpunkte seiner Versöhnungslehre der Entwicklung des Gedankengangs bis hin zur Zuspitzung der Antwort auf „Cur Deus homo“ folgt (Kapitel 2). Im Fazit fasst die Verfasserin die zentralen Thesen noch einmal knapp zusammen (Kapitel 3). Im Ausblick wird erörtert, wie sich Anselms Versöhnungsmodell auf heutige politische Versöhnungsprozesse übertragen lässt (Kapitel 4).
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Cur Deus homo?
- Die Frage, von der das ganze Werk abhängt
- Inhaltliche Voraussetzungen
- Die Sünde
- Genugtuung
- Befreiung zur Freiheit
- Entehrung Gottes
- Notwendigkeit und Freiwilligkeit des Todes Jesu
- Barmherzigkeit und Gerechtigkeit Gottes
- Die Beantwortung der Frage
- Zusammenfassung: Die zentralen Thesen
- Ausblick: Das Versöhnungsmodell im politischen Versöhnungsprozess
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Anselm von Canterbury, ein einflussreicher mittelalterlicher Theologe, verfasst in seinem Hauptwerk „Cur Deus homo?“ ein philosophisches Argument für die Notwendigkeit der Menschwerdung Gottes zur Erlösung der Menschen. Die Arbeit setzt sich mit der Frage auseinander, warum Gott sich als Mensch in die Welt einfügt, obwohl er allmächtig ist. Anselm möchte mit reinen Vernunftgründen die Versöhnung Gottes mit den Menschen erklären und dabei die scheinbaren Widersprüche zwischen Gottes Allmacht und der menschlichen Schwäche auflösen.
- Die Menschwerdung Gottes als notwendige Lösung für die Sünde der Menschheit
- Die Bedeutung des freien Willens und der Verantwortung des Menschen für seine Taten
- Die Rolle der Gerechtigkeit und Barmherzigkeit Gottes im Versöhnungsprozess
- Die Frage nach der Notwendigkeit und Freiwilligkeit des Todes Jesu
- Das Verhältnis von Christologie und Gotteslehre
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung führt in Anselms Leben und Werk ein und stellt den historischen Kontext und den Ansatzpunkt des Werks „Cur Deus homo?“ dar. Anselm setzt sich mit dem scheinbaren Widerspruch zwischen Gottes Allmacht und der menschlichen Schwäche auseinander und möchte die Menschwerdung Gottes als Lösung für dieses Problem erklären.
- Cur Deus homo?: Dieses Kapitel beleuchtet die zentrale Frage des Werks „Cur Deus homo?“ und geht auf die notwendigen Voraussetzungen und die Argumente Anselms ein. Die Sünde, die Genugtuung, die Befreiung zur Freiheit und die Notwendigkeit des Todes Jesu werden beleuchtet. Anselm zeigt auf, wie Gottes Menschwerdung den Konflikt zwischen Gerechtigkeit und Barmherzigkeit löst.
- Zusammenfassung: Die zentralen Thesen: In dieser Zusammenfassung werden die wichtigsten Kernaussagen von Anselms „Cur Deus homo?“ zusammengefasst.
- Ausblick: Das Versöhnungsmodell im politischen Versöhnungsprozess: Dieses Kapitel erörtert, wie Anselms Versöhnungsmodell auf aktuelle politische Versöhnungsprozesse übertragen werden kann.
Schlüsselwörter
Die Kernthemen des Werks „Cur Deus homo?“ von Anselm von Canterbury sind die Menschwerdung Gottes, die Erlösung der Menschheit, die Versöhnung mit Gott, die Bedeutung des freien Willens und die Rolle von Gerechtigkeit und Barmherzigkeit. Weitere wichtige Aspekte sind die Frage nach der Sünde, die Notwendigkeit der Genugtuung, die Befreiung zur Freiheit und die Interpretation des Todes Jesu im Kontext der Versöhnung.
- Citar trabajo
- Bachelor of Arts Silvia Stillert (Autor), 2007, Cur deus homo? Das Versöhnungmodell des Anselm von Canterbury, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/87203