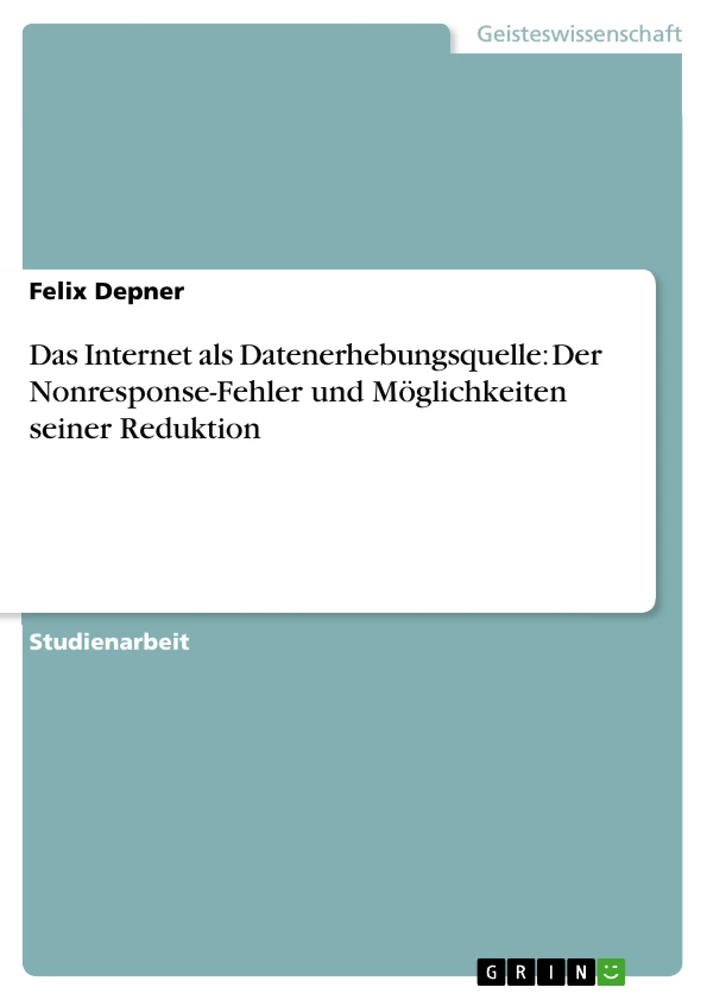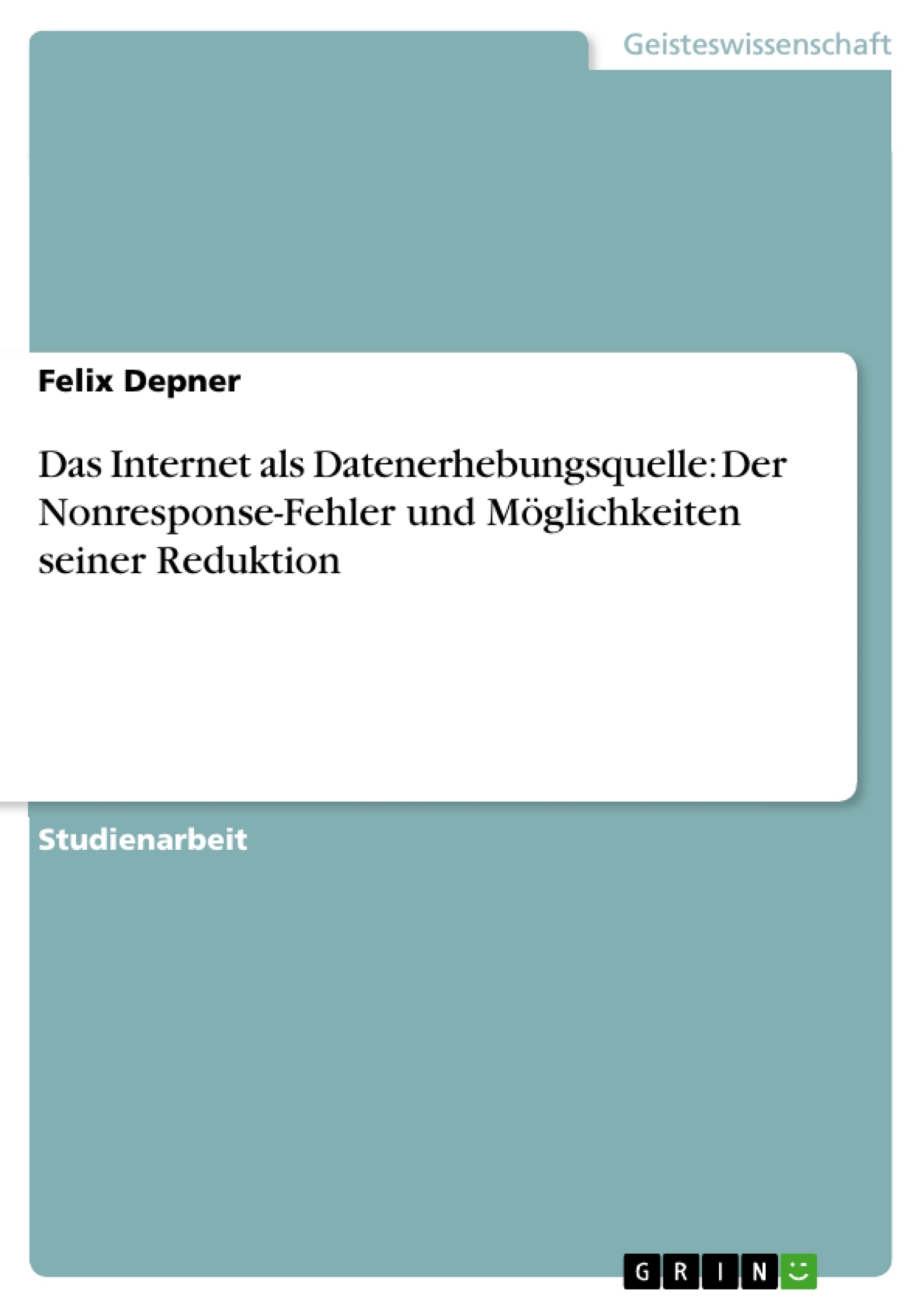Das Internet hat sich in den letzten Jahren zu einem beliebten Informations- und Kommunikationsmedium entwickelt und einen enormen Zuwachs an Nutzern aufgewiesen. So hatten zum Beispiel in Deutschland im Jahr 2005 laut Statistischem Bundesamt 94% der Unternehmen und 62% der privaten Haushalte einen Internetzugang. 54% aller Personen zwischen 16 und 74 Jahren haben das Internet dabei regelmäßig – das heißt mindestens ein Mal pro Woche – genutzt. Diese Zahlen lassen das Internet für viele Forschungsdisziplinen immer interessanter werden, da Daten so schnell, global und kostengünstig gewonnen werden können. Das Internet als neue Quelle des Informationsgewinns nimmt dabei verschiedene Formen an, die ihre eigenen Vor- und Nachteile mit sich bringen. Während die Vorteile, wie zum Beispiel die hohen Einsparungen, meist schnell auf der Hand liegen, nimmt sich die Forschung erst allmählich der verschiedenen Probleme und deren möglichen Lösungen an, die das Internet zur Folge hat. Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit dem spezifischen Problem der Antwortverweigerung, der auch als Nonresponse-Fehler bezeichnet wird, und mit den Möglichkeiten seiner Reduktion.
Der erste Teil der Arbeit gibt einen allgemeinen Überblick über das Medium Internet als neue Möglichkeit der Datenerhebung. Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Realisation von Fragebogenuntersuchungen im Internet und den Vorteilen und Fehlerquellen, die das Internet darbietet. Der zweite Teil greift den Nonresponse-Fehler als besonderes Problem heraus und erläutert dessen Ursachen und Folgen. Im dritten Teil soll dargestellt werden, wie man den Nonresponse-Fehler reduzieren kann. Dies soll anhand von verschiedenen Möglichkeiten und Techniken beschrieben und analysiert werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Das Internet als Datenerhebungsquelle
- 2.1 Realisation von Fragebogenuntersuchungen im Internet
- 2.2. Vorteile von internetbasierten Befragungen
- 2.3 Fehlerquellen
- 3. Der Non-Response Fehler
- 3.1 Definition von Nonresponse
- 3.2 Formen des Nonresponse bei Web-Befragungen
- 3.3. Gründe für Response
- 3.4 Gründe für Nonresponse
- 4. Möglichkeiten zur Reduktion des Nonresponse-Fehlers
- 4.1 Incentives
- 4.2. Themenstellung und Personalisierung der Ansprache
- 4.3. Rekrutierungsstrategien
- 4.4 Anonymität und Hinweise zum Datenschutz
- 4.5 Die High-Hurdle Technik
- 5. Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert die Herausforderungen und Chancen des Internets als Datenerhebungsquelle in der empirischen Sozialforschung. Der Fokus liegt dabei auf dem Nonresponse-Fehler, einem zentralen Problem bei Online-Umfragen.
- Realisation von Fragebogenuntersuchungen im Internet: E-Mail, NetNews, WWW
- Vorteile und Fehlerquellen internetbasierter Befragungen
- Definition, Formen und Ursachen des Nonresponse-Fehlers
- Möglichkeiten zur Reduktion des Nonresponse-Fehlers
- Bewertung der Chancen und Herausforderungen des Internets als Datenerhebungsquelle
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel liefert eine Einführung in das Thema und beleuchtet die wachsende Bedeutung des Internets als Datenerhebungsquelle in der Forschung. Es werden die verschiedenen Formen der Datenerhebung im Internet vorgestellt, insbesondere die Realisation von Fragebogenuntersuchungen per E-Mail, NetNews und WWW.
Kapitel zwei befasst sich mit dem Nonresponse-Fehler als einem zentralen Problem bei Online-Umfragen. Es werden Definition, Formen und Ursachen des Nonresponse-Fehlers erläutert.
Das dritte Kapitel widmet sich den Möglichkeiten zur Reduktion des Nonresponse-Fehlers. Verschiedene Strategien und Techniken werden vorgestellt und analysiert, darunter Incentives, Personalisierung der Ansprache, Rekrutierungsstrategien, Datenschutzhinweise und die High-Hurdle Technik.
Schlüsselwörter
Internet, Datenerhebungsquelle, Nonresponse-Fehler, Online-Umfrage, Web-Befragung, E-Mail-Befragung, NetNews, WWW, Response, Incentives, Datenschutz, High-Hurdle Technik
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Nonresponse-Fehler bei Online-Befragungen?
Der Nonresponse-Fehler bezeichnet die Verzerrung von Umfrageergebnissen, die dadurch entsteht, dass ein Teil der Zielperson die Teilnahme verweigert oder die Umfrage abbricht.
Welche Vorteile bietet das Internet für die Datenerhebung?
Daten können im Vergleich zu klassischen Methoden sehr schnell, kostengünstig und global gewonnen werden.
Wie kann man die Rücklaufquote bei Web-Befragungen erhöhen?
Möglichkeiten zur Reduktion des Nonresponse-Fehlers sind der Einsatz von Incentives (Anreizen), die Personalisierung der Ansprache sowie klare Hinweise zum Datenschutz.
Was ist die „High-Hurdle-Technik“?
Dies ist eine spezielle Technik in der Online-Forschung, um die Qualität der Antworten zu sichern, die in der Arbeit im Kontext der Nonresponse-Reduktion analysiert wird.
Welche Formen der Internet-Befragung gibt es?
Die Arbeit unterscheidet zwischen Fragebogenuntersuchungen per E-Mail, in NetNews-Gruppen oder über das World Wide Web (WWW).
- Arbeit zitieren
- Felix Depner (Autor:in), 2007, Das Internet als Datenerhebungsquelle: Der Nonresponse-Fehler und Möglichkeiten seiner Reduktion, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/87317