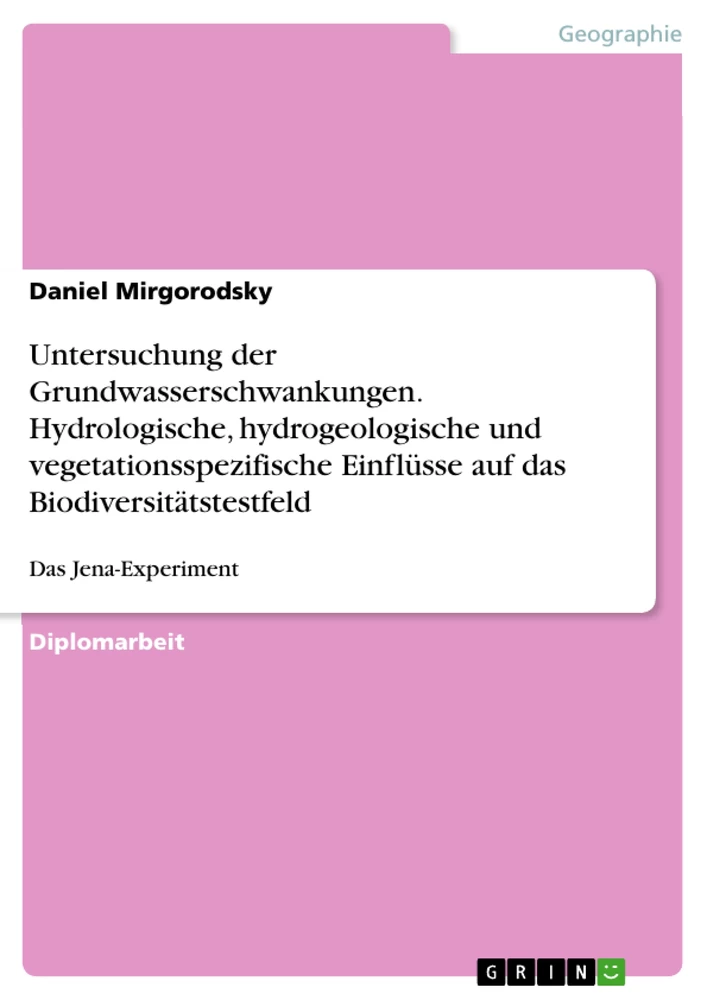Naturnahe Auenlandschaften besitzen aufgrund ihrer hohen Biodiversität und ihrer naturräumlichen Vielfalt einen hohen Stellenwert in der Hierarchie der Schutzgüter. Dabei stellt der Wasserhaushalt einen dominierenden Standortfaktor dar, der in Auen vorwiegend von der Wasserstandsdynamik im Fluss- und Grundwasser bestimmt wird (BÖHNKE & GEYER
2000: 99). Der bestimmende Steuerfaktor für Auen und Aueböden sind periodische Überflutungen aufgrund des Hochwassers in Flüssen. Der Wasserhaushalt bewegt sich dabei zwischen Überflutung durch Hochwasserereignisse und extremer Austrocknung in
Niedrigwasserzeiten. Aufgrund der häufigen Wechsel von Vernässungs- und Austrocknungsphasen stellen die Auengebiete in Bezug auf den Wasserhaushalt äußerst dynamische Systeme dar, in denen sich die wirksamen Faktoren und Prozesse räumlich und
zeitlich in unterschiedlichem Ausmaß wechselseitig beeinflussen.
Um die Prozesse und Faktoren der Beeinflussung des Wasserhaushalts in einem Auengebiet aufzulösen, wurden im Rahmen des Jena-Experiments bodenhydrologische Prozessstudien müber einen Zeitraum von 2 Jahren in der Unteraue der Saale durchgeführt (KREUTZIGER 2006).
Ziel war es die Auswirkungen des simulierten Artenverlustes in Grünlandökosystemen auf
den Bodenwasserhaushalt zu untersuchen. Die Ergebnisse dieser Untersuchungen belegen die
hohe raumzeitliche Dynamik des Bodenwasserhaushaltes auf dem Auestandort in
unmittelbarer Nähe der Saale. Nach SOPHOCLEOUS (2002) wird der Bodenwasserhaushalt von
Auestandorten in der Regel vom Grundwasser beeinflusst. Schwankungen der Grundwasserstände können sich dabei auf den Bodenwasserhaushalt auswirken.
Das übergeordnete Ziel der vorliegenden Arbeit ist die Schwankungen der Grundwasserstände räumlich, im Sinne von plotspezifisch, und zeitlich aufgelöst zu erfassen bzw. zu quantifizieren und hinsichtlich des differenzierten Vegetationsbestandes zu analysieren. Des weiteren werden Niederschlagsdaten und der Pegel der Saale als externe Faktoren herangezogen, um die Abhängigkeiten der Grundwasserschwankungen mit diesen Parametern zu untersuchen. Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der lokalen Skala,
einem ca. 2 ha großen Untersuchungsgebietes in der Saaleaue, welches durch oberflächennahes Grundwasser gekennzeichnet ist.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Boden- und Grundwasser in Auenlandschaften - Stand der Forschung
- 2.1 Wasser der ungesättigten Bodenzone
- 2.2 Oberflächennahes Grundwasser (gesättigte Bodenzone)
- 2.3 Die Aue als Interaktionsraum zwischen Grund- und Oberflächengewässer
- 3 Untersuchungsstandort
- 3.1 Naturräumliche Eingliederung
- 3.1.1 Geologie und Geomorphologie
- 3.1.2 Böden
- 3.1.3 Klima
- 3.1.4 Hydrologie
- 3.1.5 Hydrogeologische Situation
- 3.2 Das Experimentelle Design des Jenaer Experiments
- 3.1 Naturräumliche Eingliederung
- 4 Material und Methoden
- 4.1 Datenerfassung im Gelände
- 4.1.1 Grundwassermessstellen
- 4.1.2 Regionalisierung mit Kriging-Verfahren
- 4.1.3 Nivellement der Messpunkte
- 4.1.4 Probennahme und physiko-chemische Untersuchungen
- 4.2 Bodenphysikalische und chemische Untersuchungsmethoden
- 4.2.1 Bestimmung des Wassergehalts
- 4.2.2 Bestimmung des Gehaltes an organischer Substanz (Glühverlust)
- 4.2.3 Totalaufschluss
- 4.3 Analytische Messmethoden
- 4.3.1 ICP-OES
- 4.3.2 ICP-MS
- 4.3.3 Atomabsorptionsspektroskopie (AAS)
- 4.3.4 Photometer
- 4.4 Atmosphärische Randbedingungen - Meteorologische Kenngrößen
- 4.5 Pumpversuch (Bestimmung der geohydraulischen Leitfähigkeit kf)
- 4.1 Datenerfassung im Gelände
- 5 Ergebnisse
- 6 Interpretation und Diskussion der Ergebnisse
- 6.1 Charakterisierung der räumlichen und zeitlichen Unterschiede der oberflächennahen Grundwasserdynamik
- 6.2 Charakterisierung der Wechselbeziehung zwischen Grundwasserstand, Oberflächenwasser (Saale) und Niederschlag
- 6.3 Charakterisierung der Wechselbeziehung zwischen Grundwasserstand und Biodiversität
- 6.4 Charakterisierung der Grundwasserbeschaffenheit
- 6.4.1 physiko-chemische Parameter
- 6.4.2 Hydrochemische Parameter
- 6.5 Charakterisierung der Bodenlösung
- 6.6 Totalaufschluss
- 7 Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Das übergeordnete Ziel dieser Arbeit ist die Erfassung und Quantifizierung von Grundwasserschwankungen, räumlich aufgelöst nach Plots und zeitlich detailliert, sowie deren Analyse im Hinblick auf den unterschiedlichen Vegetationsbestand. Zusätzlich werden Niederschlagsdaten und der Saalepegel als externe Einflussfaktoren berücksichtigt, um Abhängigkeiten zu untersuchen.
- Räumliche und zeitliche Auflösung von Grundwasserschwankungen
- Analyse des Einflusses der Biodiversität auf die Grundwasserschwankungen
- Untersuchung der Abhängigkeit der Grundwasserschwankungen von Niederschlag und Saalepegel
- Charakterisierung der Grundwasserbeschaffenheit und räumlicher Unterschiede
- Analyse des Zusammenhangs zwischen Bodenlösung und Grundwassercharakteristik
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Arbeit untersucht die Grundwasserschwankungen im Jena-Experiment, einem Biodiversitätstestfeld, und deren Beziehung zu hydrologischen, hydrogeologischen und vegetationsbedingten Faktoren. Die räumliche und zeitliche Auflösung der Grundwasserschwankungen wird quantifiziert, und der Einfluss externer Faktoren wie Niederschlag und Saalepegel wird analysiert. Die Arbeit fokussiert auf die lokale Skala eines 2 ha großen Gebiets in der Saaleaue.
2 Boden- und Grundwasser in Auenlandschaften - Stand der Forschung: Dieses Kapitel bietet einen umfassenden Überblick über den aktuellen Forschungsstand zu Boden- und Grundwasser in Auenlandschaften. Es behandelt die ungesättigte und gesättigte Zone, den Einfluss von Bodenbeschaffenheit und Biodiversität auf den Wasserhaushalt, sowie die Interaktion zwischen Grund- und Oberflächenwasser. Es werden verschiedene Modelle und Studien zu Wassertransportprozessen und Stoffbilanzen in Auenökosystemen diskutiert.
3 Untersuchungsstandort: Dieses Kapitel beschreibt detailliert den Untersuchungsstandort im Jena-Experiment, einschließlich der naturräumlichen Eingliederung (Geologie, Geomorphologie, Klima, Hydrologie, hydrogeologische Situation) und des experimentellen Designs des Biodiversitätsexperiments selbst. Es wird die spezifische Anlage der Plots mit variierenden Artenzahlen erläutert.
4 Material und Methoden: Dieses Kapitel beschreibt die verwendeten Materialien und Methoden zur Datenerfassung und -analyse. Es detailliert die Messmethoden für Grundwasserstände, Bodenparameter, hydrochemische Analysen und meteorologische Daten. Der Abschnitt über den Pumpversuch zur Bestimmung der hydraulischen Leitfähigkeit wird ebenfalls erläutert.
5 Ergebnisse: Dieses Kapitel präsentiert die Ergebnisse der hydrologischen und hydrochemischen Untersuchungen. Es zeigt die Grundwasserganglinien, die Beziehung zwischen Grundwasserstand, Saalepegel und Niederschlag, sowie die Ergebnisse der physiko-chemischen und hydrochemischen Analysen des Grund- und Bodenwassers.
6 Interpretation und Diskussion der Ergebnisse: Dieses Kapitel interpretiert die in Kapitel 5 präsentierten Ergebnisse. Es analysiert die räumlichen und zeitlichen Unterschiede der Grundwasserdynamik, die Wechselbeziehungen zwischen Grundwasserstand, Oberflächenwasser und Niederschlag, sowie den Einfluss der Biodiversität. Die Grundwasserbeschaffenheit und der Vergleich zwischen Sicker- und Grundwasser werden ausführlich diskutiert. Schließlich werden die Ergebnisse des Totalaufschlusses analysiert.
Schlüsselwörter
Grundwasserschwankungen, Saaleaue, Jena-Experiment, Biodiversität, Bodenwasserhaushalt, Hydrologie, Hydrogeologie, Hydrochemie, Niederschlag, Oberflächenwasser, Pflanzendiversität, Elementgehalte, Totalaufschluss, Kriging.
Häufig gestellte Fragen zum Jena-Experiment: Grundwasserdynamik und Biodiversität
Was ist das übergeordnete Ziel der Arbeit?
Das Hauptziel ist die Erfassung und Quantifizierung von räumlich und zeitlich aufgelösten Grundwasserschwankungen im Jena-Experiment. Die Analyse konzentriert sich auf den Einfluss des unterschiedlichen Vegetationsbestands und externer Faktoren wie Niederschlag und Saalepegel.
Welche Themen werden im Detail behandelt?
Die Arbeit untersucht die räumliche und zeitliche Auflösung der Grundwasserschwankungen, den Einfluss der Biodiversität darauf, die Abhängigkeit von Niederschlag und Saalepegel, die Charakterisierung der Grundwasserbeschaffenheit und räumlicher Unterschiede, sowie den Zusammenhang zwischen Bodenlösung und Grundwassercharakteristik.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in sieben Kapitel: Einleitung, Stand der Forschung zu Boden- und Grundwasser in Auenlandschaften, Beschreibung des Untersuchungsstandorts (Jena-Experiment), Material und Methoden, Ergebnisse, Interpretation und Diskussion der Ergebnisse und Zusammenfassung. Jedes Kapitel behandelt spezifische Aspekte der Grundwasserdynamik im Kontext des Jena-Experiments.
Welche Methoden wurden verwendet?
Die Datenerfassung umfasste Grundwassermessungen, Regionalisierung mit Kriging-Verfahren, Nivellement der Messpunkte, Probennahmen und physiko-chemische Untersuchungen. Bodenphysikalische und chemische Analysen (Wassergehalt, organische Substanz, Totalaufschluss) wurden ebenso durchgeführt wie analytische Messmethoden (ICP-OES, ICP-MS, AAS, Photometer). Meteorologische Daten und ein Pumpversuch zur Bestimmung der hydraulischen Leitfähigkeit ergänzten die Datengrundlage.
Welche Ergebnisse wurden erzielt?
Die Ergebnisse umfassen Grundwasserganglinien, die Beziehung zwischen Grundwasserstand, Saalepegel und Niederschlag, sowie Ergebnisse der physiko-chemischen und hydrochemischen Analysen des Grund- und Bodenwassers. Diese Daten bilden die Grundlage für die Interpretation und Diskussion der Ergebnisse.
Wie werden die Ergebnisse interpretiert?
Die Interpretation analysiert die räumlichen und zeitlichen Unterschiede der Grundwasserdynamik, die Wechselbeziehungen zwischen Grundwasserstand, Oberflächenwasser und Niederschlag, sowie den Einfluss der Biodiversität. Die Grundwasserbeschaffenheit und der Vergleich zwischen Sicker- und Grundwasser werden ausführlich diskutiert. Die Ergebnisse des Totalaufschlusses werden ebenfalls analysiert.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Grundwasserschwankungen, Saaleaue, Jena-Experiment, Biodiversität, Bodenwasserhaushalt, Hydrologie, Hydrogeologie, Hydrochemie, Niederschlag, Oberflächenwasser, Pflanzendiversität, Elementgehalte, Totalaufschluss, Kriging.
Wo finde ich detaillierte Informationen zu den einzelnen Kapiteln?
Die Zusammenfassung der Kapitel im HTML-Dokument bietet einen Überblick über den Inhalt jedes Kapitels. Die detaillierten Informationen finden sich im vollständigen Forschungsbericht.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Wissenschaftler, die sich mit Hydrologie, Hydrogeologie, Ökologie und Biodiversitätsforschung beschäftigen. Die Ergebnisse sind auch für Umweltplaner und -manager von Interesse, die sich mit dem Management von Auenlandschaften und Grundwasserressourcen befassen.
- Citation du texte
- Daniel Mirgorodsky (Auteur), 2007, Untersuchung der Grundwasserschwankungen. Hydrologische, hydrogeologische und vegetationsspezifische Einflüsse auf das Biodiversitätstestfeld, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/87360