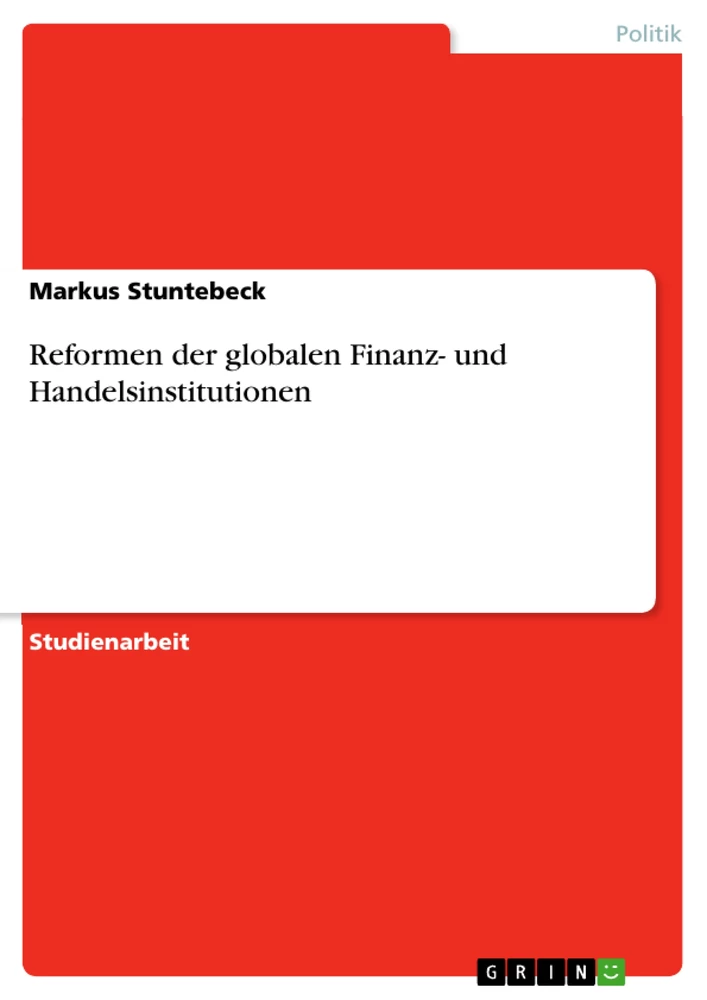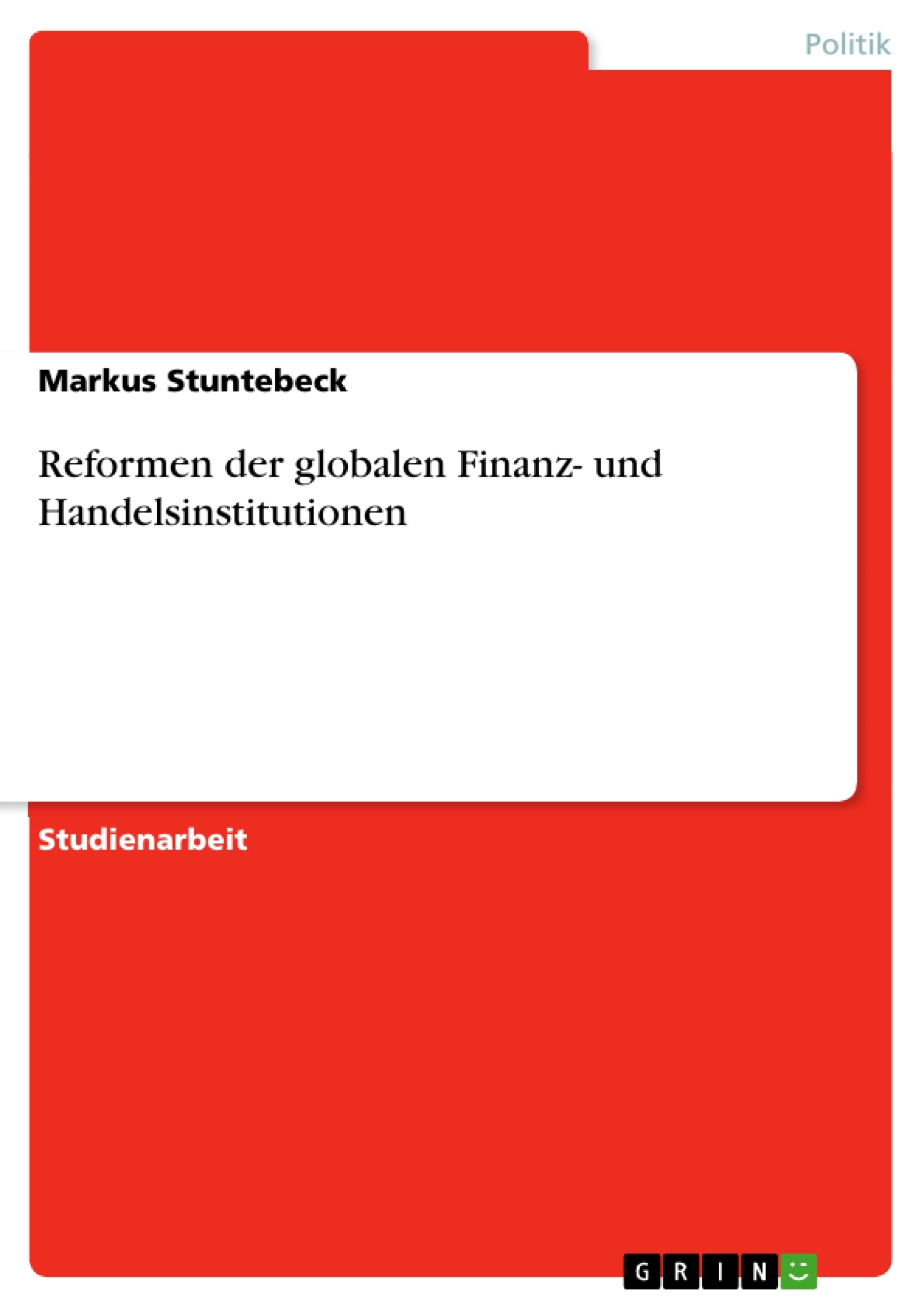Die großen, globalen Finanz- und Handelsinstitutionen stehen bereits seit einigen Jahren in der Kritik. Diese entzündet sich an der Tatsache, dass die Industriestaaten durch ihre Hilfe ihre globale Vormachtstellung verteidigen. Dies geschieht zu Lasten vieler kleiner, finanzschwacher Staaten, die es trotz kolonialer Unterdrückung oder militärischer Interventionen geschafft haben, auf dem Weltmarkt mit den Industriestaaten konkurrieren zu können.
Die Kluft zwischen armen und reichen Staaten wird zunehmend größer und im folgenden soll untersucht werden, inwiefern die globalen Institutionen Weltbank, Internationaler Währungsfonds und Welthandelsorganisation reformiert werden müssen, um diese Entwicklung zu stoppen.
Zunächst werden die einzelnen Institutionen und ihre Gründungsgeschichte kurz vorgestellt. Diese Darstellung der Institutionen ist bewusst kurz gefasst und nicht vollständig und wird nur dort detailliert vorangetrieben, wo es für spätere Betrachtungen der Probleme und Lösungen notwendig ist.
Es schließt sich die Analyse der wichtigsten Problemfelder der der Institutionen an, auf deren Basis letztendlich verschiedene Reformansätze dargestellt und diskutiert werden sollen.
Eine abschließende Betrachtung klärt noch offene Fragen und zieht ein Fazit aus den dargestellten Analysen und Beschreibungen.
Bis zum Beginn des Ersten Weltkriegs wurde das internationale Währungssystem auf dem internationalen Goldstandard aufgebaut, bei dem jede nationale Währungseinheit durch eine bestimmte Mengeneinheit Gold definiert ist. Das Austauschverhältnis der Währungen untereinander ist durch diese Goldgrundlage festgelegt (Goldparität). Das Funktionieren dieses Systems setzte die Einhaltung gewisser Verhaltensstandards der einzelnen Staaten voraus, so die Einhaltung des außenwirtschaftlichen Gleichgewichts, um die Stabilität der Wechselkurse zu gewähren.
Die zunehmende Konzentration auf die Eigeninteressen der Staaten und die auch darauf zurückzuführende Weltwirtschaftskrise machte ein neues Währungssystem notwendig. „In der Währungspolitik dominerten nationale Gesichtspunkte völlig, und das Schwinden internationaler Solidarität war ein wichtiger Faktor für die Weltwirtschaftskrise. […] Wechselkursma-nipulationen [wurden] zur währungspolitischen Waffe, um die eigenen Exportchancen und damit die heimische Beschäftigungslage auf Kosten anderer Staaten zu verbessern.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Das Bretton Woods System und seine Institutionen
- Weltbank und Weltbankgruppe
- Gründungsgeschichte und Aufgaben
- Struktur
- Internationaler Währungsfonds (IWF)
- Gründungsgeschichte und Aufgaben
- Struktur
- Weltbank und Weltbankgruppe
- Welthandelsorganisation (WTO)
- Vom Handelsabkommen zur Organisation
- Welthandelsorganisation (WTO)
- Gründungsgeschichte und Ziele
- Struktur
- Problemfelder der Institutionen
- Der Washington Consensus
- Das Strukturanpassungsprogramm der Weltbank und des IWF
- Das Aufgabengebiet der Weltbank
- Die Abschottung der Märkte der Industrieländer
- Die faktische Unterrepräsentation der Entwicklungsländer
- Reformansätze
- Institutionelle Reformen
- Einbeziehung der Zivilgesellschaft
- Unterstützung der Entwicklungsstaaten
- Erweiterung der Themenpalette
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit den globalen Finanz- und Handelsinstitutionen und analysiert die Kritik, die an ihnen geäußert wird. Im Zentrum steht die Frage, inwieweit diese Institutionen, insbesondere die Weltbank, der Internationale Währungsfonds und die Welthandelsorganisation, reformiert werden müssen, um die zunehmende Kluft zwischen armen und reichen Staaten zu schließen.
- Gründungsgeschichte und Struktur der Institutionen
- Kritik an den Institutionen, insbesondere am Washington Consensus und den Strukturanpassungsprogrammen
- Die Rolle der Institutionen in der globalen Wirtschaftsentwicklung und ihre Auswirkungen auf Entwicklungsländer
- Mögliche Reformansätze und ihre Umsetzung
- Die Bedeutung der Zivilgesellschaft und der Einbeziehung der Entwicklungsländer in die Entscheidungsfindungsprozesse
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Einleitung führt in die Thematik ein und erläutert die Relevanz der globalen Finanz- und Handelsinstitutionen für die wirtschaftliche Entwicklung. Sie stellt die wichtigsten Ziele der Arbeit dar und skizziert den methodischen Aufbau.
- Das zweite Kapitel beschreibt das Bretton Woods System und seine Institutionen, die Weltbank und den Internationalen Währungsfonds. Es beleuchtet die Entstehungsgeschichte der beiden Institutionen, ihre Aufgaben und Strukturen.
- Das dritte Kapitel befasst sich mit der Welthandelsorganisation (WTO) und ihrer Entstehung aus den ursprünglichen Handelsabkommen. Es geht auf die Gründungsgeschichte, die Ziele und die Struktur der Organisation ein.
- Das vierte Kapitel analysiert die Problemfelder der Institutionen, insbesondere den Washington Consensus und die Auswirkungen der Strukturanpassungsprogramme auf Entwicklungsländer. Es stellt die Kritik an der Abschottung der Märkte der Industrieländer und der Unterrepräsentation der Entwicklungsländer in den Entscheidungsfindungsprozessen dar.
- Das fünfte Kapitel befasst sich mit verschiedenen Reformansätzen, die zur Verbesserung der Situation der Entwicklungsländer beitragen könnten. Es diskutiert institutionelle Reformen, die Einbeziehung der Zivilgesellschaft, die Unterstützung der Entwicklungsstaaten und die Erweiterung der Themenpalette der Institutionen.
Schlüsselwörter
Die zentralen Themen der Arbeit sind die globalen Finanz- und Handelsinstitutionen, insbesondere die Weltbank, der Internationale Währungsfonds (IWF) und die Welthandelsorganisation (WTO). Zu den zentralen Begriffen gehören der Washington Consensus, Strukturanpassungsprogramme, Entwicklungsländer, Armutsbekämpfung, Wirtschaftswachstum, globale Ungleichheit, Reformansätze, Einbeziehung der Zivilgesellschaft und institutionelle Veränderungen.
Häufig gestellte Fragen
Warum stehen Weltbank und IWF in der Kritik?
Kritiker werfen ihnen vor, die globale Vormachtstellung der Industriestaaten zu Lasten finanzschwacher Entwicklungsländer zu verteidigen.
Was versteht man unter dem "Washington Consensus"?
Es handelt sich um ein Set wirtschaftspolitischer Maßnahmen, die oft als Bedingung für Kredite gestellt wurden und Privatisierung sowie Marktöffnung forcierten.
Welche Rolle spielt die WTO im Welthandel?
Die Welthandelsorganisation (WTO) setzt Regeln für den globalen Handel fest, wird aber oft für die Unterrepräsentation von Entwicklungsländern kritisiert.
Welche Reformansätze werden für diese Institutionen diskutiert?
Diskutiert werden institutionelle Reformen zur besseren Einbindung der Zivilgesellschaft und eine stärkere Unterstützung der Entwicklungsstaaten bei Entscheidungen.
Was war das Bretton-Woods-System?
Es war eine nach dem Zweiten Weltkrieg geschaffene internationale Währungsordnung, aus der die Weltbank und der IWF hervorgingen.
- Quote paper
- Markus Stuntebeck (Author), 2007, Reformen der globalen Finanz- und Handelsinstitutionen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/87376