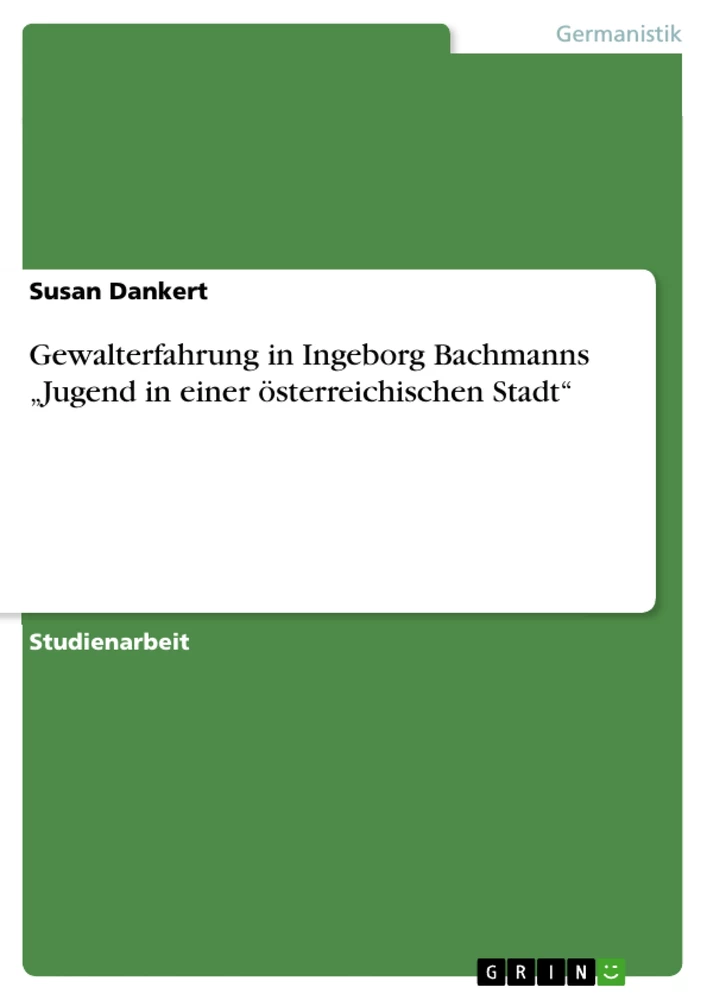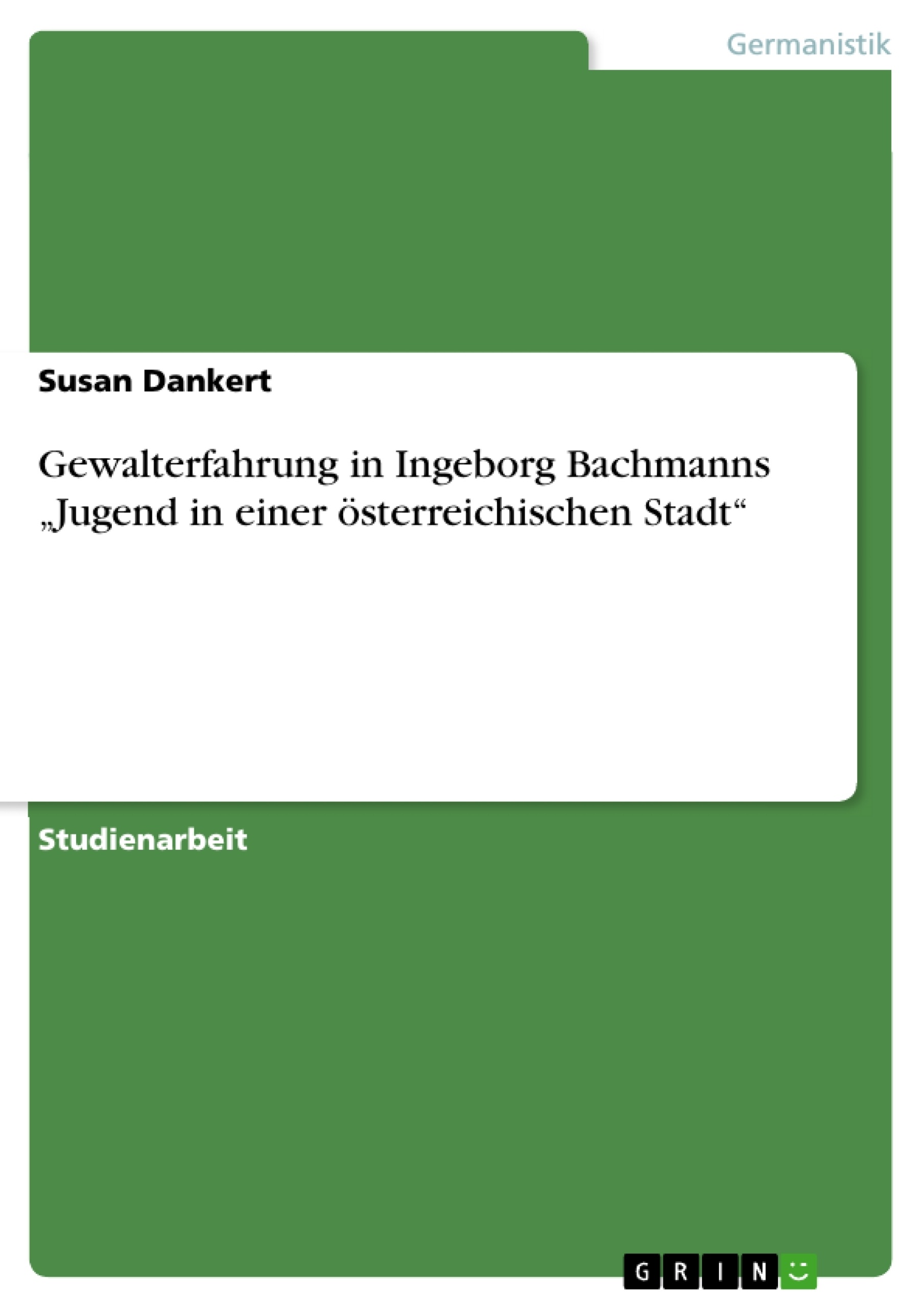Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit Ingeborg Bachmanns Erzählung „Jugend in einer österreichischen Stadt“. Nach einer einleitenden Auseinandersetzung mit ganz allgemeinen Aspekten wie Inhalt, Struktur und Erzählweise dieses kurzen Textes kommt es zur ausführlichen Analyse der Erzählung unter dem Gesichtspunkt Gewalterfahrung in Texten Ingeborg Bachmanns. Es werden dabei Erfahrungsbereiche erschlossen, in denen physische und psychische Kränkungen der Subjekte im Text vorkommen und insbesondere dargelegt, inwieweit auch Sprache über Gewaltpotential verfügt. In diesem Zusammenhang werden Bezüge zu Ingeborg Bachmanns Leben hergestellt, zugleich jedoch eine ausschließlich autobiographische Perspektive abgelehnt. Im letzten Teil der Arbeit wird ein Interpretationsansatz präsentiert und der Versuch unternommen, ausgehend von Aussagen der Autorin Bachmann zu ihrer Erzählung einen sinnvollen Zusammenhang zwischen Form und Inhalt des Textes herzustellen.
Die Erzählung „Jugend in einer österreichischen Stadt“ von Ingeborg Bachmann ist 1961 im Erzählband Das dreißigste Jahr erschienen. Ein Versuch, den Inhalt des Textes in wenigen Sätzen einzugrenzen, könnte folgendermaßen lauten: In dieser Erzählung gibt eine mutmaßlich ideelle Reise, als reale Reise vorgestellt, dem Erzähler Anlass zur Rückreise in die Erinnerungen seiner verlorenen Kindheit. Die präsentierten Erinnerungsszenen schwanken dabei zwischen der Verarbeitung von offenkundig authentischen biographischen Erlebnissen Ingeborg Bachmanns und einer als „Dekonstruktion einer autobiographischen Skizze“ (Bachmann 1994, S. 26) zu bezeichnenden Komposition des Textes. Es findet eine Grenzerfahrung in dem Sinne statt, dass die Grenze zwischen Kindheit und Erwachsenwerden überschritten wird. Zentrale Themen stellen neben dem Verlust der Kindheit bzw. der Heimat infolge des Krieges das Verhältnis von Sprache und Identität, sowie das Verhältnis von Kindheit bzw. Heimat und Identität dar. Die Erzählung ist einfach strukturiert und gliedert sich in einen Rahmen und einen Binnen- bzw. Haupttext. Diese grenzen sich mithilfe jeweils eines Absatzes graphisch voneinander ab, sodass sich folgende Textgliederung ergibt:
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Inhalt
- 3. Textaufbau
- 4. "Gangart" des Textes
- 5. Topographische und biographische Bezüge
- 6. Gewalterfahrung
- 6.1. Zwänge aus dem sozialen Umfeld
- 6.1.1. Einschränkungen im Sprachgebrauch
- 6.1.2. Erziehung bzw. Lernen als Zwang
- 6.1.3. Einschränkungen aus ökonomischen Gründen
- 6.2. Verängstigung durch Gewalt in Medien
- 6.3. Das Erlebnis Krieg
- 6.3.1. Aggression, Gewalt und Zerstörung
- 6.3.2. Die Auswirkungen des Krieges
- 6.1. Zwänge aus dem sozialen Umfeld
- 7. Interpretationsansatz
- 7.1. Vernichtung der Person Kind
- 7.2. Distanz
- 7.3. Überwindung der Distanz
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert Ingeborg Bachmanns Erzählung „Jugend in einer österreichischen Stadt“ im Hinblick auf die Darstellung von Gewalterfahrung. Die Analyse umfasst die Erforschung verschiedener Formen physischer und psychischer Gewalt, die Rolle der Sprache als Vehikel der Gewalt und den Bezug zu Bachmanns Biografie, wobei eine rein autobiografische Lesart vermieden wird. Der Fokus liegt auf der Verbindung von Form und Inhalt der Erzählung und der Entwicklung eines Interpretationsansatzes basierend auf Bachmanns eigenen Aussagen.
- Gewalterfahrung in Kindheit und Jugend
- Die Bedeutung von Sprache und Identität
- Der Einfluss des Krieges auf die Wahrnehmung der Welt
- Die Beziehung zwischen Erinnerung und Erzählen
- Der Prozess des Erwachsenwerdens und der Verlust der Kindheit
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung beschreibt den Gegenstand der Arbeit: die Analyse der Gewalterfahrung in Ingeborg Bachmanns Erzählung „Jugend in einer österreichischen Stadt“. Sie skizziert den methodischen Ansatz, der die Untersuchung der physischen und psychischen Kränkungen der Subjekte im Text, sowie die Rolle der Sprache als Gewaltmittel umfasst. Ein Bezug zu Bachmanns Biografie wird angekündigt, jedoch wird eine rein autobiografische Interpretation ausgeschlossen. Der letzte Teil der Arbeit widmet sich einem Interpretationsansatz, der die Verbindung zwischen Form und Inhalt der Erzählung untersucht.
2. Inhalt: Dieses Kapitel fasst den Inhalt von Bachmanns Erzählung kurz zusammen. Es beschreibt die Erzählung als eine mutmaßlich ideelle Reise, die als reale Reise präsentiert wird und den Erzähler zu einer Rückreise in die Erinnerungen seiner Kindheit führt. Die Erinnerungsszenen schwanken zwischen authentischen biographischen Erlebnissen Bachmanns und einer „Dekonstruktion einer autobiografischen Skizze“. Zentrale Themen sind der Verlust der Kindheit und Heimat durch den Krieg, das Verhältnis von Sprache und Identität, sowie das Verhältnis von Kindheit/Heimat und Identität.
3. Textaufbau: Dieser Abschnitt beschreibt den einfachen Aufbau der Erzählung, bestehend aus einem Rahmen und einem Binnentext, die graphisch durch Absätze voneinander getrennt sind. Der Rahmen enthält eine Schilderung eines optisch-magischen Erlebnisses mit einem Kirschbaum und führt in den Binnentext über, der verschiedene, teilweise unzusammenhängende Erinnerungsszenen chronologisch von der frühesten Kindheit bis zum Verlassen der Stadt erzählt. Der abschließende Teil des Rahmens beschreibt das Fazit des Erzählsubjekts zum Verhältnis zwischen Persönlichkeit, Kindheit und Heimat.
4. "Gangart" des Textes: Hier wird die unkonventionelle Erzählweise der Erzählung beschrieben, die von Bachmanns Programm einer „neuen Gangart“ der Sprache beeinflusst ist. Anstelle eines durchgehenden Handlungsstranges werden aneinandergereihte Erinnerungsaufnahmen präsentiert, unterbrochen von lyrisch anmutenden Textabschnitten und Aufzählungen. Der lose Zusammenhang der Abschnitte wird durch die formale Aufteilung in viele Paragraphen unterstützt und die Kohäsion durch Anaphern geschaffen. Der Schreibstil zeichnet sich durch ungewöhnliche Bilder aus, die erschreckende Erfahrungen ausdrucksstark vermitteln. Ort, Zeit und Erzählinstanz sind unkonventionell gestaltet.
Schlüsselwörter
Ingeborg Bachmann, Jugend in einer österreichischen Stadt, Gewalterfahrung, Kindheit, Heimat, Krieg, Sprache, Identität, Erinnerung, Erzähltechnik, autobiographische Elemente, Dekonstruktion.
Häufig gestellte Fragen zu Ingeborg Bachmanns "Jugend in einer österreichischen Stadt"
Was ist der Gegenstand dieser HTML-Datei?
Diese HTML-Datei bietet eine umfassende Übersicht über eine wissenschaftliche Arbeit, die sich mit Ingeborg Bachmanns Erzählung "Jugend in einer österreichischen Stadt" auseinandersetzt. Sie beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte der Analyse, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und eine Liste von Schlüsselbegriffen.
Welche Themen werden in der Analyse von "Jugend in einer österreichischen Stadt" behandelt?
Die Analyse konzentriert sich auf die Darstellung von Gewalterfahrungen in der Erzählung. Dabei werden verschiedene Formen physischer und psychischer Gewalt untersucht, die Rolle der Sprache als Vehikel der Gewalt, der Bezug zu Bachmanns Biografie (ohne rein autobiografische Interpretation), die Verbindung von Form und Inhalt und die Entwicklung eines entsprechenden Interpretationsansatzes.
Welche Kapitel umfasst die Analyse?
Die Analyse gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Inhalt, Textaufbau, "Gangart" des Textes, Topographische und biographische Bezüge, Gewalterfahrung (mit Unterkapiteln zu sozialen Zwängen, Gewalt in Medien und Kriegserfahrungen) und Interpretationsansatz (mit Unterkapiteln zu Personvernichtung, Distanz und Überwindung der Distanz).
Wie wird der Inhalt der Erzählung zusammengefasst?
Der Inhalt wird als mutmaßlich ideelle Reise beschrieben, die als reale Reise präsentiert wird und den Erzähler zu einer Rückreise in die Erinnerungen seiner Kindheit führt. Die Erinnerungsszenen wechseln zwischen authentischen biographischen Erlebnissen Bachmanns und einer "Dekonstruktion einer autobiografischen Skizze". Zentrale Themen sind der Verlust der Kindheit und Heimat durch den Krieg, das Verhältnis von Sprache und Identität sowie das Verhältnis von Kindheit/Heimat und Identität.
Wie wird der Textaufbau der Erzählung beschrieben?
Der Textaufbau wird als einfach beschrieben, bestehend aus einem Rahmen und einem Binnentext, die graphisch durch Absätze getrennt sind. Der Rahmen beschreibt ein optisch-magisches Erlebnis und führt in den Binnentext über, der verschiedene, teilweise unzusammenhängende Erinnerungsszenen chronologisch erzählt. Der abschließende Teil des Rahmens beschreibt das Fazit des Erzählsubjekts.
Wie wird die "Gangart" des Textes charakterisiert?
Die Erzählweise wird als unkonventionell beschrieben, beeinflusst von Bachmanns Programm einer „neuen Gangart“ der Sprache. Anstelle eines durchgehenden Handlungsstranges werden aneinandergereihte Erinnerungsaufnahmen präsentiert, unterbrochen von lyrisch anmutenden Textabschnitten und Aufzählungen. Der lose Zusammenhang wird durch die formale Aufteilung und Anaphern geschaffen. Der Schreibstil zeichnet sich durch ungewöhnliche Bilder aus, die erschreckende Erfahrungen ausdrucksstark vermitteln.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Analyse?
Die Analyse wird durch folgende Schlüsselwörter charakterisiert: Ingeborg Bachmann, Jugend in einer österreichischen Stadt, Gewalterfahrung, Kindheit, Heimat, Krieg, Sprache, Identität, Erinnerung, Erzähltechnik, autobiographische Elemente, Dekonstruktion.
Welche Zielsetzung verfolgt die Analyse?
Die Analyse zielt darauf ab, Ingeborg Bachmanns Erzählung "Jugend in einer österreichischen Stadt" im Hinblick auf die Darstellung von Gewalterfahrung zu analysieren. Dabei wird die Erforschung verschiedener Formen physischer und psychischer Gewalt, die Rolle der Sprache als Vehikel der Gewalt und der Bezug zu Bachmanns Biografie (ohne rein autobiografische Lesart) untersucht. Der Fokus liegt auf der Verbindung von Form und Inhalt der Erzählung und der Entwicklung eines Interpretationsansatzes basierend auf Bachmanns eigenen Aussagen.
- Quote paper
- Susan Dankert (Author), 2008, Gewalterfahrung in Ingeborg Bachmanns „Jugend in einer österreichischen Stadt“, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/87402