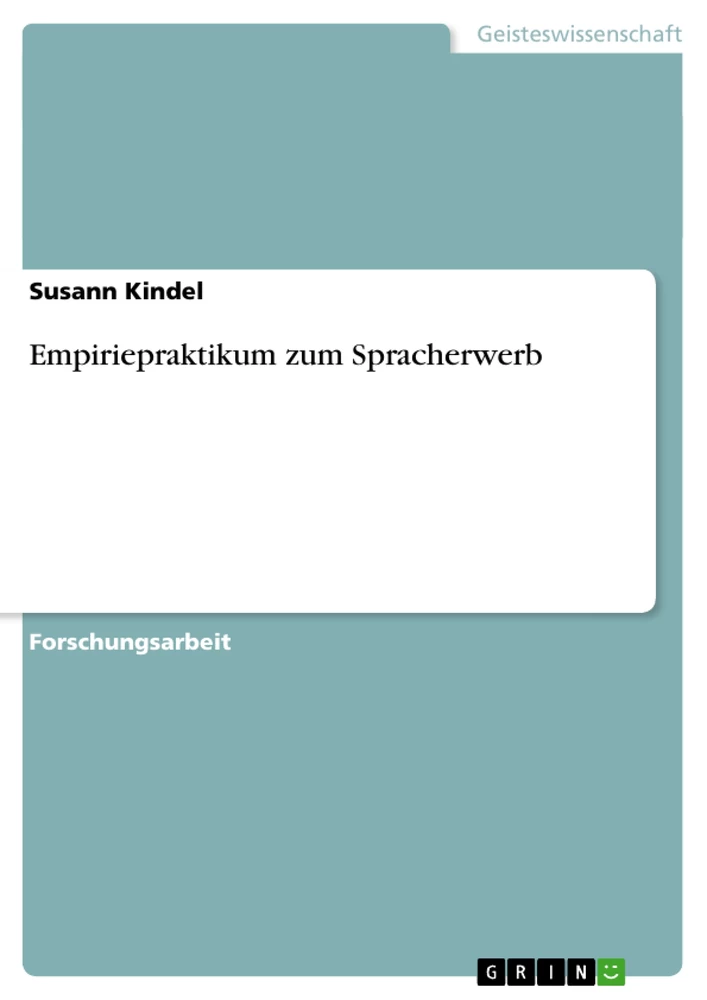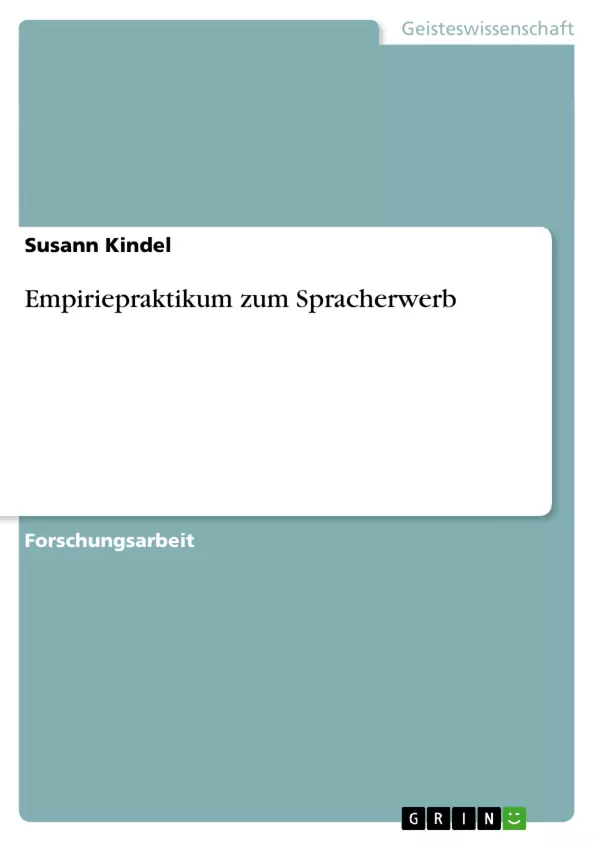Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Fragestellung, wie Kinder im Alter von sieben bis zehn Jahren Geschichten, die ihnen vorgelesen werden, direkt und nach zwei Stunden wiedergeben. Untersucht wird gleichzeitig, ob sich Kinder gleichen Alters bezüglich ihres Sprachentwicklungsstandes unterscheiden und inwieweit dies einen Einfluss auf ihr Textgedächtnis hat. Dabei orientierten wir uns insbesondere an der Theorie von Kintsch.
Nach dem Textverstehensmodell von Van Dijk und Kintsch (1983) resultiert die Mikrostruktur eines Textes aus einer Kohärenzanalyse, „wobei die elementaren Propositionen eines Textes zu einer hierarchischen Struktur zusammengefügt werden“ (Kintsch, 1994, 41). Die Mikrostruktur eines Textes entspricht dem Stoff für weitere Verarbeitungsschritte und bestimmt demnach die Herausarbeitung der Makrostruktur. So ist beispielsweise das Verstehen wissensintensiv, da hier sowohl adäquates Wissen, als auch Enkordierungsstrategien wichtig sind. Die entscheidende mentale Repräsentation entspricht dem Situationsmodell. Dieses zeigt, was ein Text über bestimmte Situationen aussagt und zieht Schlüsse aus dem Verhältnis der Information des Textes zu dem Vorwissen des Kindes. Es ist die psychologisch realisierte Bedeutungsvorstellung (Repräsentation) dessen, worüber der Text eine Aussage trifft. Van Dijks und Kintschs Modell (1983) befasst sich mit den mentalen Kalkulationen, die nötig sind, um verschiedene Text- und Situationsrepräsentationen aufzubauen. Der Gegenstandsbereich der Theorie ist vor allem die Konstruktion von Bedeutungseinheiten (Propositionen), die Rolle des begrenzten Arbeitsgedächtnisses und die Erleichterung des Verständnisses durch eine konventionelle und schematische Textstruktur. Die Propositionen ergeben ein hierarchisch aufgebautes Netz, was die Textbasis bzw. die mentale Repräsentation des Textes darstellt.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Methode
- III. Ergebnisse
- IV. Diskussion der Ergebnisse
- V. Anhang
- Tabelle 1
- Tabelle 2
- Diagramm 1
- Diagramm 2
- Diagramm 3
- Tabelle 3
- Tabelle 4
- VI. Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Wiedergabefähigkeit von Geschichten bei Kindern im Alter von sieben bis zehn Jahren. Der Fokus liegt auf der Frage, wie Kinder direkt nach dem Vorlesen und nach zwei Stunden die Geschichten wiedergeben können. Außerdem wird untersucht, ob sich Kinder gleichen Alters in ihrer Sprachentwicklung unterscheiden und wie sich diese Unterschiede auf das Textgedächtnis auswirken. Die Arbeit orientiert sich dabei an der Theorie von Kintsch.
- Textverstehen und die Konstruktion von mentalen Repräsentationen
- Einfluss von Sprachentwicklung und Textgedächtnis auf die Wiedergabe von Geschichten
- Analyse der Mikro- und Makrostruktur von Texten
- Rolle des Wissens und der persönlichen Erfahrung beim Textverstehen
- Entwicklung von Situationsmodellen und Textbasen
Zusammenfassung der Kapitel
Das Kapitel I "Einleitung" führt in die Thematik der Arbeit ein und stellt die Forschungsfrage sowie die theoretischen Grundlagen vor. Das Kapitel II "Methode" beschreibt die Forschungsmethodik, die bei der Untersuchung der Wiedergabefähigkeit von Geschichten bei Kindern angewendet wurde. Das Kapitel III "Ergebnisse" präsentiert die Ergebnisse der Studie, die Aufschluss über die Wiedergabefähigkeit von Geschichten bei Kindern geben. Das Kapitel IV "Diskussion der Ergebnisse" analysiert die Ergebnisse und interpretiert die Ergebnisse im Kontext der zugrundeliegenden Theorie.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Schlüsselbegriffen Textverstehen, Textgedächtnis, Sprachentwicklung, Kinder, Wiedergabefähigkeit, Mikrostruktur, Makrostruktur, Kintsch, Situationsmodell, Textbasis, Konstruktions-Integrations-Modell.
Wie geben Kinder im Grundschulalter Geschichten wieder?
Kinder zwischen sieben und zehn Jahren nutzen mentale Repräsentationen, um Geschichten zu speichern. Die Wiedergabe erfolgt direkt nach dem Hören meist detaillierter, während nach zwei Stunden vor allem die Makrostruktur (Kernpunkte) erhalten bleibt.
Was ist das Situationsmodell nach Kintsch?
Das Situationsmodell ist die psychologisch realisierte Bedeutungsvorstellung eines Textes. Es verknüpft die Textinformationen mit dem Vorwissen des Kindes und bildet so ein tieferes Verständnis dessen ab, worüber der Text berichtet.
Was unterscheidet Mikrostruktur und Makrostruktur eines Textes?
Die Mikrostruktur besteht aus den elementaren Einzelinformationen (Propositionen) eines Textes. Die Makrostruktur ist die hierarchisch übergeordnete Struktur, die das Wesentliche und den Gesamtzusammenhang zusammenfasst.
Welchen Einfluss hat der Sprachentwicklungsstand auf das Textgedächtnis?
Kinder mit einem fortgeschrittenen Sprachentwicklungsstand verfügen oft über bessere Enkodierungsstrategien. Dies ermöglicht es ihnen, Texte effizienter in das Langzeitgedächtnis zu übertragen und präziser wiederzugeben.
Warum ist Vorwissen beim Textverstehen so wichtig?
Verstehen ist ein wissensintensiver Prozess. Nur wenn Kinder neue Informationen an bestehende Wissensstrukturen anknüpfen können, entsteht ein kohärentes Situationsmodell, das eine langfristige Erinnerung ermöglicht.
Wie funktioniert das Konstruktions-Integrations-Modell?
Dieses Modell von Kintsch beschreibt, wie aus Textaussagen Bedeutungseinheiten konstruiert und anschließend in das vorhandene Wissen integriert werden, um eine stabile mentale Repräsentation (Textbasis) zu bilden.