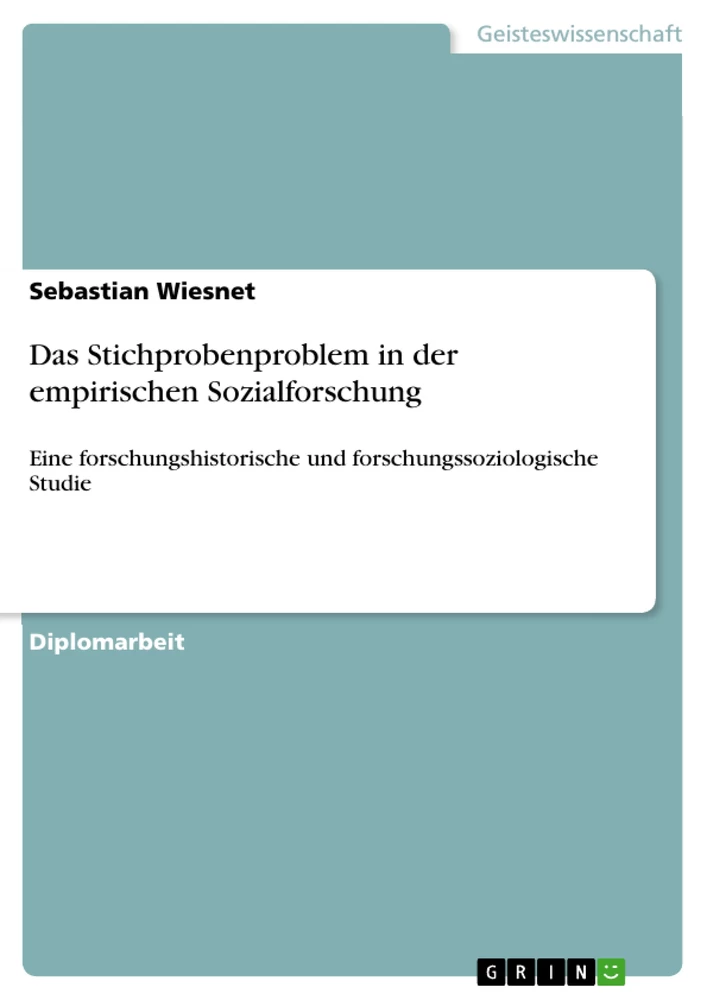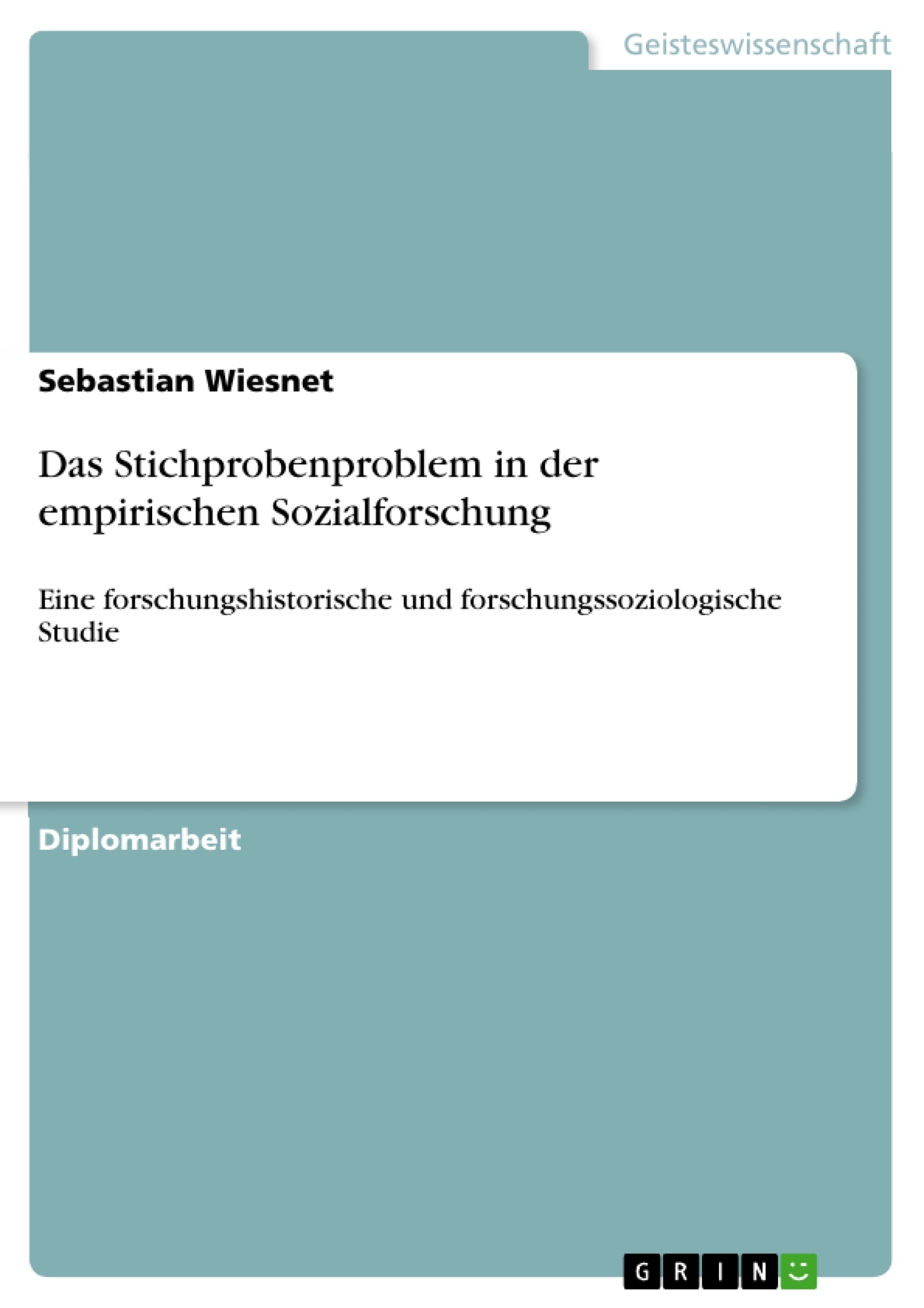„Eine repräsentative Umfrage im Auftrag von Reader’s Digest bringt es an den Tag: 33 Millionen Deutsche glauben an Außerirdische“ – befragt wurden 1000 Deutsche ab 14 Jahren.
Eine solche oder ähnliche Meldung ist jedem bekannt. Die Prozesse und Schwierigkeiten, die dahinter stehen, jedoch nicht. Die folgende Arbeit soll Licht ins Dunkel bringen, indem sie das Stichprobenproblem untersucht, wie es sich bei allgemeinen Bevölkerungsumfragen in der empirischen Sozialforschung stellt.
Die hierbei eingenommene Perspektive ist sowohl forschungssoziologischer als auch forschungshistorischer Art. Forschungssoziologisch insofern, da das Stichprobenproblem und der Umgang mit ihm vor dem Hintergrund der wissenschaftlichen Prinzipien der Wahrheitsfindung betrachtet werden. Ziel dieses Vorgehens ist es, den gegenwärtigen „state of the art“ der empirischen Sozialforschung im Allgemeinen und der akademischen Sozialforschung im Besonderen kritisch zu hinterfragen, Schwachstellen zu identifizieren und Lösungsvorschläge zu unterbreiten.
Die forschungshistorische Sichtweise erfüllt dabei eine doppelte Zweckmäßigkeit. Zum einen soll sie das Verständnis des gegenwärtigen Status quo fördern und zum anderen soll sie dazu beitragen, die Entwicklungstendenzen der aktuellen Wissenschaftspraxis abschätzen zu können.
Um dem soeben dargestellten Forschungsanliegen nachgehen zu können, werden zunächst die theoretischen Grundlagen geschaffen, indem die Grundprinzipien der Wissenschaft skizziert (Kap. 1) und das Konzept der Zufallsstichprobe erläutert werden (Kap. 2). Ein Abriss über die Genese der Datenerhebungsverfahren und ihrer Besonderheiten (Kap. 3) ist erforderlich für das Verständnis der Entwicklung der mit den Datenerhebungsformen verbundenen Stichprobentechniken und deren spezifischer Probleme (Kap. 4). Vor diesem Hintergrund werden die Schwierigkeiten bei der (Beurteilung der) Stichprobenrealisierung (Kap. 5) und anschließend der wissenschaftliche Umgang mit ihnen (Kap. 6) kritisch reflektiert. Auf Basis der somit erlangten Ergebnisse werden das Konzept der „repräsentativen Zufallsstichprobe“ hinterfragt (Kap. 7) und schließlich die Wissenschaftspraxis bezüglich der Umsetzung ihrer eigenen Ideale beurteilt (Kap. 8).
Inhaltsverzeichnis
- Die Prinzipien der Wissenschaft
- Die Zufallsstichprobe in Theorie und Praxis
- Das Grundprinzip der Zufallsstichprobe
- Das Stichprobenproblem
- Ausfalltypen und ihre Auswirkungen
- Zwischenfazit
- Pluralisierung der Datenerhebungsverfahren
- Entwicklung und Bedeutung der verschiedenen Datenerhebungsverfahren
- Relevante Spezifika der einzelnen Verfahren
- Die Entwicklung der Stichprobentechniken – Einhaltung des Zufalls?
- Zufallsstichprobe auf Basis von Einwohnermeldeamtsregistern
- ADM-Design: Address-Random, Random-Route und Standard-Random
- Stichprobentechniken bei Telefonbefragungen
- Listenbasierte Stichprobenbildung
- RDD und RLD
- Das Gabler-Häder Design
- Onlinestichproben
- Zwischenfazit
- Das Problem der Stichprobenrealisierung – Rückgang der Ausschöpfung?
- Internationale Befunde
- Befunde für Deutschland
- Mangelnde Vergleichbarkeit von Ausschöpfungsquoten
- Mangelnde Aussagekraft von Ausschöpfungsquoten
- Entwicklung von Nonresponse am Beispiel des ALLBUS
- Zwischenfazit
- Die Antworten der Wissenschaft
- Umgang mit den Problemen durch die Stichprobentechnik
- Umgang mit dem Nonresponse-Problem
- Maßnahmen zur Erhöhung der Ausschöpfung
- Empfohlene Maßnahmen zur Erhöhung der Ausschöpfung
- Die (Umsetzung der) Maßnahmen in der Kritik
- Nachträgliche Kontrolle und Korrektur
- Gewichtung
- Sonstige Maßnahmen
- Maßnahmen zur Erhöhung der Ausschöpfung
- Zwischenfazit
- Repräsentative Zufallsstichprobe?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Stichprobenproblem in der empirischen Sozialforschung aus forschungssoziologischer und forschungshistorischer Perspektive. Ziel ist die kritische Hinterfragung des aktuellen Forschungsstands, die Identifizierung von Schwachstellen und die Entwicklung von Lösungsansätzen. Die Arbeit analysiert die Entwicklung der Stichprobentechniken im Kontext verschiedener Datenerhebungsmethoden und bewertet deren Auswirkungen auf die Repräsentativität von Ergebnissen.
- Grundprinzipien der Wissenschaft und deren Anwendung in der empirischen Sozialforschung
- Entwicklung und Herausforderungen der Stichprobentechniken
- Problematik der Stichprobenrealisierung und des Nonresponse
- Wissenschaftlicher Umgang mit den Problemen der Stichprobenziehung
- Kritische Bewertung des Konzepts der repräsentativen Zufallsstichprobe
Zusammenfassung der Kapitel
Die Prinzipien der Wissenschaft: Dieses Kapitel legt die theoretischen Grundlagen der Arbeit dar, indem es die drei grundlegenden Prinzipien der Wissenschaft – Wissensvorsprung, Reflexivität und Intersubjektivität – erläutert. Es wird betont, dass die Wissenschaft das Streben nach Wahrheit zum Ziel hat und die Einhaltung dieser Prinzipien essentiell für die Annäherung an diese Wahrheit ist. Die Arbeit beleuchtet den Anspruch der Wissenschaft auf Wissensvorsprung und die Notwendigkeit von Reflexivität und Intersubjektivität im Forschungsprozess. Die soziale Organisation der Wissenschaft wird als sowohl förderlich als auch hemmend für die Erkenntnisgewinnung beschrieben, wobei soziale und ökonomische Faktoren die wissenschaftliche Rationalität beeinflussen können.
Die Zufallsstichprobe in Theorie und Praxis: Dieses Kapitel behandelt das Konzept der Zufallsstichprobe. Es definiert das Grundprinzip und analysiert das damit verbundene Stichprobenproblem, verschiedene Ausfalltypen und deren Auswirkungen auf die Ergebnisse. Die Diskussion beleuchtet die idealtypische Vorstellung der Zufallsstichprobe und die Herausforderungen ihrer Umsetzung in der Praxis. Das Zwischenfazit dieses Kapitels dürfte die Diskrepanz zwischen Theorie und Praxis der Zufallsstichprobe hervorheben.
Pluralisierung der Datenerhebungsverfahren: Hier wird die Entwicklung und Bedeutung verschiedener Datenerhebungsverfahren im Laufe der Zeit dargestellt. Das Kapitel analysiert die spezifischen Merkmale der einzelnen Verfahren und deren Einfluss auf die Stichprobengewinnung und -auswahl. Der Fokus liegt auf der Vielfalt an Methoden und ihrer jeweiligen Eignung für verschiedene Forschungsfragen sowie den damit einhergehenden methodischen Herausforderungen.
Die Entwicklung der Stichprobentechniken – Einhaltung des Zufalls?: Dieses Kapitel befasst sich mit der historischen Entwicklung von Stichprobentechniken im Zusammenhang mit verschiedenen Datenerhebungsmethoden (z.B. Einwohnermeldeamtsregister, ADM-Design, Telefonbefragungen, Online-Stichproben). Es wird untersucht, inwieweit der Zufall bei der Stichprobenziehung tatsächlich eingehalten wird und welche Herausforderungen und systematischen Verzerrungen dabei auftreten können. Das Kapitel analysiert verschiedene Methoden der Stichprobenziehung und deren jeweilige Stärken und Schwächen hinsichtlich der Einhaltung des Zufallsprinzips.
Das Problem der Stichprobenrealisierung – Rückgang der Ausschöpfung?: Dieses Kapitel analysiert die Schwierigkeiten bei der Realisierung von Stichproben, insbesondere den Rückgang der Ausschöpfungsquoten. Es präsentiert internationale und deutsche Befunde, diskutiert die mangelnde Vergleichbarkeit und Aussagekraft von Ausschöpfungsquoten und untersucht die Entwicklung des Nonresponse-Problems am Beispiel des ALLBUS. Der Fokus liegt auf den Ursachen für sinkende Rücklaufquoten und den Konsequenzen für die Validität der Forschungsergebnisse.
Die Antworten der Wissenschaft: Das Kapitel beleuchtet die Strategien der Wissenschaft, um mit den Problemen der Stichprobentechnik und des Nonresponse umzugehen. Es werden verschiedene Ansätze zur Erhöhung der Ausschöpfungsquoten und zur nachträglichen Kontrolle und Korrektur von Verzerrungen, wie beispielsweise die Gewichtung, diskutiert. Die Kapitel analysiert kritisch die Wirksamkeit und die Grenzen dieser Maßnahmen.
Schlüsselwörter
Stichprobenproblem, empirische Sozialforschung, Zufallsstichprobe, Datenerhebungsverfahren, Nonresponse, Ausschöpfungsquote, Repräsentativität, Forschungsmethoden, Wissenschaftsgeschichte, Wissenschaftssoziologie, Gewichtung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Stichprobenproblem in der empirischen Sozialforschung
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht das Stichprobenproblem in der empirischen Sozialforschung aus forschungssoziologischer und forschungshistorischer Perspektive. Ziel ist die kritische Hinterfragung des aktuellen Forschungsstands, die Identifizierung von Schwachstellen und die Entwicklung von Lösungsansätzen. Die Arbeit analysiert die Entwicklung der Stichprobentechniken im Kontext verschiedener Datenerhebungsmethoden und bewertet deren Auswirkungen auf die Repräsentativität von Ergebnissen.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Prinzipien der Wissenschaft, die Zufallsstichprobe in Theorie und Praxis (inklusive des Stichprobenproblems und Ausfalltypen), die Pluralisierung der Datenerhebungsverfahren, die Entwicklung der Stichprobentechniken (mit Fokus auf die Einhaltung des Zufalls bei verschiedenen Methoden wie Einwohnermeldeamtsregistern, ADM-Design, Telefonbefragungen und Onlinestichproben), das Problem der Stichprobenrealisierung und den Rückgang der Ausschöpfungsquoten, sowie die wissenschaftlichen Lösungsansätze für diese Probleme (z.B. Maßnahmen zur Erhöhung der Ausschöpfungsquote und Gewichtung). Schließlich wird das Konzept der repräsentativen Zufallsstichprobe kritisch bewertet.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Die Prinzipien der Wissenschaft; Die Zufallsstichprobe in Theorie und Praxis; Pluralisierung der Datenerhebungsverfahren; Die Entwicklung der Stichprobentechniken – Einhaltung des Zufalls?; Das Problem der Stichprobenrealisierung – Rückgang der Ausschöpfung?; Die Antworten der Wissenschaft; Repräsentative Zufallsstichprobe?
Wie werden die Prinzipien der Wissenschaft behandelt?
Das Kapitel "Die Prinzipien der Wissenschaft" erläutert die drei grundlegenden Prinzipien – Wissensvorsprung, Reflexivität und Intersubjektivität – und deren Bedeutung für die Annäherung an die Wahrheit in der Wissenschaft. Es beleuchtet den Anspruch der Wissenschaft auf Wissensvorsprung und die Notwendigkeit von Reflexivität und Intersubjektivität im Forschungsprozess. Die soziale Organisation der Wissenschaft wird als sowohl förderlich als auch hemmend für die Erkenntnisgewinnung beschrieben.
Was wird im Kapitel zur Zufallsstichprobe behandelt?
Das Kapitel "Die Zufallsstichprobe in Theorie und Praxis" definiert das Grundprinzip der Zufallsstichprobe und analysiert das damit verbundene Stichprobenproblem, verschiedene Ausfalltypen und deren Auswirkungen. Es wird die Diskrepanz zwischen der idealtypischen Vorstellung und der praktischen Umsetzung der Zufallsstichprobe hervorgehoben.
Wie wird die Pluralisierung der Datenerhebungsverfahren dargestellt?
Das Kapitel "Pluralisierung der Datenerhebungsverfahren" zeigt die Entwicklung und Bedeutung verschiedener Datenerhebungsverfahren auf und analysiert deren spezifische Merkmale und Einfluss auf die Stichprobengewinnung. Der Fokus liegt auf der Vielfalt an Methoden und deren Eignung für verschiedene Forschungsfragen.
Welche Stichprobentechniken werden untersucht?
Das Kapitel "Die Entwicklung der Stichprobentechniken – Einhaltung des Zufalls?" untersucht die historische Entwicklung von Stichprobentechniken im Zusammenhang mit verschiedenen Datenerhebungsmethoden (Einwohnermeldeamtsregister, ADM-Design, Telefonbefragungen, Online-Stichproben) und analysiert, inwieweit der Zufall bei der Stichprobenziehung eingehalten wird.
Wie wird das Problem des Rückgangs der Ausschöpfungsquoten behandelt?
Das Kapitel "Das Problem der Stichprobenrealisierung – Rückgang der Ausschöpfung?" analysiert die Schwierigkeiten bei der Realisierung von Stichproben und den Rückgang der Ausschöpfungsquoten. Es präsentiert internationale und deutsche Befunde und diskutiert die mangelnde Vergleichbarkeit und Aussagekraft von Ausschöpfungsquoten sowie die Entwicklung des Nonresponse-Problems am Beispiel des ALLBUS.
Welche Lösungsansätze für die Probleme der Stichprobenziehung werden vorgestellt?
Das Kapitel "Die Antworten der Wissenschaft" beleuchtet Strategien der Wissenschaft zum Umgang mit Problemen der Stichprobentechnik und des Nonresponse. Es diskutiert Ansätze zur Erhöhung der Ausschöpfungsquoten und zur nachträglichen Kontrolle und Korrektur von Verzerrungen (z.B. Gewichtung).
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Stichprobenproblem, empirische Sozialforschung, Zufallsstichprobe, Datenerhebungsverfahren, Nonresponse, Ausschöpfungsquote, Repräsentativität, Forschungsmethoden, Wissenschaftsgeschichte, Wissenschaftssoziologie, Gewichtung.
- Quote paper
- Sebastian Wiesnet (Author), 2007, Das Stichprobenproblem in der empirischen Sozialforschung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/87443