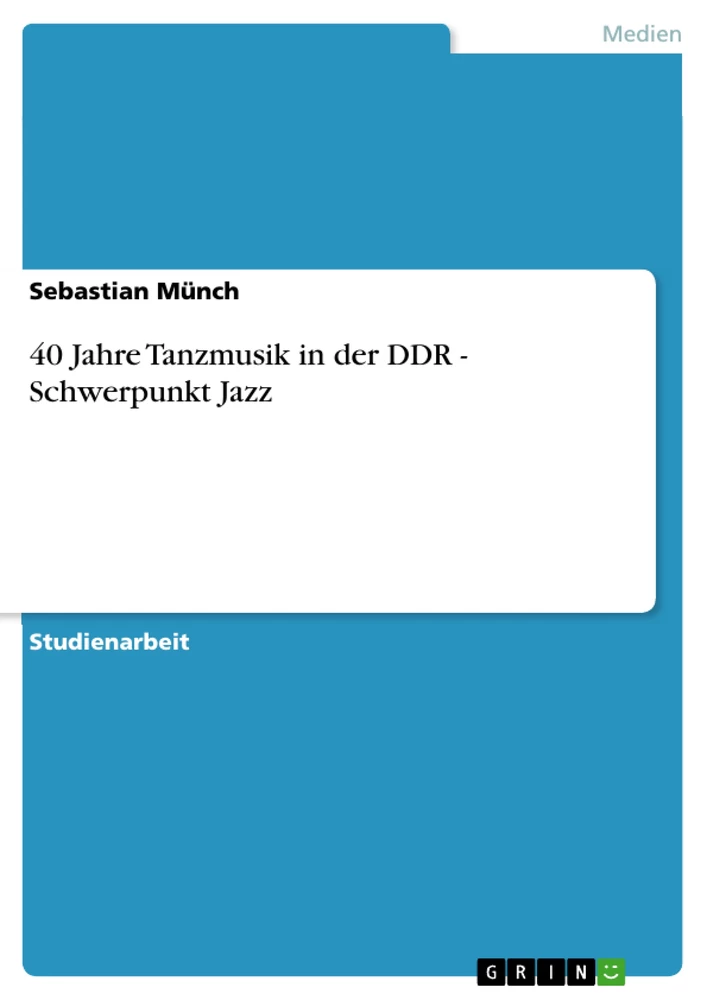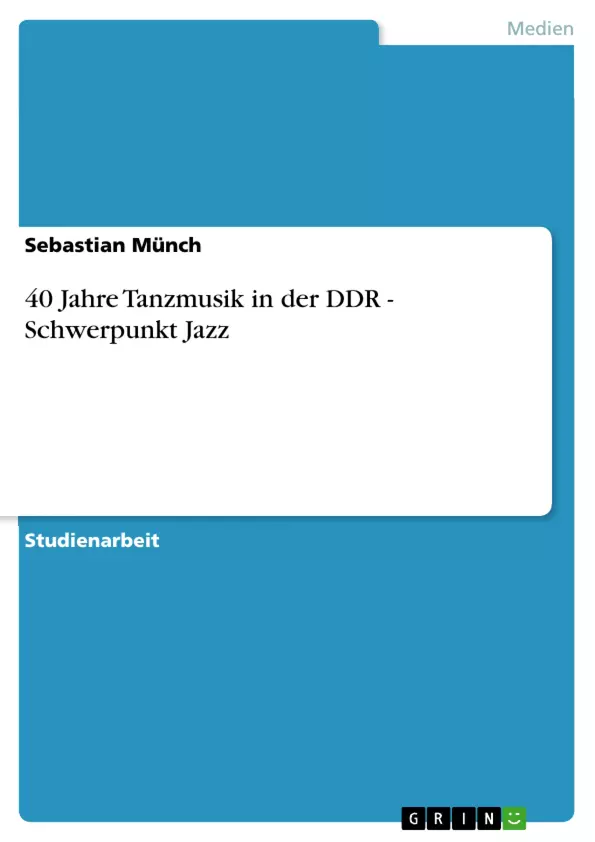Was war und wer repräsentierte Tanzmusik in der DDR? Gab es sie überhaupt – vor allem: gab es den DDR-Jazz? Und wenn ja, wie wurde er gespielt? – Dies sind einleitend nur drei kurze Fragen, mit denen man einen schier endlosen Fragenkatalog beginnen könnte, der es sich zur Aufgabe macht, die Tanzmusik, speziell den Jazz, in der DDR näher zu untersuchen. Aber bei aller Fülle der möglichen Fragen steht doch eine an oberster Stelle: „Hat es in der DDR überhaupt Jazz gegeben?“ Und ebenso schnell wie einem Unwissendem die Frage einfällt, kommt seitens der Fachkundigen und Künstler prompt die Antwort: „Ja, hat es. Und wie!“
Aber wie sah dieser Jazz im „[…] gut isolierten Gewächshaus […]“ DDR genauer aus? Was waren die beliebtesten Strömungen und Bands und besonders: Welche Stellung hatte der Jazz innerhalb der Kulturpolitik der DDR?
Rainer Bratfisch fasst die vierzig Jahre Jazzgeschichte in seinem Buch „Freie Töne – Die Jazzszene in der DDR“ wie folgt zusammen:
„Die Position des Jazz schwankte immer zwischen strikter Ablehnung und leiser Anerkennung, mehr oder weniger offener Verfolgung und verschämter Duldung, offener Antipathie und heimlicher Sympathie. […] Trotzdem wurde der Jazz in der DDR nie zum DDR-Jazz. Seine weltweite Reputation insbesondere in den siebziger und achtziger Jahren erspielte er sich durch die tagtägliche Auseinandersetzung mit einer restriktiven Kulturpolitik, die den Jazz, nachdem Verbote in den fünfziger Jahren nicht griffen, in den sechziger Jahren duldete, um dann in den letzten beiden DDR-Jahrzehnten zu versuchen, ihn zu vereinnahmen. Was nicht zu verbieten war, wurde schließlich staatlich gefördert – in Verkennung der Tatsache, dass Jazz a priori Protestmusik ist und in seinen besten Beispielen vom Affront gegen jedes Establishment lebt.“
Inhaltsverzeichnis
- Intro
- Main Theme
- Die Jahre 1945 bis 1950 – eine Spurensuche
- Berlin und das Radio Berlin Tanzorchester
- Leipzig und Kurt Henkels
- Erste Jazzsendungen im Radio
- Die 50er Jahre – ein ewiges Hin und Her…
- Das Ende vieler Orchester
- „Die wissen auch nicht, was sie wollen!“
- Kurzes Tauwetter
- „Kampf der Dekadenz!“
- Die 60er Jahre – die Szene etabliert sich…
- Ambivalente Kulturpolitik und freieres Spiel
- Das Ende der großen Tanzorchester
- „Jazz und Lyrik“ & „Lyrik – Jazz – Prosa“
- Andere Veranstaltungsreihen
- Die 70er Jahre - der DDR-Jazz wird international
- Lockerung in der Kulturpolitik – „Jazzland DDR“
- Die Hochzeit des Free Jazz - Jazzwerkstatt Peitz
- Die 80er Jahre – „Konsolidierung vor dem Absturz“
- Neue Wege
- „Eldenaer Jazz Evenings“ - Das Jazzfestival an der Küste
- Die Jahre 1945 bis 1950 – eine Spurensuche
- Bridge
- Coda
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit verfolgt das Ziel, einen umfassenden Überblick über die Entwicklung der Tanzmusik in der DDR über vier Jahrzehnte, mit besonderem Schwerpunkt auf Jazz, zu geben. Die Arbeit untersucht die historischen und chronologischen Abläufe der einzelnen Jahrzehnte, beleuchtet die Besonderheiten des Musiklebens und analysiert den Einfluss der Kulturpolitik.
- Entwicklung des Jazz in der DDR von 1945 bis 1989
- Einfluss der Kulturpolitik auf die Jazzszene
- Bedeutung wichtiger Orchester und Musiker
- Popularität und Verbreitung von Jazz in der DDR
- Stilistische Entwicklungen und Einflüsse im DDR-Jazz
Zusammenfassung der Kapitel
Intro: Die Einleitung stellt die zentrale Forschungsfrage nach der Existenz und Ausprägung von Jazz in der DDR. Sie skizziert die Bandbreite der zu untersuchenden Aspekte, von der Popularität bis zur staatlichen Regulierung, und zitiert Rainer Bratfisch' Charakterisierung des Jazz in der DDR als einen ständigen Spagat zwischen Verbot und Duldung, Ablehnung und Anerkennung.
Main Theme: Die Jahre 1945 bis 1950 - eine Spurensuche: Dieses Kapitel untersucht die Anfänge des Jazz in der unmittelbaren Nachkriegszeit. Es beschreibt die Nutzung des Interesses der Bevölkerung an Tanzmusik durch die sowjetische Besatzungsmacht zur Etablierung einer neuen Kulturszene. Die Gründung des Radio Berlin Tanzorchesters und des Hot Club Berlin markieren wichtige Schritte in der Entwicklung der Jazzszene. Die frühen Aufnahmen des RBT unter dem Label Amiga und die Jam Sessions im Hot Club Berlin unterstreichen die schnelle Entwicklung einer eigenständigen Jazzszene in Berlin.
Main Theme: Die 50er Jahre – ein ewiges Hin und Her…: Das Kapitel beleuchtet die widersprüchliche Haltung der DDR-Regierung gegenüber Jazz in den 1950er Jahren, die zwischen Verbot und Duldung schwankte. Es beschreibt das Auf und Ab der Orchester und die Schwierigkeiten, die der Jazz in einem politisch komplexen Umfeld zu bewältigen hatte. Der Kampf zwischen staatlicher Kontrolle und dem künstlerischen Ausdruck der Musiker wird herausgestellt.
Main Theme: Die 60er Jahre – die Szene etabliert sich…: Dieses Kapitel beschreibt die zunehmende Etablierung der Jazzszene in den 60er Jahren, trotz anhaltender ambivalenter Kulturpolitik. Es zeigt eine Lockerung der staatlichen Kontrolle und ein freieres künstlerisches Schaffen. Die Entwicklung verschiedener Veranstaltungsreihen, wie „Jazz und Lyrik“, und der Rückgang der großen Tanzorchester werden beleuchtet.
Main Theme: Die 70er Jahre - der DDR-Jazz wird international: Das Kapitel behandelt die internationale Anerkennung des DDR-Jazz in den 1970ern. Die Lockerung der Kulturpolitik und die Entstehung von „Jazzland DDR“ werden als wichtige Faktoren für diese Entwicklung genannt. Die besondere Bedeutung der Jazzwerkstatt Peitz für die Free-Jazz-Szene wird hervorgehoben.
Main Theme: Die 80er Jahre – „Konsolidierung vor dem Absturz“: Das Kapitel befasst sich mit den 1980er Jahren und beschreibt neue Wege und Entwicklungen innerhalb der Jazzszene der DDR, kurz vor dem Ende des Staates. Die „Eldenaer Jazz Evenings“ werden als Beispiel für das Fortbestehen und die Weiterentwicklung der Szene erwähnt.
Bridge: [Kapitelzusammenfassung fehlt, da keine Information im Ausgangstext vorhanden ist]
Coda: [Kapitelzusammenfassung fehlt, da keine Information im Ausgangstext vorhanden ist]
Schlüsselwörter
DDR-Jazz, Tanzmusik, Kulturpolitik, Radio Berlin Tanzorchester, Jazzwerkstatt Peitz, Free Jazz, Bigband, Swing, AMIGA, Helmut Zacharias, Kurt Henkels, Rolf Kühn, staatliche Regulierung, musikalische Entwicklung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Entwicklung des DDR-Jazz
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Hausarbeit analysiert die Entwicklung der Tanzmusik, insbesondere des Jazz, in der DDR von 1945 bis 1989. Sie untersucht die historischen Abläufe, die Besonderheiten des Musiklebens und den Einfluss der Kulturpolitik auf die Jazzszene.
Welche Zeiträume werden behandelt?
Die Arbeit deckt vier Jahrzehnte ab: die 1940er, 1950er, 1960er, 1970er und 1980er Jahre. Jedes Jahrzehnt wird separat betrachtet und seine spezifischen Entwicklungen im DDR-Jazz beleuchtet.
Welche Themen werden im Detail behandelt?
Die Arbeit untersucht die Entwicklung des Jazz in der DDR, den Einfluss der Kulturpolitik auf die Jazzszene, die Bedeutung wichtiger Orchester und Musiker, die Popularität und Verbreitung von Jazz in der DDR sowie stilistische Entwicklungen und Einflüsse im DDR-Jazz.
Welche Schlüsselereignisse und Organisationen werden hervorgehoben?
Die Arbeit erwähnt die Gründung des Radio Berlin Tanzorchesters und des Hot Club Berlin, die widersprüchliche Kulturpolitik der 50er Jahre, die Etablierung der Jazzszene in den 60ern mit Veranstaltungen wie „Jazz und Lyrik“, die internationale Anerkennung des DDR-Jazz in den 70ern (inkl. „Jazzland DDR“ und Jazzwerkstatt Peitz) und die Entwicklungen der 80er Jahre, einschliesslich der „Eldenaer Jazz Evenings“.
Welche wichtigen Musiker oder Orchester werden genannt?
Die Arbeit nennt das Radio Berlin Tanzorchester, den Hot Club Berlin und die Jazzwerkstatt Peitz. Einzelne Musiker wie Helmut Zacharias, Kurt Henkels und Rolf Kühn werden ebenfalls erwähnt, jedoch nicht im Detail behandelt.
Wie wird der Einfluss der Kulturpolitik dargestellt?
Die Arbeit beschreibt die oft widersprüchliche Haltung der DDR-Regierung gegenüber Jazz, schwankend zwischen Verbot und Duldung. Sie analysiert, wie diese Politik die Entwicklung der Jazzszene beeinflusst und die Musiker herausgefordert hat.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung (Intro), einen Hauptteil (Main Theme) mit Kapiteln zu jedem Jahrzehnt (40er bis 80er Jahre), eine Brücke (Bridge) und einen Schluss (Coda). Die Kapitel "Bridge" und "Coda" enthalten im vorliegenden Auszug keine Zusammenfassung.
Welche Schlussfolgerung zieht die Arbeit (implizit)?
Die Arbeit legt nahe, dass der Jazz in der DDR trotz der schwierigen politischen Bedingungen eine eigenständige und dynamische Entwicklung durchlaufen hat, gekennzeichnet durch einen ständigen Spagat zwischen staatlicher Kontrolle und künstlerischer Freiheit.
Wo finde ich weitere Informationen?
Der Text nennt das Label Amiga als Quelle für frühe Aufnahmen des Radio Berlin Tanzorchesters. Weitere Informationen könnten in Archiven, Fachliteratur und Musikhistorischen Datenbanken gefunden werden.
- Quote paper
- Sebastian Münch (Author), 2007, 40 Jahre Tanzmusik in der DDR - Schwerpunkt Jazz, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/87481