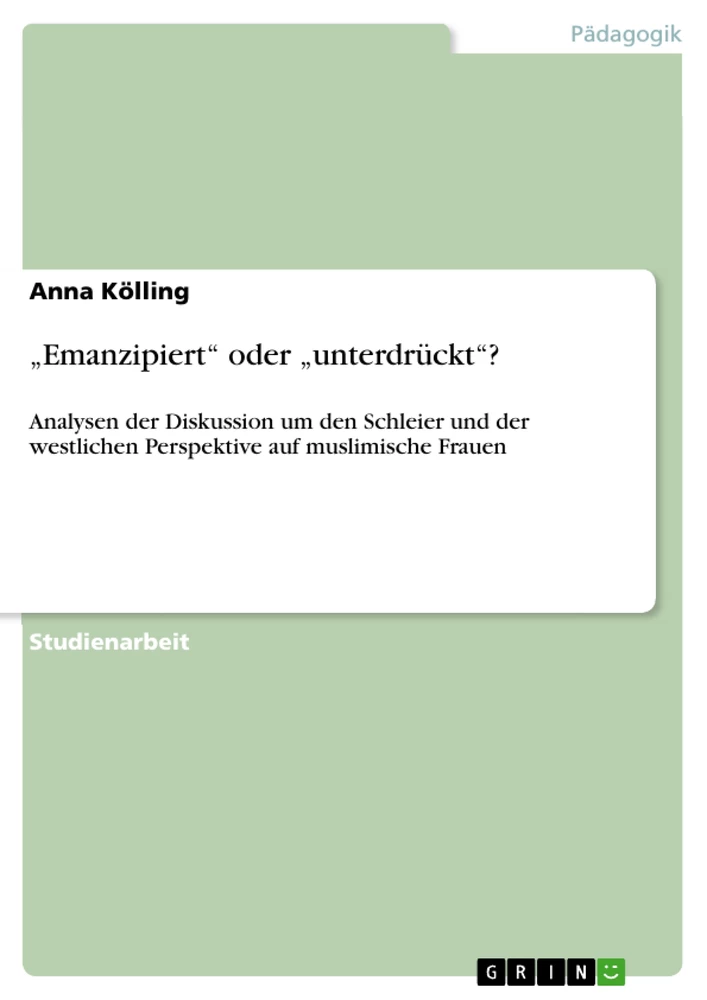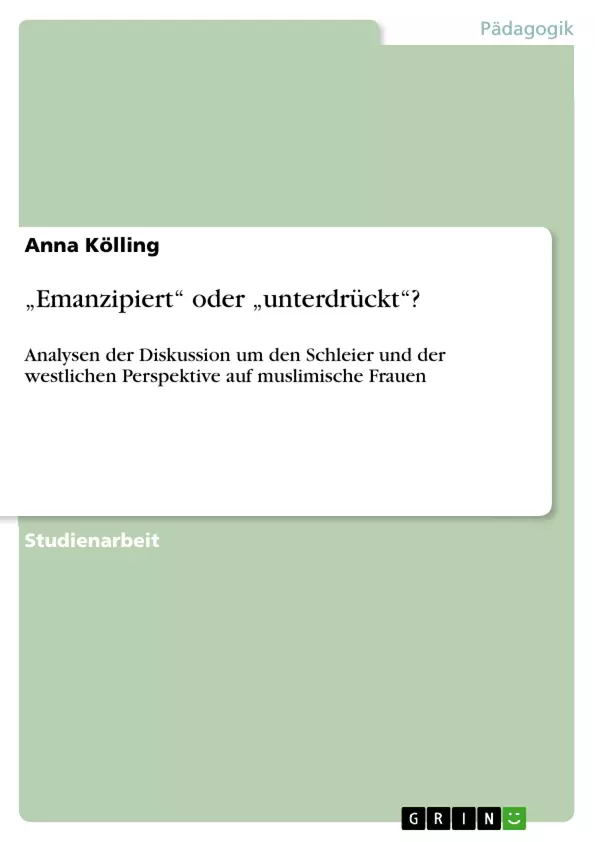Fast vier Jahre ist es her, seit das Bundesverfassungsgericht seine Empfehlung zum Thema Kopftuch im öffentlichen Dienst abgegeben hat.
Meines Erachtens hat sich in den letzten Jahren eine einseitige öffentlich-mediale Darstellung der „Frau im Islam“ entwickelt. Nach wie vor wird mehr über die Muslima geredet als mit ihr. Zumeist kommen Frauen zu Wort denen Gewalt von Seiten muslimischer Männer angetan wurde – und es ist sicherlich wichtig darüber zu berichten. Jedoch widerfährt Frauen in allen Kulturen Gewalt von Seiten der Männer und wir müssen aufpassen, dass die muslimischen Frauen nicht dazu benutzt werden, ein Bild des Islam als einer Gewalt befürwortenden Religion – das in Deutschland nach wie vor verbreitet ist – zu pflegen.
Mein Anliegen in dieser Arbeit besteht darin, erstens einen kritischen Blick auf die „westliche“ Perspektive auf die muslimische Frau zu werfen, die nach wie vor von dem Bild geprägt ist, bei muslimischen Frauen handele es sich um ungebildete, traditionelle Frauen, die befreit oder sogar gerettet werden müssen. Des Weiteren möchte ich den LeserInnen einen Einblick in die unterschiedlichen Lebenswelten und –konzepte muslimischer Frauen verschaffen und diese anhand von Beispielen von Frauen aus Ägypten, der Türkei und aus Deutschland sichtbar machen.
Zu Beginn werde ich den Verlauf des deutschen „Kopftuch-Streits“ nachzeichnen bzw. die verschiedenen Positionen darstellen. Ein wichtiger Aspekt ist dabei die Frage der Säkularisierung und wie viel Platz für Religion in der Schule sein darf.
Der Bedeutung des Schleiers und den divergierenden Vorstellungen in Ost und West über Körper und Sexualität wird der zweite Teil der Arbeit gewidmet. Da in dieser Arbeit der Schleier der muslimischen Frau und die Reaktionen darauf verhandelt werden, wird zuerst die Bedeutung des Schleiers im Kontext islamischer Überlieferung behandelt. Des Weiteren wird versucht werden an Hand der Analyse der westlichen Kritik an „den Muslimen“ aufzudecken, von welchen Sexismen westliche und orientalische Gesellschaften durchzogen sind, die entweder verdrängt werden oder zur Normalität gehören.
Abschließend werden unterschiedliche Lebenskonzepte muslimischer Frauen beleuchtet, die sich aus verschiedensten Gründen für oder gegen ein Kopftuch entschieden haben.
Ich werde dabei versuchen, die Rolle des politischen Islam in der Entscheidungsfindung der Frauen zu erklären.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Die „Kopftuch-Debatte“ – um was geht es eigentlich?
- 2.1 Diskussion um das Kopftuch in der Öffentlichkeit und im öffentlichen Dienst
- 2.2 Frage der Säkularisierung
- 3. Was sagt uns der Schleier?
- 3.1 Der Schleier in der islamischen Überlieferung
- 3.2 Körper und Sexualität
- 3.3 Sexismus - Ost und West
- 4. Emanzipation „auf islamisch“
- 4.1 Familie
- 4.2 Bildung und Identität
- 4.3 Politisierung
- 5. Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht kritisch die westliche Perspektive auf muslimische Frauen, insbesondere im Kontext der Kopftuchdebatte. Sie zielt darauf ab, einseitige mediale Darstellungen zu hinterfragen und die Vielfalt der Lebenskonzepte muslimischer Frauen aufzuzeigen. Die Arbeit berücksichtigt dabei unterschiedliche Perspektiven aus Ägypten, der Türkei und Deutschland.
- Westliche Wahrnehmung muslimischer Frauen und die Kopftuchdebatte
- Die symbolische Bedeutung des Schleiers in verschiedenen kulturellen Kontexten
- Konzepte von Körper, Sexualität und Emanzipation im Islam
- Der Einfluss des politischen Islams auf die Lebensentscheidungen muslimischer Frauen
- Differenzierte Betrachtung von Sexismus in westlichen und orientalischen Gesellschaften
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung beschreibt den Ausgangspunkt der Arbeit – die anhaltende und einseitige öffentliche Debatte um das Kopftuch und die Darstellung muslimischer Frauen in den Medien. Die Autorin kritisiert die Reduktion auf Opferbilder und den Missbrauch des Themas zur Stigmatisierung des Islam. Ihr Ziel ist es, verschiedene Lebensrealitäten muslimischer Frauen zu präsentieren und die westliche Perspektive kritisch zu hinterfragen, die diese Frauen oft als ungebildet und traditionell darstellt, und die sie somit als zu "befreiend" betrachtet. Die Arbeit gliedert sich in verschiedene Abschnitte, die sich mit der Kopftuchdebatte, der Symbolkraft des Schleiers, verschiedenen Lebenskonzepten muslimischer Frauen und dem Einfluss des politischen Islams auseinandersetzen.
2. Die „Kopftuch-Debatte“ – um was geht es eigentlich?: Dieses Kapitel analysiert die deutsche Kopftuchdebatte, insbesondere die Diskussion um das Kopftuch im öffentlichen Dienst und in der Schule. Es werden verschiedene Positionen dargestellt, darunter die Sichtweise des Politikwissenschaftlers Bassam Tibi, der verschiedene Arten von Kopftuchbekleidung unterscheidet. Die Autorin kritisiert die Stigmatisierung des Kopftuchs als „verfassungsfeindliches Symbol“ und die ungeklärte juristische Situation, die durch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts entstand. Der Vergleich des Kopftuchs mit religiösen Symbolen anderer Religionen wird kritisch hinterfragt, ebenso die Frage nach der Verfassungstreue von Lehrkräften und der Bedeutung von Neutralität in der Schule.
3. Was sagt uns der Schleier?: Dieser Abschnitt befasst sich mit der Bedeutung des Schleiers in der islamischen Tradition, wobei unterschiedliche Interpretationen und Perspektiven berücksichtigt werden. Es wird die Rolle des Schleiers in Bezug auf Körper und Sexualität diskutiert und die bestehenden divergierenden Sichtweisen zwischen Ost und West analysiert. Die Autorin beleuchtet dabei auch die Frage des Sexismus, der sowohl westliche als auch orientalische Gesellschaften durchzieht und oft verdrängt oder als Normalität akzeptiert wird. Der Fokus liegt auf der Dekonstruktion der vereinfachenden und oft klischeehaften Vorstellungen über den Schleier und seine Bedeutung für muslimische Frauen.
4. Emanzipation „auf islamisch“: Dieses Kapitel beleuchtet unterschiedliche Lebenskonzepte muslimischer Frauen, die sich aus verschiedenen Gründen für oder gegen das Tragen eines Kopftuchs entscheiden. Die Rolle des politischen Islams in diesen Entscheidungen wird untersucht. Es wird argumentiert, dass der politische Islam nicht nur regressiv sein muss, sondern für manche Frauen auch neue Handlungsspielräume und Identifikationsmuster eröffnen kann, die zu innerislamischen Diskussionen um Frauenrechte und zu Konfrontationen mit patriarchalischen Strukturen führen können.
Schlüsselwörter
Kopftuchdebatte, muslimische Frauen, westliche Perspektive, Schleier, Islam, Emanzipation, Säkularisierung, Körper, Sexualität, Sexismus, Politischer Islam, Identität, Lebenskonzepte, Deutschland, Türkei, Ägypten.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Westliche Wahrnehmung muslimischer Frauen und die Kopftuchdebatte
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht kritisch die westliche Perspektive auf muslimische Frauen, insbesondere im Kontext der Kopftuchdebatte. Sie hinterfragt einseitige mediale Darstellungen und zeigt die Vielfalt der Lebenskonzepte muslimischer Frauen in Ägypten, der Türkei und Deutschland auf.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit befasst sich mit der westlichen Wahrnehmung muslimischer Frauen und der Kopftuchdebatte, der symbolischen Bedeutung des Schleiers, Konzepten von Körper, Sexualität und Emanzipation im Islam, dem Einfluss des politischen Islams auf die Lebensentscheidungen muslimischer Frauen und einer differenzierten Betrachtung von Sexismus in westlichen und orientalischen Gesellschaften.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, Kapitel zur Kopftuchdebatte, zur Bedeutung des Schleiers, zu Konzepten von Emanzipation im Islam und einen Ausblick. Jedes Kapitel bietet eine detaillierte Analyse der jeweiligen Thematik.
Was wird in der Einleitung beschrieben?
Die Einleitung beschreibt die anhaltende und einseitige öffentliche Debatte um das Kopftuch und die Darstellung muslimischer Frauen in den Medien. Die Autorin kritisiert die Reduktion auf Opferbilder und den Missbrauch des Themas zur Stigmatisierung des Islam. Ihr Ziel ist es, verschiedene Lebensrealitäten muslimischer Frauen zu präsentieren und die oft vereinfachende westliche Perspektive kritisch zu hinterfragen.
Worauf konzentriert sich das Kapitel zur „Kopftuch-Debatte“?
Dieses Kapitel analysiert die deutsche Kopftuchdebatte, insbesondere die Diskussion um das Kopftuch im öffentlichen Dienst und in der Schule. Es werden verschiedene Positionen dargestellt und die Stigmatisierung des Kopftuchs sowie die ungeklärte juristische Situation kritisch hinterfragt.
Was ist der Schwerpunkt des Kapitels „Was sagt uns der Schleier?“?
Dieses Kapitel befasst sich mit der Bedeutung des Schleiers in der islamischen Tradition, unterschiedlichen Interpretationen und Perspektiven, der Rolle des Schleiers in Bezug auf Körper und Sexualität und der Analyse divergierender Sichtweisen zwischen Ost und West. Es wird auch die Frage des Sexismus in westlichen und orientalischen Gesellschaften beleuchtet.
Worum geht es im Kapitel „Emanzipation „auf islamisch“?
Dieses Kapitel beleuchtet unterschiedliche Lebenskonzepte muslimischer Frauen und die Rolle des politischen Islams bei deren Entscheidungen. Es wird argumentiert, dass der politische Islam nicht nur regressiv sein muss, sondern für manche Frauen auch neue Handlungsspielräume eröffnen kann.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Kopftuchdebatte, muslimische Frauen, westliche Perspektive, Schleier, Islam, Emanzipation, Säkularisierung, Körper, Sexualität, Sexismus, Politischer Islam, Identität, Lebenskonzepte, Deutschland, Türkei, Ägypten.
- Arbeit zitieren
- Anna Kölling (Autor:in), 2007, „Emanzipiert“ oder „unterdrückt“?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/87487