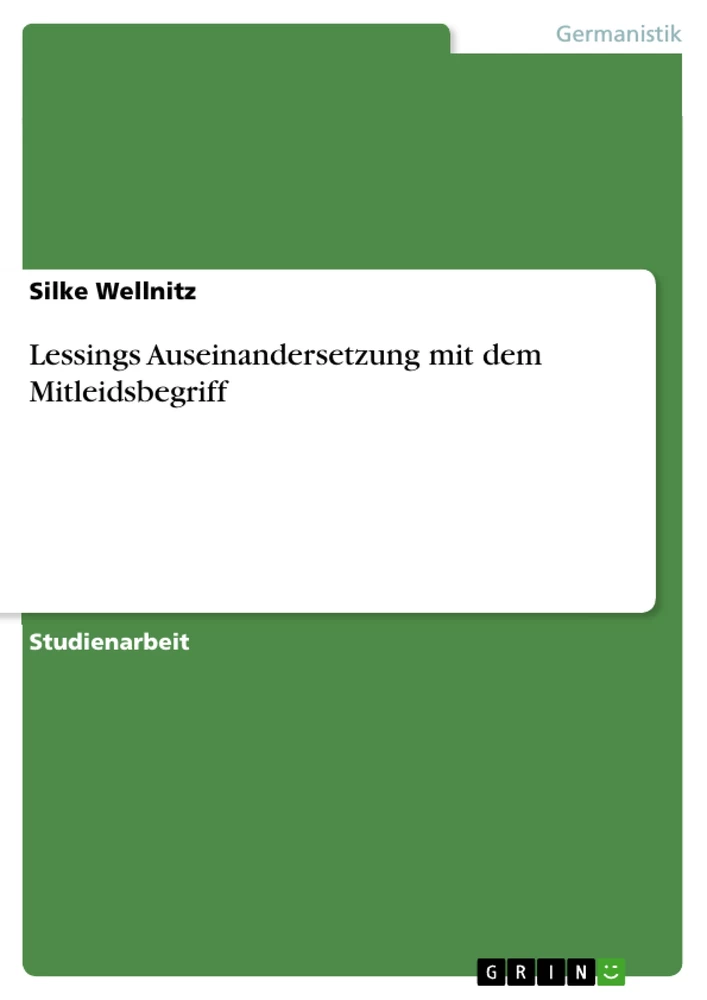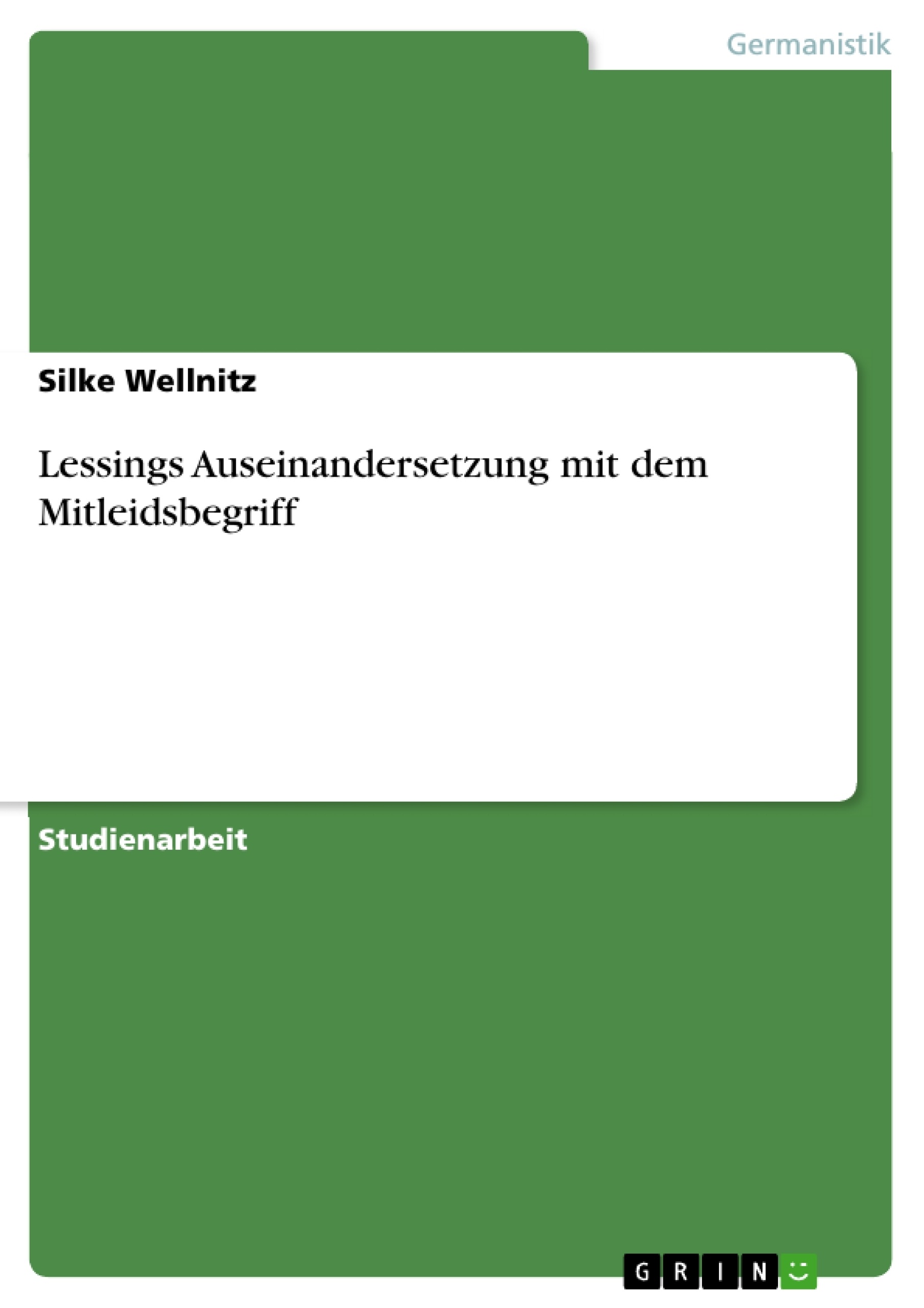Im Laufe der Zeit haben sich Bedeutung und Stellenwert des Mitleids stetig gewandelt, es gab Positionen für und wider das Mitleid. Ich möchte im ersten Kapitel einen kurzen Überblick über verschiedene Deutungsweisen geben, wobei ich in diesem Rahmen nur an der Oberfläche kratzen kann. Der Überblick soll dazu dienen, sich einfacher in die Denksituation Lessings und seiner Zeitgenossen hinein versetzen zu können. Eine eingehende Beschäftigung mit der Affekten- und Erkenntnislehre nach Wolff, Baumgarten oder Leibniz, die in diese Thematik sicherlich mit hineinspielt, muss in dem Rahmen einer Seminararbeit außen vor bleiben.
Ich habe mich für eine chronologische Darstellung entschieden, obwohl sich sicherlich auch eine systematische nach Kategorien wie „pro Affekt“ und „pro Vernunft“ oder ähnliches angeboten hätte. Da ich Lessings Mitleidstheorie und die Rolle in seiner Tragödientheorie als Teil einer Diskussion und Entwicklung verschiedener Standpunkte betrachten möchte, scheint mir die Veranschaulichung der chronologischen Abfolge eine bessere Wahl.
Von der aristotelischen Deutungsweise wird in einem späteren Abschnitt nochmals die Rede sein, wenn ich auf Lessings Auseinandersetzung mit der Trauerspieltheorie des Aristoteles eingehe. Im ersten Kapitel wird sie der Vollständigkeit halber schon angesprochen, aufgrund ihrer Relevanz für Lessing aber dann nochmals im Zusammenhang mit der Tragödientheorie ausführlicher aufgegriffen.
Aspekte wie die von Käte Hamburger in Das Mitleid problematisierte Menschen- und Nächstenliebe konnten im Rahmen einer Seminararbeit leider nicht mit aufgenommen werden.
Dem Mitleidsbegriff bei Rousseau werde ich ein eigenes Kapitel widmen, welches sich – historisch und thematisch – direkt an das vorherige anschließt. Es soll verdeutlicht werden, welches Menschenbild im Discours vorausgesetzt wird und welche Relevanz dem Mitleid in der Gesellschaft zugesprochen wird. So wird es mir möglich sein, den Einfluss auf Lessings Mitleidsbegriff und seine zugedachte Aufgabe in der Tragödie besser einzuschätzen.In dem Absatz über den Briefwechsel über das Trauerspiel aus den Jahren 1756/1757 mit Mendelssohn und Nicolai wird Lessings neuartige Sicht auf die Theorie der Tragödie nachvollziehbar.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Vom Mitleidsbegriff
- Vom Mitleidsbegriff von Platon bis David Hume
- Vom Mitleidsbegriff bei Jean-Jacques Rousseau
- Vom Nutzen des Mitleids in der Tragödie
- Die Kontroverse zwischen Lessing und Mendelssohn über den Mitleidsbegriff Rousseaus
- Briefwechsel mit Mendelssohn und Nicolai über das Trauerspiel
- Lessings Positionierung zum Mitleidsbegriff in der Tragödientheorie von Aristoteles in der Hamburgischen Dramaturgie
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht Lessings Auseinandersetzung mit dem Mitleidsbegriff und dessen Rolle in seiner Tragödientheorie. Sie beleuchtet den Einfluss verschiedener Denker auf Lessings Verständnis von Mitleid, insbesondere Rousseaus Menschenbild im „Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes“. Die Arbeit analysiert auch die Kontroversen zwischen Lessing und seinen Zeitgenossen, wie Mendelssohn und Nicolai, über die Tragödie und den Stellenwert des Mitleids darin.
- Die Entwicklung des Mitleidsbegriffs von der Antike bis zum 18. Jahrhundert
- Der Einfluss von Jean-Jacques Rousseau auf Lessings Mitleidsethik
- Die Rolle des Mitleids in Lessings Tragödientheorie
- Die Debatte über das Trauerspiel und die Tragödie im 18. Jahrhundert
- Lessings Auseinandersetzung mit der aristotelischen Trauerspieltheorie
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik des Mitleidsbegriffs ein und hebt dessen Relevanz für Lessings Tragödientheorie hervor. Das zweite Kapitel beleuchtet die historische Entwicklung des Mitleidsbegriffs von Platon bis David Hume und fokussiert auf die Ansichten von Jean-Jacques Rousseau im „Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes“.
Im dritten Kapitel wird Lessings eigene Sicht auf das Mitleid in der Tragödie untersucht. Es werden die Kontroversen mit Mendelssohn und Nicolai über die Funktion der Tragödie und die Rolle des Mitleids darin analysiert. Der Briefwechsel mit Mendelssohn und Nicolai wird ebenfalls in diesem Kapitel thematisiert, wobei Lessings neuartige Sicht auf die Tragödientheorie im Vordergrund steht.
Das vierte Kapitel befasst sich mit Lessings Positionierung zum Mitleidsbegriff in der Tragödientheorie von Aristoteles, die er in seiner „Hamburgischen Dramaturgie“ darlegt. Die Arbeit konzentriert sich auf die Stücke 74 bis 78, in denen Lessing die aristotelische Tragödientheorie diskutiert und seinen eigenen Standpunkt zum Mitleid präsentiert.
Schlüsselwörter
Mitleid, Tragödie, Trauerspiel, Lessing, Rousseau, Mendelssohn, Nicolai, Aristoteles, „Hamburgische Dramaturgie“, „Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes“, Tragödientheorie, Ethik, Affekte, Vernunft, Menschenbild.
Häufig gestellte Fragen
Welche Rolle spielt Mitleid in Lessings Tragödientheorie?
Für Lessing ist das Mitleid der zentrale Affekt der Tragödie. Er glaubte, dass die Tragödie den Zuschauer moralisch bessern soll, indem sie seine Fähigkeit zum Mitleid übt und verfeinert.
Wie unterschied sich Lessings Mitleidsbegriff von dem des Aristoteles?
Lessing interpretierte Aristoteles neu. Während Aristoteles von 'Furcht und Mitleid' sprach, sah Lessing die Furcht als das Mitleid, das auf uns selbst zurückfällt, wenn wir uns mit dem Leidenden identifizieren.
Welchen Einfluss hatte Rousseau auf Lessing?
Rousseaus Menschenbild, das Mitleid als natürlichen Instinkt und Grundlage der Gesellschaft sieht, beeinflusste Lessings Sicht auf die ethische Funktion des Theaters massiv.
Was war der Kern des Briefwechsels mit Mendelssohn und Nicolai?
Die drei Gelehrten debattierten über das Ziel der Tragödie: Soll sie bewundern (Nicolai), Leidenschaften reinigen (Mendelssohn) oder die Mitleidsfähigkeit maximieren (Lessing)?
Was ist die 'Hamburgische Dramaturgie'?
Es ist eine Sammlung von Rezensionen und theoretischen Abhandlungen Lessings, in denen er seine Dramentheorie entwickelt und das bürgerliche Trauerspiel begründet.
- Quote paper
- Silke Wellnitz (Author), 2005, Lessings Auseinandersetzung mit dem Mitleidsbegriff, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/87550