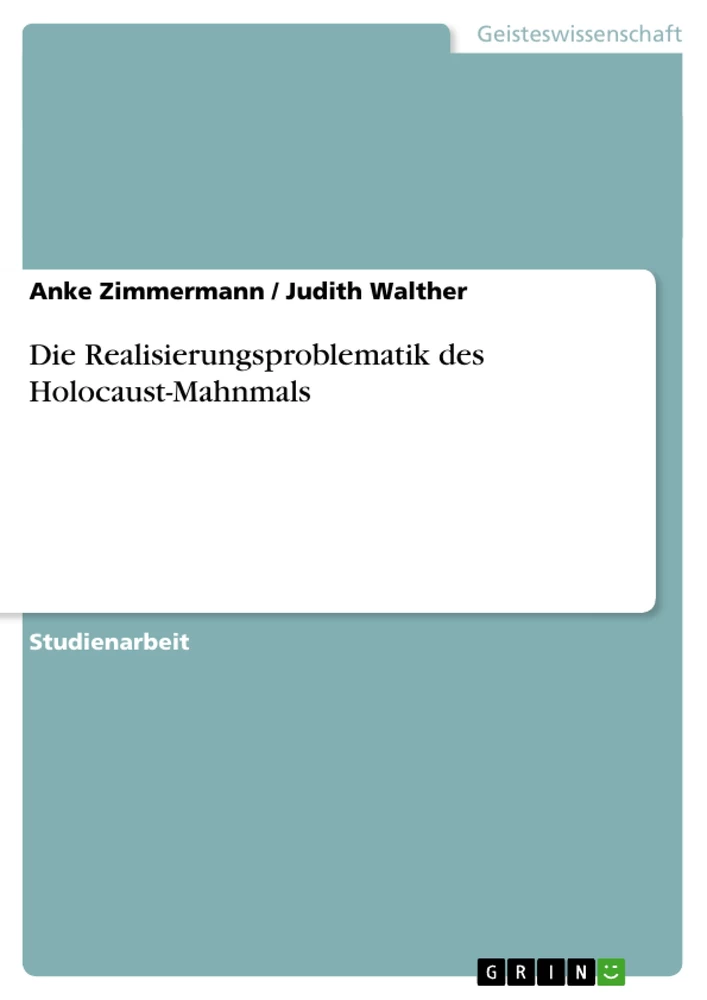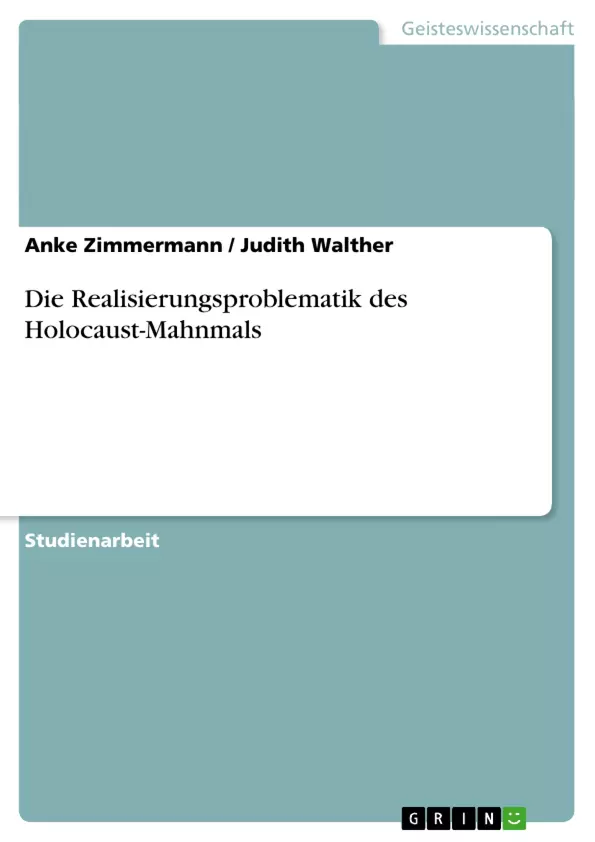„Debatten sind keine Mahnmale, [!] und ein Mahnmal ist kein Diskurs. Wer künftige Generationen an die Ermordung von Millionen europäischer Juden durch Deutsche erinnern will, setzt auf die physische Präsenz und materielle Provokation eines Mahn- oder Denkmals, das den Diskurs eine zeitlang zum Schweigen bringt, um ihn vielleicht gerade dadurch am Leben zu halten.“ (Leggewie/Meyer 2005, S. 9)
Nach einer über zehnjährigen Planungs- und Bauzeit, wurde 2005 das umstrittene und bis zuletzt umkämpfte „Denkmal für die ermordeten europäischen Juden Europas“(vgl. ebd.) in der Bundeshauptstadt Berlin, zwischen Brandenburger Tor und Potsdamer Platz, fertig gestellt (vgl. Haardt 2001, S. 9). Bevor es dazu kam, das Mahnmal physisch präsent machen zu können, sprich, dass man hindurchwandeln oder es berühren kann (vgl. Leggewie/Meyer 2005, S. 9), gab es viele Diskussionen. Diese beschäftigten sich unter anderen damit, ob ein zentrales Denkmal angemessen ist, wem es gewidmet werden soll, welcher Standort als optimal erscheint und welche Gestaltung sinnvoll ist (vgl. Haardt 2001, S. 9). Genau diese Punkte sollen umfangreich in unserer Hausarbeit aufgegriffen werden. Somit ist das zentrale Thema die Realisierungsproblematik und die damit verbundenen Debatten.
In dieser Arbeit soll zunächst ein Denkmal von einem Mahnmal abgegrenzt werden, weil oft die Frage auftaucht, ob die Erinnerung an die ermordeten Juden Europas in Berlin Mitte ein Denkmal oder ein Mahnmal ist. Ein größerer, nächster Gliederungspunkt soll explizit um die Problematik der Realisierung des Mahnmals gehen. Insbesondere wollen wir die Fragen um die Widmung, den Standort und die Gestaltung aufgreifen. Um diese genauer zu betrachten, möchten wir uns den Wettbewerben widmen, wobei das Hauptaugenmerk auf den unterschiedlichen Entwürfen liegt. Weiterhin wird das Interesse auf die Monumentalität des Denkmals gerichtet und auf die Ungewissheit, ob das Mahnmal einen Schlussstrich unter die nationalsozialistische Vergangenheit zieht. Ein nächster Punkt soll von den Argumenten für und gegen das Mahnmal handeln. Hierbei wird der Frage nachgegangen, ob das Holocaust-Mahnmal überhaupt brauchbar ist. Um dies aufzeigen zu können, werden Standpunkte verschiedener Personen aufgegriffen. In einem letzten Gliederungspunkt soll die endgültige Entscheidung des Bundestages dargestellt werden. Hier geht es im Besonderen um die Entscheidung für eine bestimmte Gestaltungsform sowie um den Sinn und Zweck des Mahnmals.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Denkmal oder Mahnmal?
- Problematik der Realisierung
- Widmung
- Standort
- Gestaltung
- Die Wettbewerbe und Entwürfe
- Monumentalität
- (K)ein Schlussstrich?
- Argumente für und gegen das Mahnmal
- Argumente dafür
- Argumente dagegen
- Die endgültige Entscheidung
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit der Realisierungsproblematik des Holocaust-Mahnmals in Berlin. Der Fokus liegt auf den Debatten und Diskussionen, die mit der Entstehung dieses Denkmals einhergingen, und auf den Herausforderungen, die sich bei der Umsetzung eines solchen Projekts stellten. Im Zentrum stehen dabei Fragen der Widmung, des Standorts und der Gestaltung des Mahnmals.
- Abgrenzung zwischen Denkmal und Mahnmal
- Die Problematik der Widmung und der Frage nach der kollektiven Verantwortung Deutschlands für den Massenmord an den Juden
- Der Einfluss von Standort und Gestaltung auf die Funktion des Mahnmals
- Die Argumente für und gegen das Mahnmal sowie die Kritik an dessen Sinnhaftigkeit
- Die Entscheidung für die Gestaltungsform und die Bedeutung des Mahnmals für die Erinnerungskultur
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Einleitung stellt die Problematik der Realisierung des Holocaust-Mahnmals in den Kontext der Debatte um die Erinnerung an die ermordeten Juden Europas in Deutschland.
- Das zweite Kapitel beschäftigt sich mit der Unterscheidung zwischen Denkmal und Mahnmal und untersucht die Frage, inwiefern das Berliner Holocaust-Mahnmal als Denkmal oder als Mahnmal zu verstehen ist.
- Das dritte Kapitel beleuchtet die Herausforderungen der Realisierung, insbesondere die Debatte um die Widmung, den Standort und die Gestaltung des Denkmals. Es analysiert die Wettbewerbe und Entwürfe sowie die Diskussion um die Monumentalität des Mahnmals.
- Das vierte Kapitel befasst sich mit den Argumenten für und gegen das Mahnmal und diskutiert die Kritik an dessen Sinnhaftigkeit und Brauchbarkeit.
- Das fünfte Kapitel schildert die endgültige Entscheidung des Bundestages für die Gestaltungsform des Mahnmals und beleuchtet den Sinn und Zweck des Projekts.
Schlüsselwörter
Holocaust-Mahnmal, Denkmal, Erinnerungskultur, kollektive Verantwortung, Antisemitismus, Judenermordung, Gestaltungsform, Monumentalität, Standort, Widmung, Debatten, Diskurs, Auschwitz.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen einem Denkmal und einem Mahnmal?
Ein Denkmal erinnert oft allgemein an Personen oder Ereignisse, während ein Mahnmal eine spezifische warnende Funktion hat und zur Reflexion über begangenes Unrecht (wie den Holocaust) aufruft.
Warum war die Realisierung des Holocaust-Mahnmals so umstritten?
Es gab jahrelange Debatten über die Widmung (nur für jüdische Opfer?), den optimalen Standort im Zentrum Berlins und die angemessene künstlerische Gestaltung.
Welche Rolle spielten die Wettbewerbe bei der Gestaltung?
Verschiedene Wettbewerbe brachten unterschiedlichste Entwürfe hervor, die Fragen nach Monumentalität und der Wirkung auf künftige Generationen aufwarfen.
Zieht das Mahnmal einen "Schlussstrich" unter die NS-Vergangenheit?
Kritiker befürchteten dies, doch Befürworter sehen in der physischen Präsenz des Mahnmals eine dauerhafte Provokation, die den Diskurs lebendig hält.
Wie entschied der Bundestag über das Projekt?
Nach über zehn Jahren Diskussion traf der Bundestag eine endgültige Entscheidung über die Gestaltungsform und den Zweck des Mahnmals als zentraler Ort der Erinnerungskultur.
- Quote paper
- Anke Zimmermann (Author), Judith Walther (Author), 2006, Die Realisierungsproblematik des Holocaust-Mahnmals, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/87589