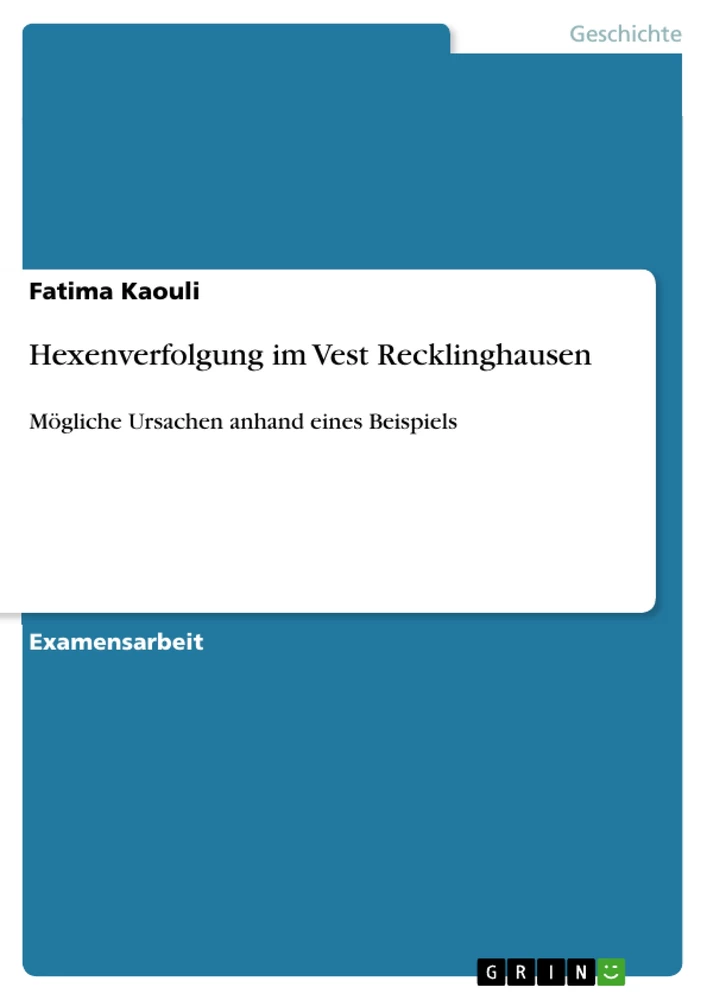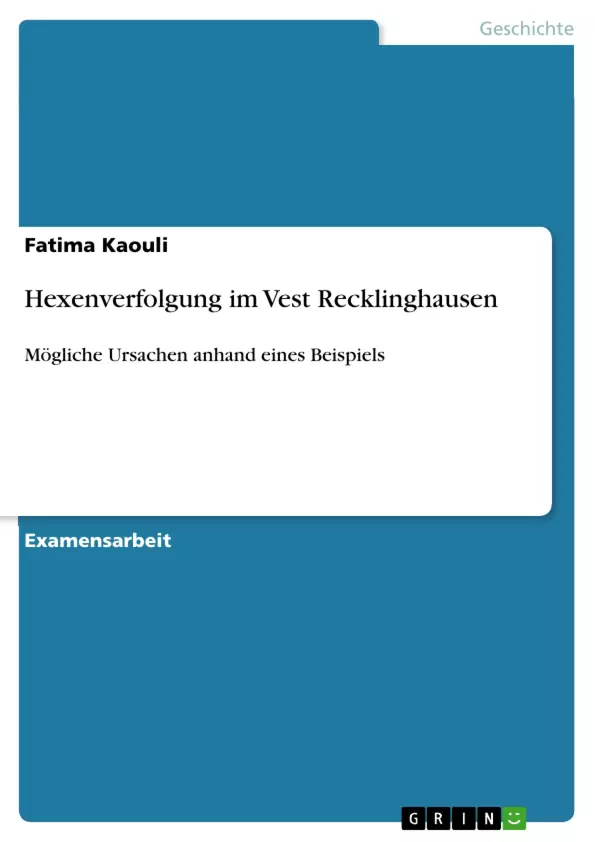Deutschland im 15. bis 18. Jahrhundert: Auch hier tauchte ein historisches Phänomen auf, das später mit dem Begriff „Hexenverfolgung“ nur recht allgemein bestimmt wurde. Im Jahre 1562 kam es zu einer Welle von Prozessen, deren Anwachsen und Ausweitung man später als „Große Hexenverfolgung“ bezeichnete. Diese in Wellen sich vollziehenden Hexenprozesse ließen nach den 1630er Jahren nach und schienen bald ganz zu stagnieren. Dennoch gab es vereinzelt Städte, in denen die Hexenverfolgungen weiterhin durchgeführt wurden. Der Zeitraum dieser Arbeit schließt, gerade was das Vest Recklinghausen betrifft, an die großen Verfolgungswellen aus den 1630er Jahren an und untersucht zwei Fälle, die lange nach dem Dreißigjährigen- und Siebenjährigen Krieg stattfanden. An dieser Stelle geht es darum, von dem allgemeinen Begriff "Hexenverfolgung" wegzukommen, um eine persönliche Ebene darzustellen.
Inhaltsverzeichnis
- I. Teil Hexen, Hexenverfolgung und Hexenprozesse allgemein
- 1.Etymologie und Wandlung des Hexenbildes von der frühen Neuzeit bis heute
- 1.1 Begriffs Etymologie
- 1.2 Die Wandlung des Hexenbildes von der frühen Neuzeit bis heute
- 1.2.1 Der Hexenhammer, die Bibel der Hexenverfolger in der frühen Neuzeit
- 2. Hexenverfolgungen in Deutschland von 1480 bis 1751
- 2.1 Ein kurzer Überblick
- 2.2 Die Anfänge der Hexenverfolgung in Deutschland und Europa
- 2.3 Die Verfolgungswellen
- 2.4 Das Ende der Hexenverfolgung
- 3. Die Verfahren der Hexenprozesse
- 3.1 Rechtliche Voraussetzungen für die Folter
- 3.2 Die Hexenproben
- 3.2.1 Die Tränenprobe
- 3.2.2 Die Nadelprobe
- 3.2.3 Die Wasserprobe
- 3.2.4 Die Feuerprobe
- 3.2.5 Die Hexenwaage
- 3.2.6 Die Gebetsprobe
- 3.3 Foltermethoden bei Hexenprozessen
- 3.3.1 Die Folgen des Geständnisses
- II. Teil Die Stadt Recklinghausen im Mittelpunkt der Hexenverfolgung
- 1. Die Stadt Recklinghausen im historischen Überblick
- 2. Hexenverfolgungen im Vest Recklinghausen
- 2.1 Hinrichtungsverfahren im Vest Recklinghausen
- 3. Die herrschaftlichen Verhältnisse im Ruhr-Lippe-Raum
- 3.1 Die Strafgerichtsbarkeit in Recklinghausen
- 3.2 Die Zuständigkeit im peinlichen Verfahren
- 4. Ursachen für die Verfolgungswellen in Recklinghausen 1580 bis 1590
- 4.1 Das Ende der Hexenverfolgungen im Vest Recklinghausen
- III. Teil
- a) Anmerkung zu den Beispielen
- b) Anmerkung zum Trine-Plumpe-Prozess
- 1. Der Hexenprozess gegen Trine Plumpe aus dem Jahr 1650
- 3.1 Die Länge der Hexenprozesse aus dem Jahre 1650 im Vergleich
- 3.1.1 Die Ursachenerklärung zu den Beispielen aus Friesenhagen und Mecklenburg
- 3.1.2 Ergebnis
- 3.2 Die Untersuchung der äußeren Ursachen und Hintergründe
- c) Anmerkung zum Prozess Anna Spiekermann im Jahre 1705/06
- 1. Der Prozess Anna Spiekermann, genannt Hexenänneken
- 2. Ursachenerklärung zu diesem Fallbeispiel
- 2.1 Der politische Hintergrund
- 2.2 Persönliche Gründe
- 3. Zusammenfassung
- 4. Die Fallbeispiele im kritischen Vergleich
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Hexenverfolgung im Vest Recklinghausen, insbesondere die Ursachen der Verfolgungswellen. Sie analysiert ausgewählte Prozessakten, um über die allgemeinen Erklärungen hinaus, individuelle Fälle zu beleuchten und die Hintergründe besser zu verstehen.
- Analyse der Hexenverfolgung im historischen Kontext
- Untersuchung der juristischen Verfahren und Foltermethoden
- Erforschung der sozialen, politischen und religiösen Ursachen der Verfolgung
- Detaillierte Fallstudien von Hexenprozessen im Vest Recklinghausen
- Vergleich der Fälle und Schlussfolgerungen zu den Ursachen
Zusammenfassung der Kapitel
I. Teil Hexen, Hexenverfolgung und Hexenprozesse allgemein: Dieser Teil bietet eine umfassende Einführung in das Thema Hexenverfolgung. Er beleuchtet die Entwicklung des Hexenbildes von der frühen Neuzeit bis heute, analysiert die Begriffsgeschichte und untersucht die Hexenverfolgungen in Deutschland von 1480 bis 1751, inklusive ihrer Anfänge, Wellen und des endgültigen Abklingens. Ein Schwerpunkt liegt auf den Verfahren der Hexenprozesse, den rechtlichen Grundlagen der Folter und den angewandten "Hexenproben", welche die Prozesse prägten und oft zu falschen Anschuldigungen und Urteilen führten. Der Teil liefert so ein umfassendes Verständnis des historischen und gesellschaftlichen Kontextes der Hexenverfolgung.
II. Teil Die Stadt Recklinghausen im Mittelpunkt der Hexenverfolgung: Dieser Teil fokussiert auf die Hexenverfolgung im Vest Recklinghausen. Er beginnt mit einem geschichtlichen Überblick über die Stadt Recklinghausen, um den Kontext zu schaffen. Danach werden die Hexenverfolgungen im Vest Recklinghausen selbst näher beleuchtet, einschließlich der Hinrichtungsverfahren. Die Analyse der herrschaftlichen Verhältnisse und der Strafgerichtsbarkeit im Ruhr-Lippe-Raum wird behandelt, um die strukturellen und politischen Rahmenbedingungen der Verfolgungen zu verstehen. Der Abschnitt zu den Ursachen der Verfolgungswellen in Recklinghausen (1580-1590) bildet den Höhepunkt des Teils. Er versucht, die komplexen Gründe für die Hexenverfolgung in dieser Region aufzudecken und zu erklären. Das Ende der Hexenverfolgungen im Vest Recklinghausen bildet den Schlusspunkt dieses Teils.
III. Teil: Dieser Teil analysiert ausgewählte Fallbeispiele von Hexenprozessen aus dem Vest Recklinghausen, darunter der Prozess gegen Trine Plumpe (1650) und der Prozess gegen Anna Spiekermann (1705/06). Die Fallstudien bieten eine detaillierte Untersuchung der jeweiligen Prozesse, der beteiligten Personen und der zugrundeliegenden Ursachen. Der kritische Vergleich der beiden Fälle hilft, die verschiedenen Faktoren zu identifizieren, welche zu den Verurteilungen führten und so ein differenziertes Bild der Hexenverfolgung zu vermitteln.
Schlüsselwörter
Hexenverfolgung, Vest Recklinghausen, Hexenprozesse, Folter, Prozessakten, Ursachenforschung, soziale Geschichte, politische Geschichte, religiöse Geschichte, Fallstudien, Trine Plumpe, Anna Spiekermann.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Thema: Hexenverfolgung im Vest Recklinghausen
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Arbeit befasst sich umfassend mit der Hexenverfolgung im Vest Recklinghausen. Sie bietet einen historischen Überblick über die Hexenverfolgung allgemein, analysiert die Prozesse im Vest Recklinghausen im Detail und untersucht ausgewählte Fallbeispiele, um die Ursachen der Verfolgung aufzudecken. Die Arbeit beinhaltet eine Etymologie des Begriffs „Hexe“, die Entwicklung des Hexenbildes, die Verfahren der Hexenprozesse mit den angewandten Foltermethoden, die politischen und sozialen Bedingungen im Ruhr-Lippe-Raum und detaillierte Fallstudien zu den Prozessen gegen Trine Plumpe (1650) und Anna Spiekermann (1705/06).
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit deckt ein breites Spektrum an Themen ab, darunter: die Etymologie und Wandlung des Hexenbildes, Hexenverfolgungen in Deutschland (1480-1751), die Verfahren der Hexenprozesse (einschließlich Foltermethoden und Hexenproben), die historische Entwicklung Recklinghausens, die Hexenverfolgung im Vest Recklinghausen, die herrschaftlichen Verhältnisse und Strafgerichtsbarkeit im Ruhr-Lippe-Raum, die Ursachen der Verfolgungswellen in Recklinghausen (1580-1590) und detaillierte Fallstudien zu den Prozessen gegen Trine Plumpe und Anna Spiekermann mit vergleichender Analyse.
Welche Methoden wurden in der Arbeit angewendet?
Die Arbeit verwendet eine historisch-analytische Methode. Sie basiert auf der Auswertung von Prozessakten, um die individuellen Fälle im Detail zu untersuchen und die allgemeinen Erklärungen zur Hexenverfolgung zu vertiefen. Ein Vergleich der Fallbeispiele ermöglicht es, die verschiedenen Faktoren zu identifizieren, die zu den Verurteilungen führten. Es wird sowohl eine quantitative als auch qualitative Analyse der Daten durchgeführt.
Welche Fallbeispiele werden in der Arbeit analysiert?
Die Arbeit analysiert detailliert zwei Fallbeispiele: den Prozess gegen Trine Plumpe aus dem Jahr 1650 und den Prozess gegen Anna Spiekermann (Hexenänneken) aus den Jahren 1705/06. Diese Fallstudien dienen dazu, die allgemeinen Erkenntnisse zu konkretisieren und die individuellen Hintergründe der Verfolgung besser zu verstehen. Die Fälle werden miteinander verglichen, um Gemeinsamkeiten und Unterschiede aufzuzeigen.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, ein umfassendes Verständnis der Hexenverfolgung im Vest Recklinghausen zu liefern, indem sie die historischen, sozialen, politischen und religiösen Faktoren untersucht, die zu den Verfolgungswellen führten. Durch die detaillierte Analyse der Fallbeispiele werden die komplexen Ursachen der Hexenverfolgung aufgezeigt und ein differenziertes Bild vermittelt, das über allgemeine Erklärungen hinausgeht.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter, die den Inhalt der Arbeit prägnant beschreiben, sind: Hexenverfolgung, Vest Recklinghausen, Hexenprozesse, Folter, Prozessakten, Ursachenforschung, soziale Geschichte, politische Geschichte, religiöse Geschichte, Fallstudien, Trine Plumpe, Anna Spiekermann.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Historiker, Studenten der Geschichte, Soziologie und Rechtswissenschaften, sowie für alle, die sich für die Geschichte der Hexenverfolgung, die regionale Geschichte des Vest Recklinghausen und die Methoden der historischen Forschung interessieren.
- Quote paper
- Fatima Kaouli (Author), 2007, Hexenverfolgung im Vest Recklinghausen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/87682