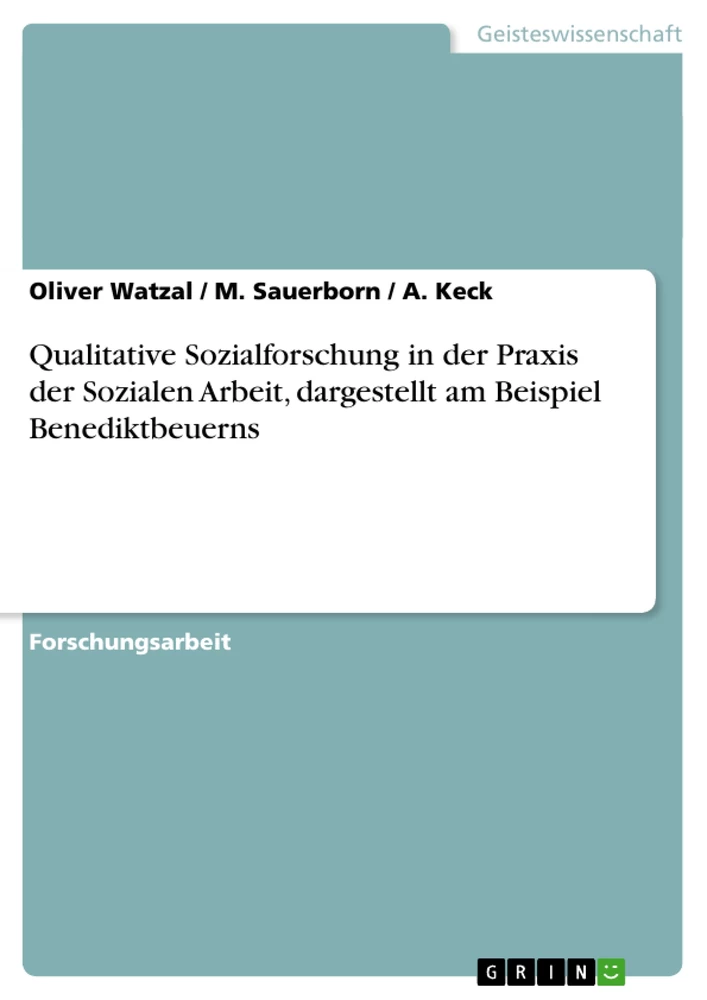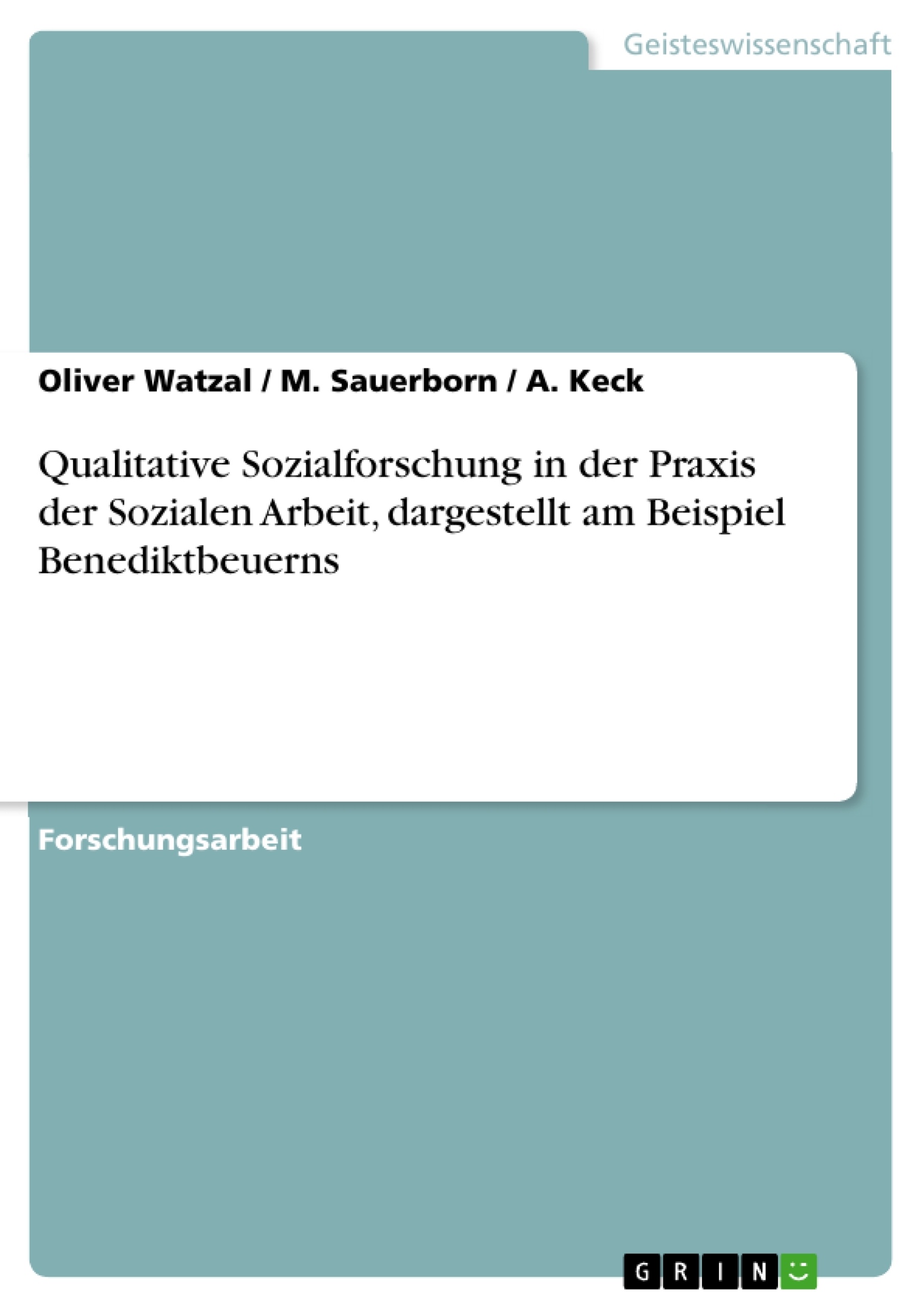Die vorliegende Arbeit stellt ein Werkstattbuch aus der Praxis der Sozialen Arbeit für die Praxis dar. Das Forschungsinstrument des Fragebogens wird als qualitative Methode der empirischen Sozialforschung am Beispiel einer Umfrage konkret dargestellt.
Zentrale Fragestellung der Arbeit ist, ob sich die von den Autoren aufgestellten Hypothesen bei einer repräsentativen Anzahl von Studienbeginnern belegen lassen oder zu verwerfen sind.
Die Ergebnisse der Umfrage sinnvoll interpretieren zu können und eine hohe Vergleichbarkeit zu erzielen, war ein zentrales Entscheidungskriterium, das für die Untersuchung mit einem Fragebogen sprach. So konnten gezielt Häufigkeitsverteilungen bei individuellen Meinungen der Befragten ermittelt werden.
Der Fragebogen als Untersuchungsinstrument erschien am besten geeignet um zu vermeiden, mit den subjektiven Fragestellungen des Forschenden die Antworten der Befragten zu beeinflussen.
Das Thema der Umfrage per Fragebogen lautet dabei: „Möglichkeiten zur Verbesserung der Anfangssituation von Studienanfängerinnen und Studienanfängern in Hochschule und Gemeinde.“
Es wird des Weiteren die Datenerhebung von 37 befragten Personen im Rahmen dieser Umfrage beschrieben. Danach folgen eine zusammenfassende und vergleichende Betrachtung der Ergebnisse, die sich aus der Überprüfung der einzelnen Hypothesen ergaben, und eine kritische Selbsteinschätzung dieser Ergebnisse.
Die Arbeit schließt mit einer Zusammenfassung der wichtigsten gewonnenen Erkenntnisse.
Inhaltsverzeichnis
- Problemstellung
- Methoden und Vorgehensweise
- Hypothese
- Ergebnisse
- Statistische Daten:
- Tag der Anreise:
- Wohnungssuche:
- Der erste Hochschultag:
- Hochschulleben:
- Abschlussfrage:
- Diskussion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Ziel dieser Studie ist es, die Anfangssituation von Studienanfängerinnen und Studienanfängern an der Katholischen Fachhochschule Benediktbeuern zu untersuchen und mögliche Verbesserungspotenziale aufzuzeigen. Die Studie basiert auf den Erfahrungen der Autoren als ehemalige Erstsemester und Mitgestalter der Einführungswoche.
- Bewertung der Einführungswoche durch Studienanfängerinnen und Studienanfänger
- Schwierigkeiten bei der Wohnungssuche in den umliegenden Gemeinden
- Integration und Kontaktaufnahme mit anderen Studierenden
- Entgegenkommen der Gemeinde Benediktbeuern und der umliegenden Gemeinden gegenüber Studierenden
- Defizite und Verbesserungsideen aus Sicht der Studienanfängerinnen und Studienanfänger
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1: Problemstellung
Dieses Kapitel führt in die Thematik der Anfangssituation von Studienanfängerinnen und Studienanfängern in Benediktbeuern ein. Es wird auf die Bedeutung der Einführungswoche für den Studienstart hingewiesen und die Motivation für die Durchführung der Umfrage erläutert.
Kapitel 2: Methoden und Vorgehensweise
In diesem Kapitel wird die Forschungsmethodik der Studie beschrieben. Der Fokus liegt auf der Auswahl des Fragebogens als Forschungsinstrument und der damit verbundenen Vorteile für die Erhebung von Daten bei einer großen Anzahl von Studierenden. Zudem wird die Bedeutung der Objektivität der Fragestellungen hervorgehoben.
Kapitel 3: Hypothese
Dieses Kapitel präsentiert die Hypothese der Studie, die auf den Erfahrungen der Autoren und dem Gedankenaustausch mit anderen Studierenden basiert. Die Hypothese besagt, dass die Einführungswoche hilfreich ist, jedoch in einigen Aspekten noch verbessert werden kann.
Schlüsselwörter
Die Studie befasst sich mit den Themen **Anfangssituation, Einführungswoche, Studienanfängerinnen und Studienanfänger, Wohnungssuche, Integration, Gemeinde, Benediktbeuern, qualitative Methoden, Fragebogen, Empirische Sozialforschung, soziale Arbeit.**
Häufig gestellte Fragen
Was wurde in der Studie in Benediktbeuern untersucht?
Die Studie untersuchte die Anfangssituation von Studienanfängern an der Katholischen Fachhochschule, insbesondere die Einführungswoche und die Wohnungssuche.
Warum wurde ein Fragebogen als Forschungsinstrument gewählt?
Um eine hohe Vergleichbarkeit der Daten zu erzielen und subjektive Beeinflussungen durch die Forschenden zu minimieren.
Welche Probleme hatten die Studienanfänger bei der Wohnungssuche?
Die Suche in den umliegenden Gemeinden gestaltete sich oft schwierig, da das Angebot begrenzt und die Integration in die Gemeinde eine Hürde darstellte.
Wie bewerteten die Studierenden die Einführungswoche?
Die Einführungswoche wurde grundsätzlich als hilfreich empfunden, bot jedoch in Teilbereichen noch Potenzial für Verbesserungen.
Welche Rolle spielt die Gemeinde Benediktbeuern für die Studierenden?
Die Studie beleuchtete das Entgegenkommen der Gemeinde und suchte nach Wegen, die Integration der Studierenden in das Gemeindeleben zu fördern.
- Quote paper
- Oliver Watzal (Author), M. Sauerborn (Author), A. Keck (Author), 2001, Qualitative Sozialforschung in der Praxis der Sozialen Arbeit, dargestellt am Beispiel Benediktbeuerns, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/8770