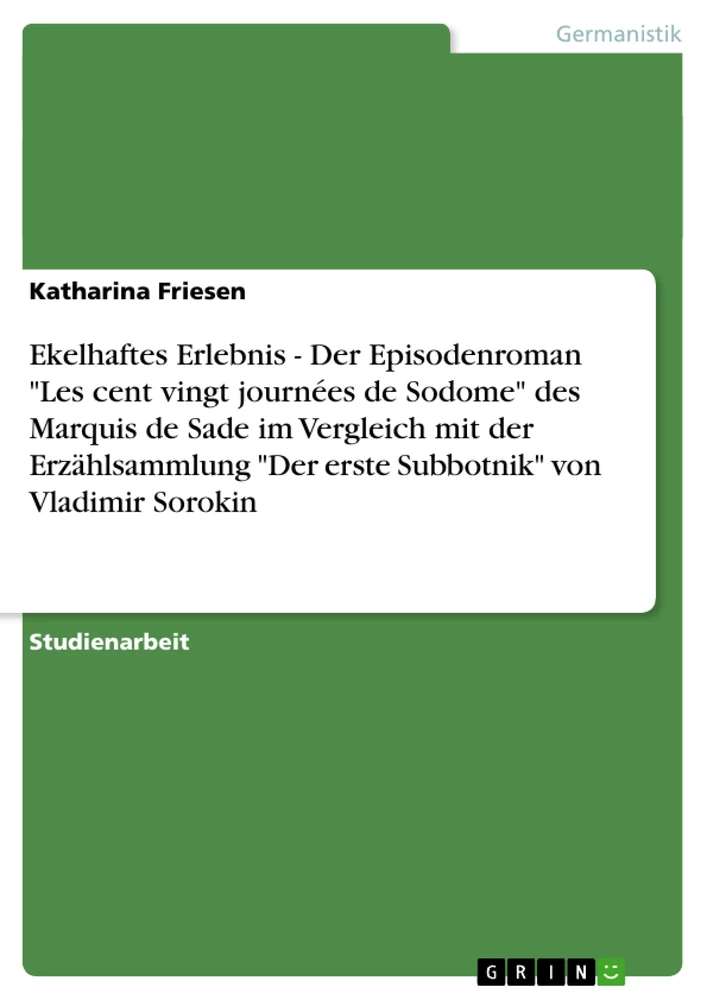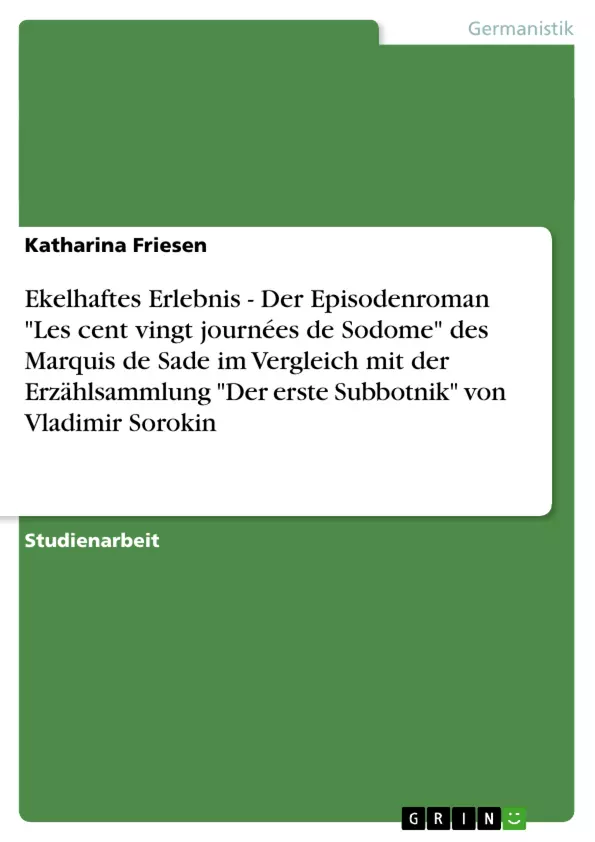Diese Arbeit beschäftigt sich mit dem Gefühl des Ekels,
seiner Darstellung und seinen möglichen Funktionen, in
der Literatur. Die Werke zweier Autoren, die extensiv
von der Darstellung des Ekelhaften Gebrauch machen,
sollen die Grundlage dieser Untersuchung bilden. Bei
den beiden Autoren handelt es sich um den
französischen Schriftsteller und Dokumentator infamer Lüste Marquis de Sade und den russischen Skandalautor der postsowjetischen Epoche Vladimir Sorokin.
Ein Vergleich dieser beiden Autoren scheint in vielerlei Hinsicht ergiebig. Nicht zuletzt auch, weil die Epochen, die diese beiden Schriftsteller geprägt haben, einige, wenn auch nicht auf den ersten Blick offensichtliche, Parallelen aufweisen, was dazu führt, dass sich auch in den Texten der beiden Autoren ähnliche Strukturen und Verfahren, unter anderem in der Funktionsweise des Ekelhaften, finden lassen.
Der Marquis de Sade wurde geprägt von der Philosophie
der Aufklärung und der Ästhetik der klassizistischen
Kunst, die beide ganz deutliche Spuren in seinen Texten
hinterlassen haben, während Vladimir Sorokin ein Kind
des sozialistischen Russland ist und mit dem Stil und
den Ideen des sozialistischen Realismus groß wurde.
Eine der größten Gemeinsamkeiten zwischen dem Zeitalter
der Aufklärung und dem des Sozialismus ist die Idee des
Vorrangs der Interessen der Gesellschaft vor denen des
Individuums, was auch ganz deutlich in den Ästhetiken
dieser beiden Epochen zum Ausdruck kommt. Sowohl der
Marquis de Sade als auch Sorokin brechen in ihren
Texten das in ihrer Epoche gültige Diktat der
abstrakten Gesellschaft über das Individuum auf,
wodurch ihre Werke in einem großen Ausmaß provokativ wirken. Eines der Verfahren die sie dabei anwenden, ist die Darstellung des Ekelhaften, wobei das den Text rezipierende Individuum sich selbst im konkreten Gefühl des Ekels, unabhängig von der abstrakten Gesellschaft, als solches wahrnehmen kann.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Grundlagen, Konzeptualisierungen und Prämissen
- 1.1 Ekel zwischen Natur und Kultur
- 1.2 Sensationsästhetik
- 1.2.1 Sensationsästhetik im Rahmen von kollektivisierenden und individualisierenden Gesellschaften
- 1.3 Ästhetische Kategorien der klassizistischen und der sozrealistischen Kunst
- 1.4 Ekel und Lust
- 1.4.1 Ekel und Libido bei Freud
- 1.4.2 Ekel und Rausch bei Bataille
- 2 Reduzierung der Distanz zwischen Text und Rezipient durch Ekel und Lust
- 2.1 Rauschhafte Entgrenzung als Folge der Überwindung des Ekels
- 2.2 Die Nahsinne: Geruch-, Geschmack- und Tastsinn
- 3 Verfahren der Überwindung der reflexionsanhaltenden Wirkung des Ekels und der sexuellen Erregung
- 3.1 Das Absurde
- 3.2 Semantische und strukturelle Kohärenz
- 4 Unterschiedliche formale Tendenzen
- 4.1 Geschlossene, zu überwindende Form
- 4.2 Offene, involvierende Form
- 5 Pervertierende Parodie und Kulturkonzept
- 5.1 Rationalistisch abstrakte Form in Verbindung mit sinnlich-obszönem, individualisierendem Inhalt
- 5.1.1 Die philosophische Argumentation im Dienste der Befriedigung infamer Lüste
- 5.1.2 Die sinnesneutrale Form der klassizistischen Ästhetik als das begehrte Ekelhafte
- 5.2 Text als semiotische Entgrenzungs- und Konsolidierungserfahrung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Darstellung von Ekel und dessen Funktion in der Literatur, anhand der Werke von Marquis de Sade und Vladimir Sorokin. Der Fokus liegt auf den Parallelen und Unterschieden in der Verwendung des Ekels als literarisches Mittel, berücksichtigt die jeweiligen historischen und gesellschaftlichen Kontexte (Aufklärung/Sozialismus) und die Auswirkungen auf die Rezeption. Der Vergleich beider Autoren soll die Funktionsweise des Ekels als Verfahren zur Überwindung gesellschaftlicher Normen beleuchten.
- Die Funktion von Ekel in der Literatur
- Der Einfluss historischer und gesellschaftlicher Kontexte auf die Darstellung von Ekel
- Vergleichende Analyse der Werke von Sade und Sorokin
- Ekel als Mittel zur Überwindung gesellschaftlicher Normen
- Die Rolle der Sensationsästhetik
Zusammenfassung der Kapitel
1 Grundlagen, Konzeptualisierungen und Prämissen: Dieses Kapitel legt die theoretischen Grundlagen der Arbeit. Es definiert Ekel als ambivalenten Affekt, der zwischen Natur und Kultur angesiedelt ist, und untersucht dessen kulturelle und gesellschaftliche Konnotationen. Die Einflüsse von Kant, Nietzsche und anderen Philosophen auf das Verständnis von Ekel werden beleuchtet. Es wird die Bedeutung der Sensationsästhetik und deren Funktion in kollektivistischen und individualistischen Gesellschaften erörtert, um den Kontext für die Analyse der Werke von Sade und Sorokin zu schaffen. Der Unterschied in der gesellschaftlichen Ordnung der Aufklärung und des Sozialismus wird als entscheidender Faktor für die jeweils spezifische Darstellung des Ekels hervorgehoben.
2 Reduzierung der Distanz zwischen Text und Rezipient durch Ekel und Lust: Dieses Kapitel analysiert, wie sowohl Sade als auch Sorokin durch die Darstellung von Ekel und Lust die Distanz zwischen Text und Leser verringern. Es untersucht die Wirkung der Nahsinne (Geruch, Geschmack, Tastsinn) im Kontext des Ekels und beschreibt, wie die übersteigerte Darstellung diese Sinne zum Mittel der emotionalen und körperlichen Involvierung des Lesers macht, um die Distanz zwischen Text und Rezipient auf eine konkrete körperliche Ebene zu reduzieren und somit eine intensivere Rezeption zu erzeugen.
3 Verfahren der Überwindung der reflexionsanhaltenden Wirkung des Ekels und der sexuellen Erregung: Das Kapitel konzentriert sich auf die literarischen Strategien, die Sade und Sorokin einsetzen, um die blockierende Wirkung des Ekels und die damit einhergehende sexuelle Erregung zu überwinden. Es analysiert die Rolle des Absurden und die Bedeutung der semantischen und strukturellen Kohärenz als Werkzeuge, um beim Leser eine aktive Aneignung des Textes und damit eine Überwindung des initialen Ekels zu erreichen. Die Strategien werden im Kontext der jeweiligen Epoche und deren kulturellen Normen interpretiert.
4 Unterschiedliche formale Tendenzen: Hier werden die unterschiedlichen formalen Strukturen in den Werken von Sade und Sorokin untersucht. Der Gegensatz zwischen geschlossener, zu überwindender Form und offener, involvierender Form wird analysiert und im Zusammenhang mit der Darstellung von Ekel und Lust gesetzt. Die jeweiligen Formen werden als Ausdruck der unterschiedlichen kulturellen und gesellschaftlichen Kontexte verstanden.
5 Pervertierende Parodie und Kulturkonzept: In diesem Kapitel wird die pervertierende Parodie als zentrales Verfahren in den Werken von Sade und Sorokin analysiert. Es untersucht die Verbindung von rationalistisch-abstrakter Form mit sinnlich-obszönem Inhalt und interpretiert den Text als semiotische Entgrenzungs- und Konsolidierungserfahrung. Die philosophische Argumentation bei Sade wird im Kontext seiner perversen Lüste interpretiert, während die sinnesneutrale Form der klassizistischen Ästhetik als begehrtes Ekelhaftes erörtert wird. Der Text wird als ein Experiment verstanden, das die Grenzen des menschlichen Erlebens und die gesellschaftliche Ordnung hinterfragt.
Schlüsselwörter
Ekel, Sensationsästhetik, Marquis de Sade, Vladimir Sorokin, Klassizismus, Sozialistischer Realismus, Aufklärung, Parodie, Lust, Abwehrreaktion, Körper, Kultur, Gesellschaft, Individuum, Rezeption, Text-Rezipient-Distanz.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Analyse von Ekel in den Werken von Sade und Sorokin
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese akademische Arbeit analysiert die Darstellung und Funktion von Ekel in den literarischen Werken von Marquis de Sade und Vladimir Sorokin. Im Fokus stehen die Parallelen und Unterschiede in der Verwendung von Ekel als literarisches Stilmittel, unter Berücksichtigung der jeweiligen historischen und gesellschaftlichen Kontexte (Aufklärung/Sozialismus) und deren Auswirkungen auf die Rezeption der Texte.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit untersucht die Funktion von Ekel in der Literatur, den Einfluss historischer und gesellschaftlicher Kontexte auf die Darstellung von Ekel, führt eine vergleichende Analyse der Werke von Sade und Sorokin durch und beleuchtet Ekel als Mittel zur Überwindung gesellschaftlicher Normen. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Rolle der Sensationsästhetik.
Welche theoretischen Grundlagen werden verwendet?
Die Arbeit stützt sich auf theoretische Grundlagen, die Ekel als ambivalenten Affekt zwischen Natur und Kultur definieren und dessen kulturelle und gesellschaftliche Konnotationen untersuchen. Die Einflüsse von Philosophen wie Kant und Nietzsche auf das Verständnis von Ekel werden beleuchtet. Die Bedeutung der Sensationsästhetik und deren Funktion in kollektivistischen und individualistischen Gesellschaften wird erörtert, um den Kontext für die Analyse der Werke von Sade und Sorokin zu schaffen.
Wie wird die Distanz zwischen Text und Rezipient behandelt?
Die Analyse untersucht, wie Sade und Sorokin durch die Darstellung von Ekel und Lust die Distanz zwischen Text und Leser verringern. Die Wirkung der Nahsinne (Geruch, Geschmack, Tastsinn) im Kontext des Ekels wird untersucht, sowie wie die übersteigerte Darstellung dieser Sinne die emotionale und körperliche Involvierung des Lesers bewirkt und somit eine intensivere Rezeption erzeugt.
Welche literarischen Strategien werden analysiert?
Die Arbeit analysiert die literarischen Strategien, die Sade und Sorokin einsetzen, um die blockierende Wirkung des Ekels und die damit einhergehende sexuelle Erregung zu überwinden. Die Rolle des Absurden und die Bedeutung der semantischen und strukturellen Kohärenz als Werkzeuge zur aktiven Aneignung des Textes und Überwindung des initialen Ekels werden untersucht. Die Strategien werden im Kontext der jeweiligen Epoche und deren kulturellen Normen interpretiert.
Wie werden die formalen Unterschiede der Werke betrachtet?
Die Arbeit untersucht die unterschiedlichen formalen Strukturen in den Werken von Sade und Sorokin. Der Gegensatz zwischen geschlossener, zu überwindender Form und offener, involvierender Form wird analysiert und im Zusammenhang mit der Darstellung von Ekel und Lust gesetzt. Die jeweiligen Formen werden als Ausdruck der unterschiedlichen kulturellen und gesellschaftlichen Kontexte verstanden.
Welche Rolle spielt die Parodie?
Die pervertierende Parodie wird als zentrales Verfahren in den Werken von Sade und Sorokin analysiert. Die Verbindung von rationalistisch-abstrakter Form mit sinnlich-obszönem Inhalt wird untersucht und der Text als semiotische Entgrenzungs- und Konsolidierungserfahrung interpretiert. Die philosophische Argumentation bei Sade wird im Kontext seiner perversen Lüste interpretiert, während die sinnesneutrale Form der klassizistischen Ästhetik als begehrtes Ekelhaftes erörtert wird. Der Text wird als Experiment verstanden, das die Grenzen des menschlichen Erlebens und die gesellschaftliche Ordnung hinterfragt.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Ekel, Sensationsästhetik, Marquis de Sade, Vladimir Sorokin, Klassizismus, Sozialistischer Realismus, Aufklärung, Parodie, Lust, Abwehrreaktion, Körper, Kultur, Gesellschaft, Individuum, Rezeption, Text-Rezipient-Distanz.
- Quote paper
- Katharina Friesen (Author), 2007, Ekelhaftes Erlebnis - Der Episodenroman "Les cent vingt journées de Sodome" des Marquis de Sade im Vergleich mit der Erzählsammlung "Der erste Subbotnik" von Vladimir Sorokin, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/87786