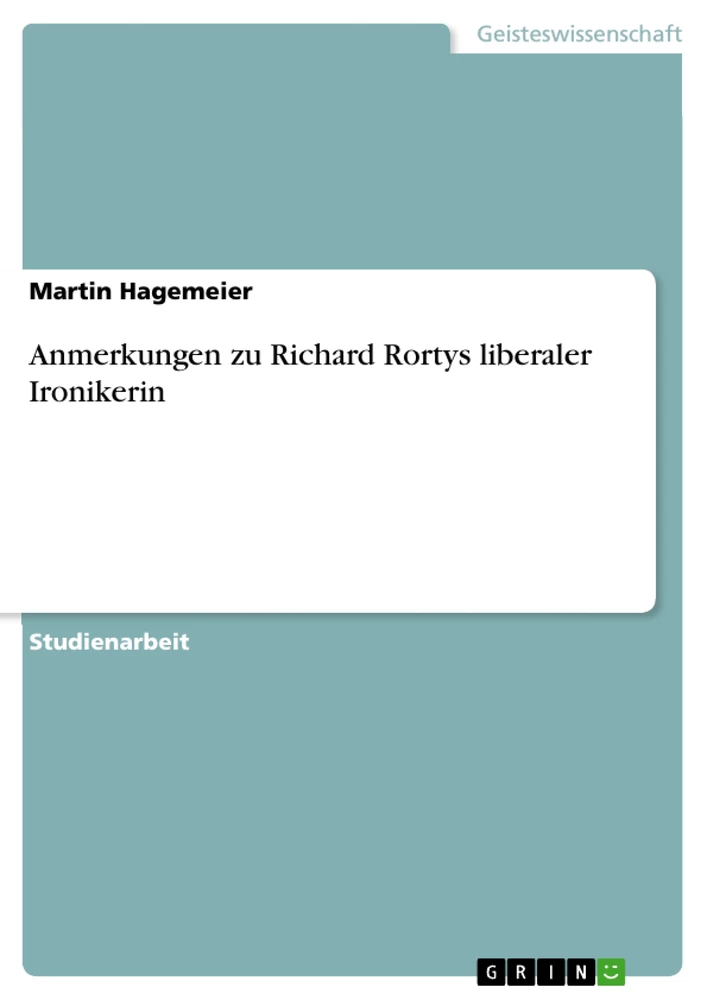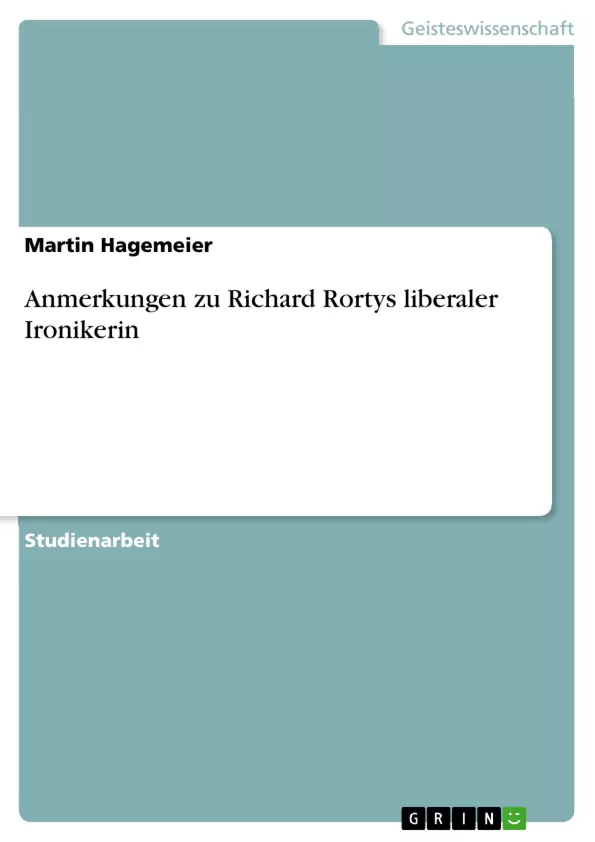Es ist nicht schwer zum Bewohner von Richard Rortys liberaler Utopie zu werden. Zwei einfache Bedingungen sollten erfüllt sein, um als liberale Ironikerin aufgenommen zu werden. Ein ironisches Verhalten gegenüber dem eigenem abgeschlossenem Vokabular und ein neugieriges Verhalten gegenüber dem abgeschlossenem Vokabular von Mitmenschen, entsprechen Rortys minimaler Anforderung. Mit den Punkten Ironie und Neugier versucht Rorty in der Praxis zu kombinieren, was seiner Ansicht nach keine Theorie mehr verbinden kann: Die Forderungen nach privater Selbsterschaffung und Solidarität im öffentlichen Leben.
Kleingedrucktes lässt sich hinter der Formulierung vom „abgeschlossenem Vokabular“ vermuten, sollte aber nicht davon abhalten in Rortys liberale Utopie zu übersiedeln. Die Formulierung steht für eine sprachphilosophische Neubestimmung dessen, was vor dem linguistic turn Selbst hieß. Das sprachphilosophische Selbst orientiert sich nicht mehr an einer Wesensmetaphysik, die nach einer erkennbaren immanenten Natur des Menschen sucht, sondern an der Auseinandersetzung mit den Kontingenzen der Sprache die wir benutzen.
In meiner Hausarbeit will ich zum einen dem Einwand des Relativismus entgegnen, dass sich in Rortys scheinbar schwacher Konzeption eine vorteilhafte Stärke befindet. Diese ist aber nicht stark genug gegen ethnozentristische Haltungen abgesichert ist und führt somit zu größeren Schwierigkeiten.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Anmerkungen zu den Bewohnern von Rortys liberaler Utopie
- Die vorteilhafte Stärke der liberalen IronikerInnen...
- ...und ein ethnozentristischer Ausrutscher
- Solidarität und soziale Hoffnung...
- Schlussbemerkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit untersucht Richard Rortys Konzept der liberalen Ironikerin. Ziel ist es, sowohl die Stärken als auch die Schwächen dieses Konzepts zu beleuchten und die Auswirkungen auf gesellschaftliche Diskurs und Moral zu analysieren.
- Die Bedeutung der sprachphilosophischen Neubestimmung des Selbst in Rortys Konzept
- Die Rolle der Ironie und Neugier in der liberalen Utopie
- Die Auswirkungen des Konzepts auf den Umgang mit moralischen Realitäten und ideologischen Fundamenten
- Die Kritik am Relativismus und die potenziellen Folgen für den Umgang mit ethnozentristischen Haltungen
- Die Frage nach der praktischen Umsetzbarkeit von Rortys Konzept in der realen Welt
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt das Konzept der liberalen Ironikerin nach Richard Rorty vor und erläutert die zwei grundlegenden Bedingungen für die Zugehörigkeit zu dieser Utopie: ironisches Verhalten gegenüber dem eigenen Vokabular und Neugier gegenüber dem Vokabular anderer. Die Arbeit argumentiert, dass sich in Rortys Konzeption eine vorteilhafte Stärke befindet, die jedoch nicht ausreichend gegen ethnozentristische Haltungen abgesichert ist.
Kapitel 2 analysiert die zentralen Bestimmungen des liberalen Ironikers, wie sie von Rorty im Vorwort zu „Kontingenz, Ironie und Solidarität“ beschrieben werden. Rorty vertritt die Meinung, dass private Autonomie und Gerechtigkeit nicht vereinbar sind, und schlägt eine pragmatische Koexistenz dieser Konzepte vor. Dabei werden die Vorteile der liberalen Ironikerin im Bezug auf ihre Haltung gegenüber moralischen Prinzipien und ideologischen Fundamenten beleuchtet.
Kapitel 2.1 untersucht die „vorteilhafte Stärke“ der liberalen Ironikerin, die aus dem ironischen Verhältnis zum eigenen Vokabular und der Neugier auf andere Vokabulare resultiert. Der Vorteil liegt darin, dass sich für den liberalen Ironiker die Fragen nach moralischen Prinzipien und ideologischen Fundamenten nicht mehr stellen und er nicht dem Vorwurf eines schwachen Relativismus ausgesetzt ist.
Kapitel 2.2 befasst sich mit dem „ethnozentrischen Ausrutscher“ in Rortys Konzept. Es wird argumentiert, dass die liberale Ironikerin durch ihre Losgelöstheit von Werten und moralischen Prinzipien in Gefahr gerät, problematischen Positionen gegenüber fatalistisch zu sein. Die Gefahr besteht darin, dass die liberale Ironikerin die moralischen Realitäten außer Acht lässt und die Auseinandersetzung mit ethnozentrischen Haltungen zu schwach ausfällt.
Kapitel 2.3 untersucht die Frage nach der „Solidarität und sozialen Hoffnung“ im Kontext der liberalen Ironikerin. Rorty verweist auf Joseph Schumpeters Kriterium für Zivilisiertheit und die Kontingenz des eigenen Gewissens. Moralische Prinzipien sind demnach nur noch Versatzstücke der Sozialisation, die das Selbst prägen, zu denen es sich bekennen kann, die es aber nur noch als Hilfestellungen nutzen sollte.
Schlüsselwörter
Liberale Ironikerin, Richard Rorty, Sprachphilosophie, Selbst, Kontingenz, Vokabular, Ironie, Neugier, Pragmatische Koexistenz, Moralische Prinzipien, Ideologische Fundamente, Relativismus, Ethnozentrismus, Solidarität, Soziale Hoffnung, Zivilisiertheit, Gewissen.
Häufig gestellte Fragen
Wer ist die „liberale Ironikerin“ nach Richard Rorty?
Es ist eine Person, die sich ironisch gegenüber ihrem eigenen Vokabular verhält und gleichzeitig neugierig auf die Vokabulare anderer Menschen ist.
Was bedeutet der Begriff „abgeschlossenes Vokabular“?
Er steht für eine sprachphilosophische Neubestimmung des Selbst, das sich nicht an Metaphysik, sondern an der Kontingenz der benutzten Sprache orientiert.
Wie versucht Rorty private Selbsterschaffung und Solidarität zu verbinden?
Rorty schlägt eine pragmatische Koexistenz vor, da er glaubt, dass Theorie diese beiden Bereiche nicht mehr logisch vereinen kann.
Welche Kritik wird an Rortys Konzept geübt?
Die Arbeit untersucht den Vorwurf des Relativismus und die Gefahr, dass das Konzept nicht ausreichend gegen ethnozentrische Haltungen geschützt ist.
Was ist der „ethnozentrische Ausrutscher“?
Die Gefahr, dass liberale Ironiker durch ihre Losgelöstheit von festen Werten fatalistisch gegenüber problematischen politischen Positionen werden könnten.
Welche Rolle spielt die „soziale Hoffnung“ in der Arbeit?
Sie wird im Kontext der Solidarität untersucht, wobei moralische Prinzipien als hilfreiche Versatzstücke der Sozialisation betrachtet werden.
- Quote paper
- M. A. Martin Hagemeier (Author), 2002, Anmerkungen zu Richard Rortys liberaler Ironikerin, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/87823