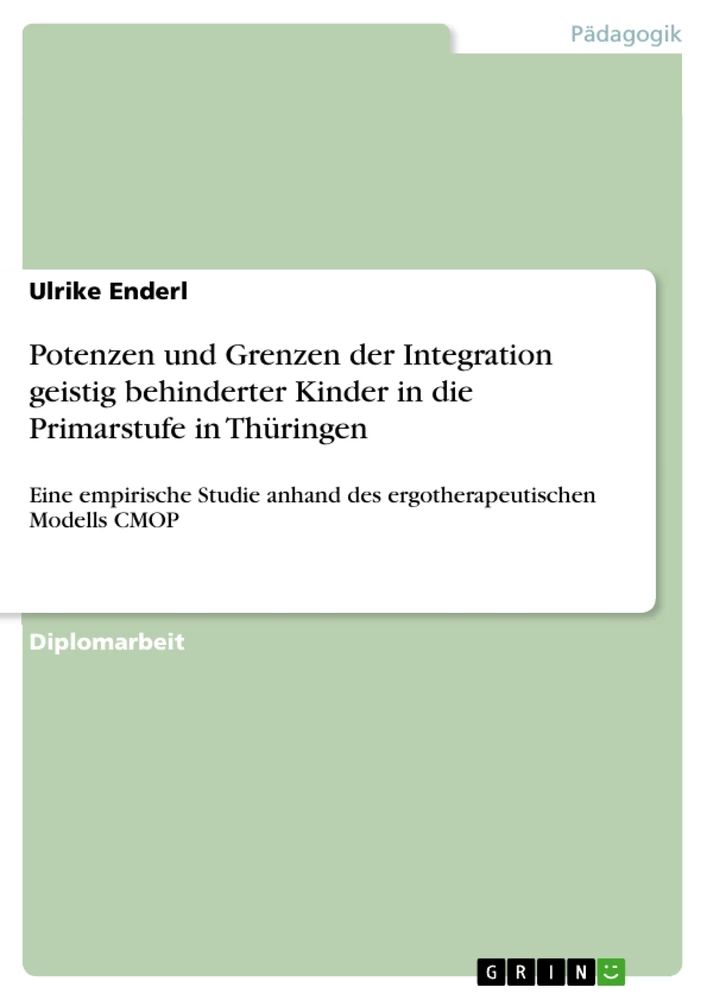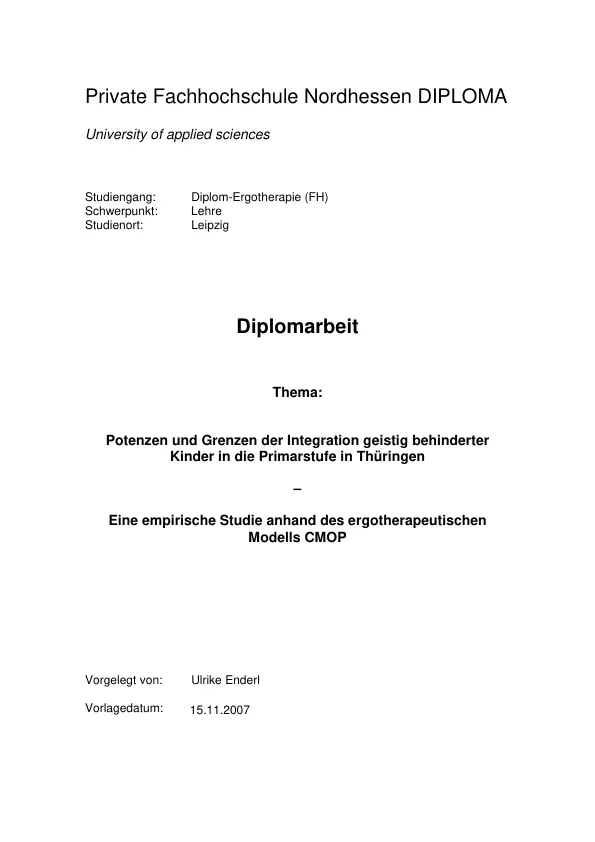Gemeinsamer Unterricht in allgemeinen Schulen unter Beteiligung von Schülern mit geistiger Behinderung wird mittlerweile in fast allen Bundesländern wenn auch in unterschiedlichem Ausmaß realisiert, vor allem in Integrationsklassen oder in kooperativen Organisationsformen.
Bislang wurden weniger als 5% der Schülerschaft in solche Klassen integriert. Dieser Prozentsatz wird in absehbarer Zeit vermutlich nicht wesentlich steigen.
Die Integration beschränkt sich momentan hauptsächlich auf die Grundschule. Hier gibt es weitaus die meisten Kinder mit Behinderungen.
Die weiterführenden Schulen sind in Deutschland, anders als die Grundschule und anders als die Schulen in den meisten Ländern weltweit, geradezu Ausdruck von Selektivität.
Daher steht die Integration von Kindern mit Behinderungen in das Regelschulwesen erst am Anfang ihrer Entwicklung.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Forschungsfragen und Hypothesen
- 3 Material und Methoden
- 4 Ergebnisse der Befragung
- 5 Diskussion der Ergebnisse
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Diplomarbeit untersucht die Potenziale und Grenzen der Integration geistig behinderter Kinder in die Primarstufe in Thüringen. Ziel ist es, mittels einer empirischen Studie anhand des ergotherapeutischen Modells CMOP einen umfassenden Einblick in die Praxis der Integration zu gewinnen und Herausforderungen sowie erfolgreiche Strategien zu identifizieren.
- Integration geistig behinderter Kinder in Thüringer Grundschulen
- Anwendung des CMOP-Modells zur Analyse der Integrationsprozesse
- Erfolgsfaktoren und Herausforderungen der Inklusion
- Perspektiven für eine gelingende Integration
- Empirische Befunde und deren Interpretation
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Diese Einleitung führt in das Thema der Integration geistig behinderter Kinder in die Primarstufe in Thüringen ein. Sie beleuchtet die Relevanz des Themas im Kontext der Inklusion und skizziert den Aufbau der Arbeit. Die Einleitung legt den Fokus auf den Bedarf an empirischer Forschung in diesem Bereich und begründet die Wahl des CMOP-Modells als methodisches Instrument.
2 Forschungsfragen und Hypothesen: Dieses Kapitel formuliert präzise die Forschungsfragen, die im Rahmen der Arbeit untersucht werden. Es werden konkrete Hypothesen aufgestellt, die auf bestehenden Theorien und empirischen Befunden basieren. Die Formulierung der Forschungsfragen und Hypothesen dient als Grundlage für die methodische Vorgehensweise und die Interpretation der Ergebnisse. Der Fokus liegt hier auf der systematischen Untersuchung der Potenziale und Grenzen der Integration.
3 Material und Methoden: Dieses Kapitel beschreibt detailliert die Methodik der empirischen Studie. Es erläutert die Auswahl der Stichprobe, die verwendeten Erhebungsinstrumente und das Vorgehen bei der Datenerhebung und -auswertung. Die Beschreibung der Methodik soll die Nachvollziehbarkeit und die Validität der Ergebnisse gewährleisten. Der Schwerpunkt liegt auf der Beschreibung der Anwendung des CMOP-Modells im Kontext der Integration.
4 Ergebnisse der Befragung: In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der durchgeführten Befragung präsentiert. Die Ergebnisse werden übersichtlich und nachvollziehbar dargestellt, zum Beispiel durch Tabellen und Grafiken. Die Darstellung konzentriert sich auf die relevanten Befunde bezüglich der Potenziale und Grenzen der Integration und berücksichtigt verschiedene Aspekte wie die Ressourcen der Schulen, die Unterstützung der Lehrer und die Teilhabe der Kinder.
5 Diskussion der Ergebnisse: Dieses Kapitel analysiert und interpretiert die Ergebnisse der Befragung. Es wird auf die Zusammenhänge zwischen den einzelnen Ergebnissen eingegangen und diese im Kontext der Forschungsfragen und Hypothesen diskutiert. Die Diskussion bezieht sich auf die praktische Relevanz der Ergebnisse und legt den Schwerpunkt auf die Implikationen für die Praxis der Integration geistig behinderter Kinder. Es werden kritische Aspekte der Studie reflektiert und mögliche Einschränkungen der Ergebnisse benannt.
Schlüsselwörter
Integration, geistig behinderte Kinder, Primarstufe, Thüringen, CMOP-Modell, empirische Studie, Inklusion, Erfolgsfaktoren, Herausforderungen.
Häufig gestellte Fragen zur Diplomarbeit: Integration geistig behinderter Kinder in Thüringer Grundschulen
Was ist der Gegenstand dieser Diplomarbeit?
Die Diplomarbeit untersucht die Potenziale und Grenzen der Integration geistig behinderter Kinder in die Primarstufe in Thüringen. Sie nutzt das ergotherapeutische Modell CMOP, um einen umfassenden Einblick in die Praxis der Integration zu gewinnen und Herausforderungen sowie erfolgreiche Strategien zu identifizieren.
Welche Forschungsfragen werden behandelt?
Die Arbeit formuliert präzise Forschungsfragen, die im Rahmen der Arbeit untersucht werden. Es werden konkrete Hypothesen aufgestellt, die auf bestehenden Theorien und empirischen Befunden basieren. Die Formulierung der Forschungsfragen und Hypothesen dient als Grundlage für die methodische Vorgehensweise und die Interpretation der Ergebnisse. Der Fokus liegt auf der systematischen Untersuchung der Potenziale und Grenzen der Integration.
Welche Methodik wurde angewendet?
Die Arbeit beschreibt detailliert die Methodik der empirischen Studie. Es wird die Auswahl der Stichprobe, die verwendeten Erhebungsinstrumente und das Vorgehen bei der Datenerhebung und -auswertung erläutert. Die Beschreibung der Methodik soll die Nachvollziehbarkeit und die Validität der Ergebnisse gewährleisten. Der Schwerpunkt liegt auf der Beschreibung der Anwendung des CMOP-Modells im Kontext der Integration.
Welche Ergebnisse wurden erzielt?
Das Kapitel zu den Ergebnissen präsentiert die Befunde der durchgeführten Befragung übersichtlich und nachvollziehbar, zum Beispiel durch Tabellen und Grafiken. Die Darstellung konzentriert sich auf relevante Befunde bezüglich der Potenziale und Grenzen der Integration und berücksichtigt verschiedene Aspekte wie die Ressourcen der Schulen, die Unterstützung der Lehrer und die Teilhabe der Kinder.
Wie werden die Ergebnisse interpretiert und diskutiert?
Die Ergebnisse der Befragung werden analysiert und interpretiert. Es wird auf die Zusammenhänge zwischen den einzelnen Ergebnissen eingegangen und diese im Kontext der Forschungsfragen und Hypothesen diskutiert. Die Diskussion bezieht sich auf die praktische Relevanz der Ergebnisse und legt den Schwerpunkt auf die Implikationen für die Praxis der Integration geistig behinderter Kinder. Kritische Aspekte der Studie werden reflektiert und mögliche Einschränkungen der Ergebnisse benannt.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Integration, geistig behinderte Kinder, Primarstufe, Thüringen, CMOP-Modell, empirische Studie, Inklusion, Erfolgsfaktoren, Herausforderungen.
Welches Modell wird verwendet?
Die Arbeit verwendet das ergotherapeutische Modell CMOP (Canadian Model of Occupational Performance) zur Analyse der Integrationsprozesse.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit umfasst folgende Kapitel: Einleitung, Forschungsfragen und Hypothesen, Material und Methoden, Ergebnisse der Befragung, Diskussion der Ergebnisse.
Wo liegt der Fokus der Arbeit?
Der Fokus liegt auf der empirischen Untersuchung der Potenziale und Grenzen der Integration geistig behinderter Kinder in Thüringer Grundschulen und der Identifizierung von Erfolgsfaktoren und Herausforderungen.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Ziel der Arbeit ist es, mittels einer empirischen Studie anhand des CMOP-Modells einen umfassenden Einblick in die Praxis der Integration geistig behinderter Kinder zu gewinnen.
- Arbeit zitieren
- Ulrike Enderl (Autor:in), 2007, Potenzen und Grenzen der Integration geistig behinderter Kinder in die Primarstufe in Thüringen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/87886