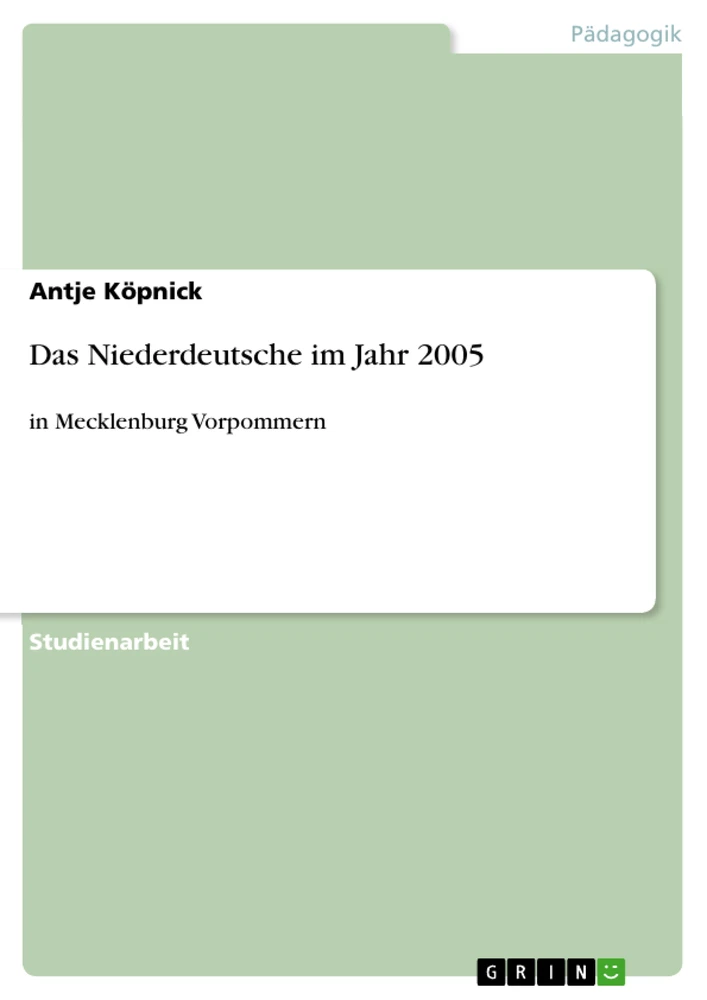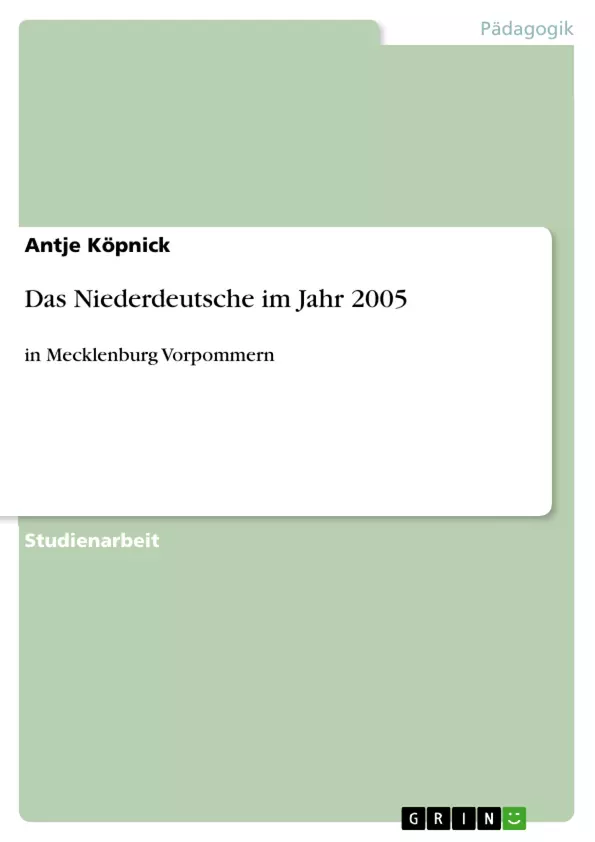1 Vorbemerkung
Das Thema der vorliegenden Arbeit ist die aktuelle Situation des Niederdeutschen in Mecklenburg Vorpommern, welches im Folgenden als Dialekt bzw. Mundart bezeichnet wird. Diese zwei Begriffe werden synonym gebraucht und verweisen auf die regionale Gebundenheit, die Ähnlichkeit zu anderen Systemen (welche mindestens partielle Verstehbarkeit ermöglicht), sowie das Fehlen einer Standardisierung im Sinne offiziell normierter orthografischer und grammatischer Regeln. Es handelt sich um die im Umgang gesprochene Sprache .
Als weiter gefassten Begriff möchte ich auch den der Varietät aufnehmen, da Sprache aus einer Vielzahl dieser besteht. Varietät gilt als nicht wertender, neutraler Grundbegriff der Soziolinguistik , dessen Eigenschaften beispielsweise von historischen, regionalen, sozialen oder situativen Gegebenheiten abhängen. Genauer gesagt, sind es außersprachliche Faktoren, die die Varietät beeinflussen (Alter, Geschlecht, Gruppe, Region, historische Periode, Stil ). Diese sollen die verschiedenen Gesichtspunkte hergeben, unter denen das Thema untersucht wird.
Sprache ist in der Regel ein mehrdimensionaler Raum von Varietäten, je nach der Geschichte und dem sozialen Gefüge der Sprachgemeinschaften, in denen sie lokalisiert sind. Die Varietäten sind in diesem Raum Schnittstellen (Produkte) historischer, regionaler, sozialer und situationsbedingter Faktoren.
Entsprechend dieser zitierten Faktoren, erfolgt zunächst ein historischer Abriss (Kapitel 1), der helfen soll, die Entwicklung des Niederdeutschen zu klären. Es handelt sich hierbei um die Betrachtung der diachronen Dimension der Mundart – das Augenmerk liegt auf der Unterscheidung historischer Perioden/ Stadien (Altniederdeutsch, Mittelniederdeutsch, Neuniederdeutsch). Dies soll dazu beitragen, Tendenzen und Entwicklungen aufzuzeigen und zu verdeutlichen. Gerade die Frage nach dem Prestige und der Bewertung der niederdeutschen Mundart soll hier eine Rolle spielen.
Im 2. Kapitel werden dann Umfragen ausgewertet werden, die im Zeitraum August – September 2005 durchgeführt wurden. Der Blick wird auf die aktuelle Situation des Niederdeutschen gerichtet, wobei die diastratische (soziale) Dimension der Variation untersucht wird. Es stehen die Fragen nach dem realen Sprecher der niederdeutschen Mundart, dem soziokulturellen Umfeld und den Maßnahmen, die zum Erhalt des Dialekts getroffen werden oder werden sollen im Mittelpunkt. Wichtig sind an dieser Stelle die oben bereits erwähnten außersprachlichen sozialen und situationsbedingten Faktoren, wie z.B. Alter, Geschlecht, Status und Gruppe. Die diastratischen Unterschiede sind in den sozial-kulturellen Schichten zu suchen, während die diaphasische Dimension auf die Situation abzielt (Unterschiede in der Ausdrucksmodalität). Man bezeichnet sie auch als funktionale Sprachvarietäten: Der Sprecher wählt in verschieden Situationen aus unterschiedlichen Sprachregistern aus.
Es sollen also die soziolinguistischen Fragestellungen nach
- den Normen des Sprachgebrauchs ,
- den Zusammenhängen von Sozioökonomie,
- Geschichte,
- Kultur und
- sozialer Schichtung
untersucht werden, welche am Ende ein umfassendes Bild ergeben sollen über die Entwicklung des Niederdeutschen bis heute, den aktuellen Stand, dessen Bewertung und die Arbeit an evtl. vorhandenen problematischen Tendenzen
Inhaltsverzeichnis
- Vorbemerkung
- Die Entwicklung der niederdeutschen Sprache bis heute
- Das Altniederdeutsche
- Das Mittelniederdeutsche - die Hansezeit
- Das Neuniederdeutsche
- Vom 16. zum 19. Jahrhundert – Zeit des Übergangs
- Hochdeutsch und Niederdeutsch - ein ungleiches Verhältnis
- Missingsch
- Das 20. Jahrhundert
- Niederdeutsche Einsprengsel in der hochdeutschen Literatur
- Zwanziger Jahre bis Nachkriegszeit
- Das Niederdeutsche in der DDR
- Plattdeutsch heute
- Der Plattsprecher
- Wer spricht mit wem Plattdeutsch?
- Die Bedeutung des Plattdeutschen
- Das Angebot der Medien
- Plattdeutsch in der Bildung
- Rahmenpläne und gesetzliche Verankerungen
- Die gegenwärtige Situation in Kindergärten, Schulen und Hochschulen
- Der Plattsprecher
- Zusammenfassung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die aktuelle Situation des Niederdeutschen in Mecklenburg-Vorpommern. Ziel ist es, ein umfassendes Bild der Entwicklung, des aktuellen Stands und der Bewertung des Niederdeutschen zu liefern, einschließlich der Analyse möglicher problematischer Tendenzen. Die Arbeit betrachtet historische Entwicklungen, die soziolinguistische Situation und den Stellenwert des Niederdeutschen im Bildungssystem.
- Historische Entwicklung des Niederdeutschen (Alt-, Mittel- und Neuniederdeutsch)
- Soziolinguistische Aspekte des Niederdeutschen im Jahr 2005 in Mecklenburg-Vorpommern
- Der aktuelle Sprachgebrauch und die Bedeutung des Niederdeutschen
- Der Stellenwert des Niederdeutschen in der Bildung
- Zukunftsaussichten des Niederdeutschen
Zusammenfassung der Kapitel
Vorbemerkung: Diese Arbeit befasst sich mit der aktuellen Situation des Niederdeutschen in Mecklenburg-Vorpommern und definiert die verwendeten Begriffe Dialekt und Mundart sowie den soziolinguistischen Begriff der Varietät. Sie legt den methodischen Ansatz der Arbeit dar, der sich auf historische Entwicklung, soziolinguistische Faktoren und die Situation in Bildungseinrichtungen konzentriert.
Die Entwicklung der niederdeutschen Sprache bis heute: Dieses Kapitel bietet einen historischen Überblick über die Entwicklung des Niederdeutschen von seinen althochdeutschen Wurzeln über das Mittelniederdeutsche bis zum Neuniederdeutschen. Es beleuchtet die verschiedenen Entwicklungsphasen und die wechselnde Bewertung des Niederdeutschen im Vergleich zum Hochdeutschen, insbesondere die Frage nach dem Prestigeverlust.
Plattdeutsch heute: Dieses Kapitel analysiert die aktuelle Situation des Niederdeutschen in Mecklenburg-Vorpommern anhand von Umfragen aus dem Jahr 2005. Es untersucht, wer Plattdeutsch spricht, welche soziokulturellen Faktoren eine Rolle spielen und welche Maßnahmen zum Erhalt des Dialekts ergriffen werden. Es beleuchtet die Bedeutung des Niederdeutschen für die Sprecher und die Rolle der Medien sowie des Bildungssystems in Bezug auf die Verbreitung und den Erhalt der Sprache. Die Kapitel untersuchen die diastratische und diaphasische Dimension der Sprachvariation, also die sozialen und situativen Faktoren, die den Sprachgebrauch beeinflussen.
Schlüsselwörter
Niederdeutsch, Mecklenburg-Vorpommern, Dialekt, Mundart, Varietät, Soziolinguistik, Sprachentwicklung, Hochdeutsch, Sprachgebrauch, Bildung, Medien, Erhalt der Sprache, historische Entwicklung, soziale Schichtung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: "Die aktuelle Situation des Niederdeutschen in Mecklenburg-Vorpommern"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht umfassend die aktuelle Situation des Niederdeutschen in Mecklenburg-Vorpommern. Sie beleuchtet die historische Entwicklung, den gegenwärtigen Sprachgebrauch, die soziolinguistischen Aspekte und den Stellenwert des Niederdeutschen im Bildungssystem.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die historische Entwicklung des Niederdeutschen (Alt-, Mittel- und Neuniederdeutsch), soziolinguistische Aspekte (wer spricht Plattdeutsch, welche Rolle spielen soziale Faktoren), den aktuellen Sprachgebrauch und die Bedeutung des Niederdeutschen, den Stellenwert im Bildungssystem (Kindergärten, Schulen, Hochschulen), und gibt einen Ausblick auf die Zukunftsaussichten des Niederdeutschen.
Welche Methode wird in der Arbeit verwendet?
Die Arbeit verwendet einen methodischen Ansatz, der sich auf die historische Entwicklung, soziolinguistische Faktoren und die Situation in Bildungseinrichtungen konzentriert. Sie bezieht Daten aus Umfragen (Stand 2005) mit ein.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in Kapitel zur Vorbemerkung (Definitionen, methodischer Ansatz), zur Entwicklung des Niederdeutschen (von den althochdeutschen Wurzeln bis heute, inklusive der Beziehung zu Hochdeutsch), zur aktuellen Situation des Niederdeutschen (Sprachgebrauch, Medien, Bildung), und schliesst mit einer Zusammenfassung und einem Ausblick.
Welche Schlüsselbegriffe werden in der Arbeit verwendet?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Niederdeutsch, Mecklenburg-Vorpommern, Dialekt, Mundart, Varietät, Soziolinguistik, Sprachentwicklung, Hochdeutsch, Sprachgebrauch, Bildung, Medien, Erhalt der Sprache, historische Entwicklung, soziale Schichtung.
Welche Aspekte der soziolinguistischen Situation werden betrachtet?
Die Arbeit untersucht wer Plattdeutsch spricht, mit wem, und welche soziokulturellen Faktoren den Sprachgebrauch beeinflussen. Dabei werden die diastratische (soziale Schichtung) und diaphasische (situationale Faktoren) Dimensionen der Sprachvariation berücksichtigt.
Welche Rolle spielt das Bildungssystem?
Die Arbeit analysiert den Stellenwert des Niederdeutschen im Bildungssystem, inklusive Rahmenplänen, gesetzlichen Verankerungen und der gegenwärtigen Situation in Kindergärten, Schulen und Hochschulen.
Welche Quellen werden verwendet?
Die Arbeit bezieht sich auf historische Quellen zur Sprachentwicklung und auf Umfragedaten aus dem Jahr 2005 zur aktuellen soziolinguistischen Situation in Mecklenburg-Vorpommern. Die genauen Quellenangaben sind im Haupttext der Arbeit aufgeführt (nicht in diesem FAQ).
Was ist das Ziel der Arbeit?
Ziel der Arbeit ist es, ein umfassendes Bild der Entwicklung, des aktuellen Stands und der Bewertung des Niederdeutschen in Mecklenburg-Vorpommern zu liefern und mögliche problematische Tendenzen zu analysieren.
Gibt es einen Ausblick auf die Zukunft des Niederdeutschen?
Ja, die Arbeit enthält eine Zusammenfassung und einen Ausblick, der die Zukunftsaussichten des Niederdeutschen im Kontext der dargestellten Ergebnisse bewertet.
- Quote paper
- Antje Köpnick (Author), 2005, Das Niederdeutsche im Jahr 2005, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/87894