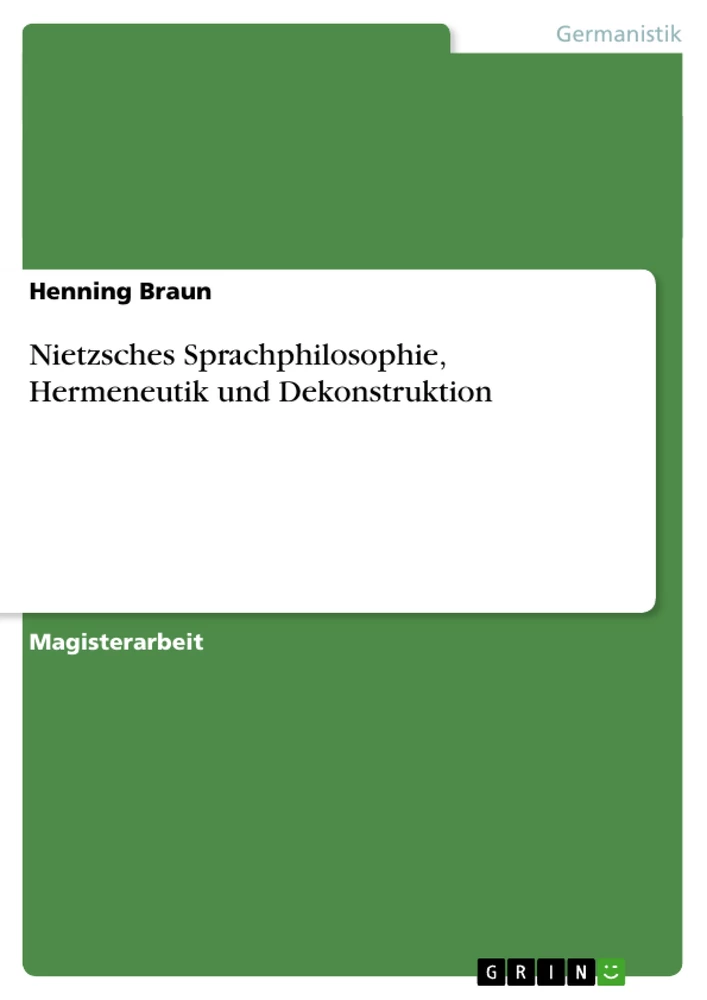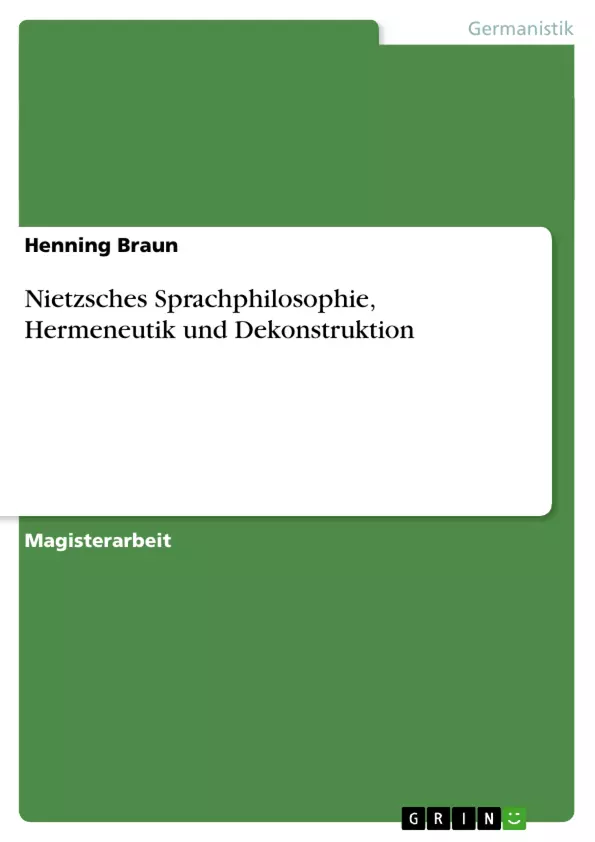Die Arbeit handelt über Nietzsches Sprachphilosophie (Ueber Wahrheit und Lüge im aussermoralischen Sinne), Gadamers Hermeneutik (Wahrheit und Methode) und die Dekonstruktion von de Man (Allegorien des Lesens).
Es geht nicht um Hermeneutik, Dekonstruktion und Sprachphilosophie im Allgemeinen, sondern um die ausgewählten Texte. Hier besteht auch schon ein in der Arbeit behandeltes Problem. Es geht um die abstrakten Begriffe, die am Individuellen entstanden sind, es durch ihre Verallgemeinerung aber wieder ausklammern. Dennoch sind Verallgemeinerungen notwendige Arbeitshypothesen, ohne die keine Kommunikation möglich wäre. Durch solch eine begriffene Begrifflichkeit entsteht so manches Paradox der Selbstrelativierung.
Im ersten Kapitel stelle ich Nietzsches Gedanken über Funktion und Wahrheit von Sprache und Erkenntnis dar. Am Schluss des behandelten Textes wird ein Gegensatz von Wissenschaft und Literatur aufgestellt. So werde ich am Schluss des Kapitels eine mögliche Literaturwissenschaft im Sinne Nietzsches aufstellen, die die folgenden zwei Kapitel konstruktiv vorbereiten soll.
Gadamers Hermeneutik ist das Thema des zweiten Kapitels. Obwohl es sich bei seiner Hermeneutik um Verstehen im Allgemeinen handelt, nimmt nun das Verstehen „seine eigentliche Wendung ins Hermeneutische, wo es sich um das Verstehen von Texten handelt.“ Das resultierende (hermeneutische) Problem lässt sich dann mit Nietzsches angleichenden Begriffen erklären, die im hermeneutischen Dialog wieder zu (gemeinsamen) Sinn erweckt werden müssen. Besondere Aufmerksamkeit gilt schließlich der Auslegung von literarischen Texten. Dort wird der Gebrauch des hermeneutischen Zirkels und der wirkungsgeschichtlichen Horizontverschmelzung noch einmal explizit auf Literatur bezogen.
Die Dekonstruktion von de Man ist das Thema des dritten Kapitels. Die Bezüge zur Hermeneutik stellt er selbst immer wieder her. Auch zu Nietzsche gibt es Kapitel in dem Buch, die ich jedoch nicht behandeln werde, ‚denn wir können nicht a priori sicher sein, zu dem, was auch immer [de Man] über [Nietzsche] zu sagen hat, ausgerechnet dadurch Zugang zu erhalten, dass wir eine Szene, die von [Nietzsche] handelt, lesen.’ Diese Bezüge erscheinen in der (unbewussten) ‚Praxis’ der „Allegorien des Lesens“ viel deutlicher.
Im schließenden Kapitel widme ich mich besonders dem Paradox und der Tautologie. Beide tauchen in allen behandelten Texten auf, und können als zentral für deren Argumentation angesehen werden.
Inhaltsverzeichnis
- 0. Der einleitende Text
- 1. Der lügende Text (Nietzsche)
- 1.1 Unsere fabelhafte Welt
- 1.2 Getriebenes Bewusstsein
- 1.3 Begreifliche Nerven
- 1.4 Begriffene Metaphern
- 1.5 Begreifende Wahrheit
- 1.6 Schützende Abstraktion
- 1.8 Getriebene Begriffe
- 1.7 Perspektivische Perzeptionen
- 1.9 Nietzsches Sprache
- 1.10 Literaturtheorie, über Wahrheit und Lüge'
- 1.11 Im Dialog (mit Gadamer)
- 2. Der wahre Text (Gadamer)
- 2.1 Transzendierter Sinn
- 2.2 Abgelöster Vollzug
- 2.3 Der herme(neu)tische Zirkel
- 2.4 Fließender Schluss
- 2.5 Wirkende Horizonte
- 2.6 Der hermeneutische Text
- 2.7 Gewalttätige Einheit
- 3. Der ambivalente Text (de Man)
- 3.1 Theoretische Praxis
- 3.2 Fragliche Rhetorik
- 3.3 Praktizierte Predigt
- 3.4 Rhetorische Einheit
- 3.5 Konflikt der Generationen
- 3.6 Gespiegelter Spiegel
- 3.7 Sprache an sich (?)\li>
- 3.8 Paradoxe Katharsis
- 3.9 Diskursive Logik
- 4. Der schließende Text
- 4.1 Traditionslose Literatur
- 4.2 Literarische Wissenschaft
- 4.3 Sinnliche Struktur
- 4.4 Paradoxer Zirkel
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert Nietzsches Sprachphilosophie, Gadamers Hermeneutik und de Mans Dekonstruktion, indem sie sich auf die zentralen Texte „Ueber Wahrheit und Lüge im aussermoralischen Sinne“, „Wahrheit und Methode“ und „Allegorien des Lesens“ konzentriert. Ziel ist es, die sprachphilosophischen Ansätze der drei Autoren zu vergleichen und zu analysieren, wie sie zur Entwicklung eines literaturwissenschaftlichen Verständnisses beitragen.
- Die Rolle von Sprache und Erkenntnis in Nietzsches „Ueber Wahrheit und Lüge im aussermoralischen Sinne“
- Gadamers Hermeneutik und das Verstehen von Texten
- de Mans Dekonstruktion und ihre Anwendung auf literarische Texte
- Die Beziehung zwischen Sprache, Wahrheit und Interpretation
- Die Rolle von Paradoxen und Tautologien in den jeweiligen Denktraditionen
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel befasst sich mit Nietzsches „Ueber Wahrheit und Lüge im aussermoralischen Sinne“, indem es seine Gedanken über Sprache und Erkenntnis sowie die menschliche Wahrnehmung der Welt beleuchtet. Das Kapitel beleuchtet Nietzsches Kritik an der traditionellen Vorstellung von Wahrheit und zeigt, wie er Sprache als eine Konstruktion der Wirklichkeit versteht.
Das zweite Kapitel widmet sich Gadamers Hermeneutik. Es analysiert seine Ansichten über das Verstehen von Texten und das Zusammenspiel von Text und Interpret, wobei der hermeneutische Zirkel und das Konzept des Horizonts eine zentrale Rolle spielen.
Das dritte Kapitel widmet sich de Mans Dekonstruktion und zeigt, wie er die traditionellen Ansätze der Textinterpretation in Frage stellt und die Ambivalenz und Mehrdeutigkeit von Sprache und Texten betont.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit zentralen Begriffen der Sprachphilosophie, Hermeneutik und Dekonstruktion. Hierzu zählen Themen wie Sprache, Wahrheit, Lüge, Erkenntnis, Interpretation, Hermeneutischer Zirkel, Horizontverschmelzung, Ambivalenz, Mehrdeutigkeit, Paradox und Tautologie.
- Quote paper
- Magister Henning Braun (Author), 2006, Nietzsches Sprachphilosophie, Hermeneutik und Dekonstruktion, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/87917