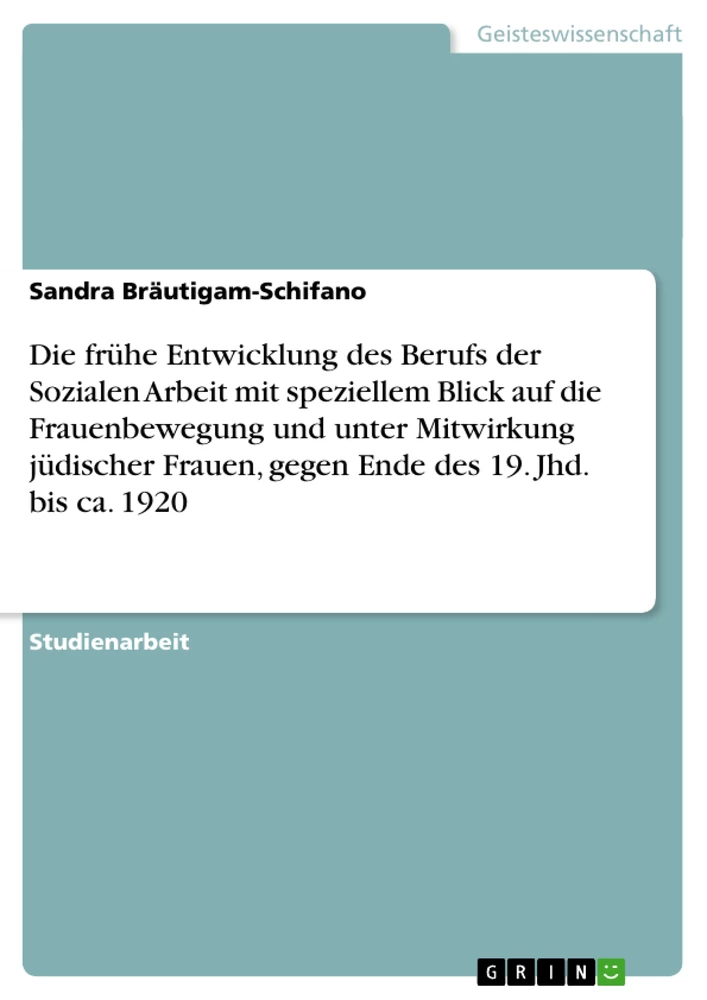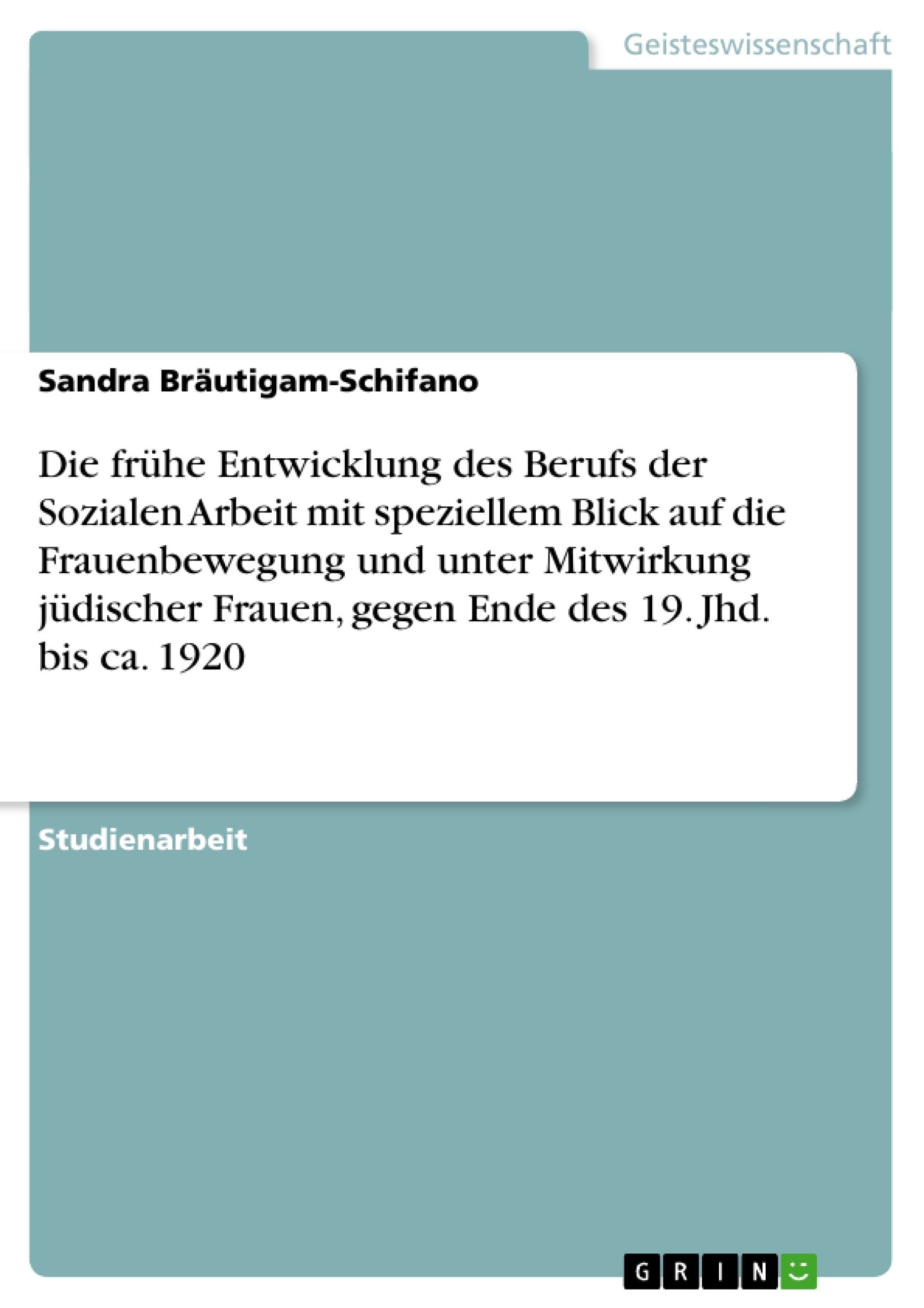In der Mitte des 19. Jhd. erkämpften Frauenbewegungen mehr Rechte für sich. Die traditionelle Arbeit der Frauen veränderte sich rapide, durch die zunehmende Industrialisierung. Frauen unterer Schichten erfuhren in dieser Zeit eine Doppelbelastung, aufgrund ökokomischer Schieflagen. Die Frauen des Bürgertums waren entlastet durch Dienstmägde und Kindermädchen, aber auch durch Fortschritte in der Technik. Dennoch blieb ihnen eine höhere Bildung und Berufstätigkeit verwehrt. Diese Frauen suchten nach neuen Handlungsfeldern. Im Bereich der „socialen Fürsorge“ eröffneten sich für den weiblichen Mittelstand diese Handlungsräume. Sie dienten aber nicht als Erwerbsberuf, sondern waren die soziale Verpflichtung des bürgerlichen Mittelstands gegenüber den unteren Schichten. Bürgerliche Frauen sollten ihre angeborenen Fähigkeiten der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen, indem sie sich sozial engagierten. Dieses Engagement verstand sich nicht als Berufstätigkeit, sondern als Verpflichtung gegenüber der Gesellschaft. Henriette Schrader-Breymann formulierte den Begriff „Mütterlichkeit“, d.h. die Fähigkeit und Begabung der Frau im Bereich der Erziehung, Pflege, Fürsorge, Emotionalität und Zuwendung. Alice Salomon schaffte eine soziale Ausbildung, die die soziale und fachliche Eignung des ehrenamtlichen Engagements unterstützen sollte. Eine berufliche Qualifikation im Sinne von Erwerbstätigkeit spielte dabei keine Rolle. Mit der zunehmenden Frage nach Personal in der Armenpflege wandelte sich die dienende soziale Arbeit der Frau zur Sozialarbeit, in der es weniger um ehrenamtliches Engagement als um Erwerbstätigkeit ging. Das Tätigkeitsfeld der Sozialen Arbeit öffnete sich jetzt auch den anderen Bevölkerungsschichten. (vgl. Kerntext Modul 01a)
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Ursprünge der Sozialen Arbeit
- Folgen der Industrialisierung
- Situation der bürgerlichen Frau im 19. Jhd.
- Mütterlichkeit – Weibliche Kulturleistung
- Entwicklung der Frauenbewegung
- Frauenvereine - Frauenbewegung
- Die Mädchen- und Frauengruppen in Berlin
- Jüdinnen in der Sozialen Arbeit
- Traditionelles Judentum - Die Rolle der Frau
- Assimilation ins deutsche Bürgertum
- Jüdinnen in bürgerlichen Wohltätigkeitsvereinen
- Das Wirken von Alice Salomon und ihr Einfluss auf die Soziale Arbeit
- Alice Salomon – Kurzbiographie
- Ihr Beitrag zur Sozialen Arbeit
- Verberuflichung der Sozialen Arbeit
- Erste Ausbildungsstätten
- Soziale Frauenschulen
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit befasst sich mit der frühen Entwicklung des Berufs der Sozialen Arbeit, insbesondere mit der Rolle der Frauenbewegung und dem Einfluss jüdischer Frauen in der Zeit von Ende des 19. Jahrhunderts bis ca. 1920. Der Fokus liegt auf den Lebensbedingungen und den Handlungsfeldern dieser Frauen, um die Entstehung und Entwicklung der Sozialen Arbeit in diesem Kontext zu verstehen.
- Die Auswirkungen der Industrialisierung auf die Gesellschaft und die Lebensverhältnisse von Frauen
- Die Rolle der bürgerlichen Frauenbewegung und deren Engagement in der sozialen Fürsorge
- Die Bedeutung jüdischer Frauen in der Frauenbewegung und in der Sozialen Arbeit
- Das Wirken von Alice Salomon und ihre Beiträge zur Institutionalisierung der Sozialen Arbeit
- Die Verberuflichung der Sozialen Arbeit und die Entstehung erster Ausbildungsstätten
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einem Blick auf die Ursprünge der Sozialen Arbeit, die im Kontext der Industrialisierung und der daraus resultierenden sozialen Veränderungen entstanden. Im 19. Jahrhundert erlebten Frauen in unterschiedlichen gesellschaftlichen Schichten die Auswirkungen der Industrialisierung.
Kapitel 2 betrachtet die Folgen der Industrialisierung für die bürgerliche Frau im 19. Jahrhundert. Die Veränderungen im häuslichen Bereich, die Abdrängung der Frauen aus traditionellen Berufsfeldern und die Suche nach neuen Handlungsräumen werden beleuchtet. Im Fokus steht dabei auch die Rolle der „Mütterlichkeit“ und der „geistigen Mütterlichkeit“ als spezifische weibliche Kulturleistung.
Kapitel 3 thematisiert die Entstehung und Entwicklung der Frauenbewegung, wobei besondere Aufmerksamkeit auf die Rolle von Frauenvereinen und die Mädchen- und Frauengruppen in Berlin gelegt wird. Diese Kapitel stellen die Motivationen und Ziele der Frauenbewegung im Kontext der Zeit dar und zeigen die Verbindung zum Thema Soziale Arbeit auf.
Kapitel 4 untersucht das Engagement jüdischer Frauen in der Sozialen Arbeit. Die Rolle der Frau im traditionellen Judentum, der Prozess der Assimilation ins deutsche Bürgertum und die Beteiligung jüdischer Frauen in bürgerlichen Wohltätigkeitsvereinen werden beleuchtet.
Kapitel 5 widmet sich dem Wirken von Alice Salomon und ihrem Einfluss auf die Soziale Arbeit. Die Arbeit beleuchtet ihre Kurzbiographie, ihren Beitrag zur sozialen Ausbildung und ihre Rolle in der Institutionalisierung der Sozialen Arbeit.
Kapitel 6 beleuchtet die Verberuflichung der Sozialen Arbeit. Die Entstehung erster Ausbildungsstätten und sozialer Frauenschulen, die den Wandel von ehrenamtlichem Engagement zu einer professionalisierten Form der Sozialen Arbeit markieren, werden betrachtet.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beleuchtet die Themen Industrialisierung, Frauenbewegung, soziale Fürsorge, Mütterlichkeit, bürgerliche Frauen, jüdische Frauen, Alice Salomon, Verberuflichung, Soziale Arbeit, Ausbildung und Professionalisierung. Die Arbeit stellt die Bedeutung dieser Schlüsselbegriffe im Kontext der frühen Entwicklung der Sozialen Arbeit und der Rolle von Frauen dar.
Häufig gestellte Fragen
Welche Rolle spielten bürgerliche Frauen für die Entstehung der Sozialen Arbeit?
Bürgerliche Frauen suchten im 19. Jahrhundert nach neuen Handlungsfeldern und sahen in der "socialen Fürsorge" eine moralische Verpflichtung gegenüber den unteren Schichten.
Was bedeutet der Begriff "geistige Mütterlichkeit"?
Er beschreibt die Übertragung mütterlicher Fähigkeiten wie Pflege und Erziehung auf den öffentlichen Raum, um soziale Probleme der Industrialisierung zu bewältigen.
Welchen Beitrag leistete Alice Salomon zur Sozialen Arbeit?
Alice Salomon professionalisierte das Ehrenamt durch die Gründung sozialer Frauenschulen und schuf damit die Grundlage für die Verberuflichung der Sozialarbeit.
Welchen Einfluss hatten jüdische Frauen auf diese Entwicklung?
Jüdische Frauen waren stark in bürgerlichen Wohltätigkeitsvereinen engagiert und trugen wesentlich zur Dynamik der Frauenbewegung und der sozialen Reformen bei.
Wie veränderte die Industrialisierung die soziale Tätigkeit von Frauen?
Die zunehmende Not der Arbeiterschichten führte dazu, dass aus gelegentlichem ehrenamtlichem Engagement eine strukturierte und schließlich berufliche Tätigkeit wurde.
- Arbeit zitieren
- Sandra Bräutigam-Schifano (Autor:in), 2007, Die frühe Entwicklung des Berufs der Sozialen Arbeit mit speziellem Blick auf die Frauenbewegung und unter Mitwirkung jüdischer Frauen, gegen Ende des 19. Jhd. bis ca. 1920, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/87928