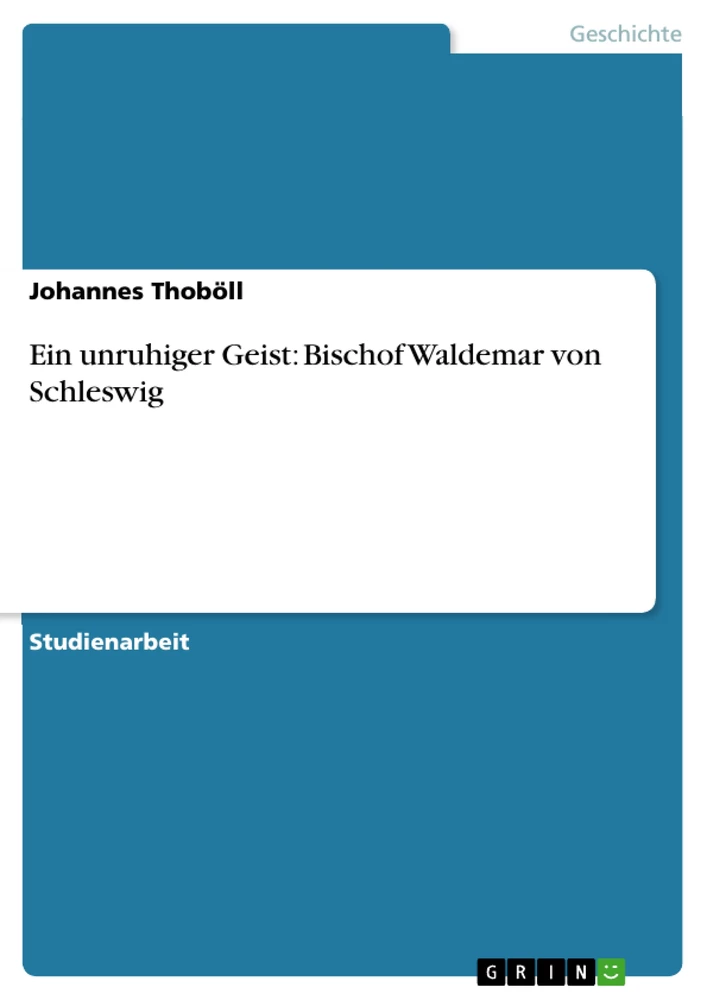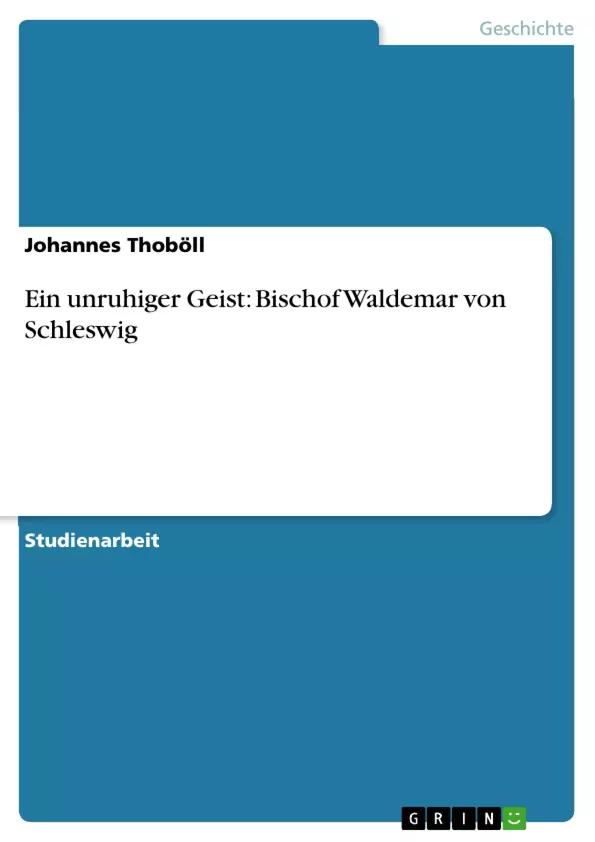Diese Arbeit befasst sich mit Bischof Waldemar von Schleswig, der von 1157/58 bis 1235/36 lebte. In diesem Zeitraum war Dänemark die vorherrschende Macht im Ostseeraum. Mit der Reichseinheit 1157 unter Waldemar I. begann eine Expansionspolitik Dänemarks, von der dessen Anrainer stark betroffen waren und die erst mit der Schlacht von Bornhöved 1227 endete.
Eingebunden in diese Umstände zielt die vorliegende Arbeit darauf ab, das Leben des Bischofs Waldemar von Schleswig zu beschreiben und ihn in Verbindung mit dem dänischen Ostseeimperium zu bringen. Ein besonderes Augenmerk wird hierbei auf den Streit des Bischofs mit seinen Vettern gelegt, da der Grundstein für das Verhalten des Bischofs war. Zudem werden die Auswirkungen des Vetternstreits auf das Ostseeimperium betrachtet und es soll geklärt werden, inwieweit Bischof Waldemar eine Gefahr für das dänische Reich dargestellt hat.
Die Hauptquelle zur Geschichte des Bischofs Waldemar von Schleswig ist die Chronik „Arnoldi Chronica Slavorum“ des Arnolds von Lübeck. Für die Glaubwürdigkeit dieser Quelle spricht die Tatsache, dass Arnold zu jener Zeit Abt in Lübeck war. Es ist davon auszugehen, dass er seine Informationen von Bischof Dietrich von Lübeck bezogen hat, der Bremer war und vermutlich „viele Freunde und Bekannte in Bremen besaß, die ihn über die Vorgänge unterrichten konnten“ . Es somit sehr wahrscheinlich, dass Arnold gute Kenntnisse über die Ereignisse in Bremen hatte, wo Bischof Waldemar 1192/93 zum Erzbischof ernannt wurde.
Ein weiterer Chronist dieser Zeit ist Saxo Grammaticus, der in der Gesta Danorum die Geschichte Dänemarks von den Anfängen des Reiches bis 1185 erzählt. Riis verweist allerdings darauf, dass „seine gezielte Glorifizierung des dänischen Königtums und dessen christianisierende Expansion im Ostseeraum ihn mehrmals die historischen Tatsachen der zu vermittelnden Ideologie unterordnen lässt“ .
Andere Quellen sind päpstliche Urkunden sowie Briefe, die während der Gefangenschaft des Bischofs verfasst worden sind.
Diese Arbeit verbindet Ansätze verschiedener Autoren, die unterschiedliche Facetten der Geschichte des Bischofs beschrieben haben. Als Beispiel für diese Autoren können Godt und Freytag genannt werden, die jeweils einen Aufsatz über den Bischof verfasst haben.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Die Biografie des Bischofs Waldemar von Schleswig
- 3. Die Lage in Holstein und Nordelbingen
- 4. Der Vetternstreit
- 4.1 Die Datierungsproblematik
- 4.2 Die Gründe für die Auseinandersetzung
- 4.3 Die Wahl Bischof Waldemars zum Erzbischof von Bremen 1192/93
- 4.4 Eskalation: Angriff des Bischofs auf Dänemark
- 5. Zeit der Gefangenschaft und Flucht des Bischofs aus Rom
- 5.1 Die Gefangenschaft zwischen 1193 und 1206
- 5.2 Das Verhalten der Kurie zur Zeit der Gefangenschaft
- 5.3 Der Prozess und die Flucht
- 5.4 Das Leben des Bischofs nach seiner Flucht bis hin zu seinem Tod
- 6. Bischof Waldemars Bedeutung für das mittelalterliche dänische Ostseeimperium
- 7. Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Leben von Bischof Waldemar von Schleswig (1157/58-1235/36) im Kontext des dänischen Ostseeimperiums. Sie beschreibt sein Leben und analysiert seinen Konflikt mit seinen Vettern, dessen Auswirkungen auf das Ostseeimperium und die Frage, inwieweit Waldemar eine Gefahr für Dänemark darstellte. Die Arbeit stützt sich auf verschiedene Quellen, darunter die Chronik Arnolds von Lübeck und die Gesta Danorum von Saxo Grammaticus.
- Das Leben und Wirken Bischof Waldemars von Schleswig
- Der Vetternstreit und seine Ursachen
- Die Auswirkungen des Konflikts auf das dänische Ostseeimperium
- Die Rolle Waldemars im politischen Gefüge des Mittelalters
- Analyse verschiedener historiografischer Ansätze zum Thema
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und beschreibt den Kontext des dänischen Ostseeimperiums während des Lebens Bischof Waldemars. Sie benennt die Ziele der Arbeit, nämlich die Darstellung des Lebens des Bischofs und seine Einbettung in die Geschichte des dänischen Ostseeimperiums, mit besonderem Fokus auf den Konflikt mit seinen Vettern und dessen Auswirkungen. Es wird auf die wichtigsten Quellen, wie die Chronik Arnolds von Lübeck und die Gesta Danorum, eingegangen und deren jeweilige Stärken und Schwächen kurz beleuchtet. Die Arbeit verspricht eine Synthese verschiedener historiographischer Ansätze.
2. Die Biografie des Bischofs Waldemar von Schleswig: Dieses Kapitel skizziert die Biografie des Bischofs, beginnend mit seiner Herkunft als Sohn des dänischen Königs Knud III. Es beleuchtet die Umstände seiner Geburt und die Fragen nach der Legitimität seiner königlichen Abstammung. Der Text beschreibt seine Ernennung zum Bischof von Schleswig und die möglichen politischen Hintergründe dieser Entscheidung, die ihn möglicherweise von einer Thronfolge ausschließen sollte. Das Kapitel skizziert seine Amtszeit und seine Rolle als Herzog von Schleswig. Es betont die Verflechtung von persönlicher Geschichte und politischen Ereignissen.
3. Die Lage in Holstein und Nordelbingen: Dieses Kapitel bietet einen Überblick über die politische und soziale Lage in Holstein und Nordelbingen während der Lebenszeit des Bischofs Waldemar. Es bildet den notwendigen Kontext, um die Ereignisse und Handlungen des Bischofs im weiteren Verlauf besser zu verstehen. Die Zusammenfassung beschreibt die wichtigsten Entwicklungen und Konflikte, die die Handlungen des Bischofs beeinflusst haben könnten, aber verzichtet auf detaillierte Einzelheiten, da diese bereits in anderen Kapiteln ausführlicher behandelt werden.
4. Der Vetternstreit: Der vierte Abschnitt bildet den Kern der Arbeit und beschreibt detailliert den Konflikt zwischen Bischof Waldemar und seinen Vettern. Er beginnt mit der schwierigen Datierung des Streites und der Darstellung unterschiedlicher wissenschaftlicher Ansätze. Anschließend werden die Ursachen des Konflikts, sowohl erbrechtliche als auch persönliche Gründe, ausführlich analysiert. Die Wahl Waldemars zum Erzbischof von Bremen wird im Detail dargestellt, ebenso wie die Eskalation der Situation und die militärischen Handlungen des Bischofs. Das Kapitel hebt die Bedeutung des Konflikts für das Verständnis des politischen und kirchlichen Lebens im Ostseeraum hervor.
5. Zeit der Gefangenschaft und Flucht des Bischofs aus Rom: Dieses Kapitel beschreibt die Gefangenschaft Bischof Waldemars und beleuchtet das Verhalten des Papsttums während dieser Zeit. Es analysiert den Prozess gegen den Bischof und dessen Flucht aus Rom. Der Fokus liegt auf den politischen und religiösen Implikationen seiner Gefangenschaft und Flucht. Der Text untersucht das Verhalten der Kurie und dessen Bedeutung im Kontext der politischen Machtkämpfe der Zeit. Die letzten Jahre des Bischofs werden ebenfalls betrachtet.
6. Bischof Waldemars Bedeutung für das mittelalterliche dänische Ostseeimperium: Dieses Kapitel analysiert die Rolle und den Einfluss Bischof Waldemars auf das dänische Ostseeimperium. Es wird dessen Bedeutung für die politische und religiöse Landschaft des Mittelalters im Kontext des Ostseegebietes untersucht. Das Kapitel synthetisiert die vorherigen Kapitel und positioniert den Bischof in seinen historischen Kontext. Seine Bedeutung wird aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet, z.B. seine Rolle in Konflikten und seine Wirkung auf die kirchliche und politische Ordnung.
Schlüsselwörter
Bischof Waldemar von Schleswig, Dänisches Ostseeimperium, Vetternstreit, Holstein, Nordelbingen, Arnold von Lübeck, Saxo Grammaticus, Papsttum, Mittelalter, Politik, Kirche, Chroniken.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit über Bischof Waldemar von Schleswig
Was ist der Gegenstand dieser wissenschaftlichen Arbeit?
Die Arbeit befasst sich mit dem Leben und Wirken des Bischofs Waldemar von Schleswig (1157/58-1235/36) im Kontext des dänischen Ostseeimperiums. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf dem Konflikt zwischen Bischof Waldemar und seinen Vettern, dessen Auswirkungen auf das Ostseeimperium und der Frage nach Waldemars Gefährlichkeit für Dänemark.
Welche Quellen wurden verwendet?
Die Arbeit stützt sich auf verschiedene Quellen, darunter die Chronik Arnolds von Lübeck und die Gesta Danorum von Saxo Grammaticus. Die Arbeit verspricht eine Synthese verschiedener historiografischer Ansätze.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt das Leben und Wirken Bischof Waldemars, den Vetternstreit und dessen Ursachen, die Auswirkungen des Konflikts auf das dänische Ostseeimperium, Waldemars Rolle im politischen Gefüge des Mittelalters und eine Analyse verschiedener historiografischer Ansätze zum Thema.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in sieben Kapitel: Einleitung, Biografie des Bischofs, Lage in Holstein und Nordelbingen, der Vetternstreit (inkl. Datierung, Ursachen, Wahl zum Erzbischof von Bremen und Eskalation), Gefangenschaft und Flucht des Bischofs aus Rom, Bischof Waldemars Bedeutung für das dänische Ostseeimperium und Schlussbetrachtung. Jedes Kapitel wird in der HTML-Vorschau mit einer Zusammenfassung versehen.
Was ist das zentrale Thema des Vetternstreits?
Der Vetternstreit bildet den Kern der Arbeit und beschreibt detailliert den Konflikt zwischen Bischof Waldemar und seinen Vettern. Es werden die schwierige Datierung, die Ursachen (erbrechtliche und persönliche Gründe), die Wahl Waldemars zum Erzbischof von Bremen und die militärischen Handlungen des Bischofs analysiert.
Welche Rolle spielte Bischof Waldemar im dänischen Ostseeimperium?
Das Kapitel 6 analysiert die Rolle und den Einfluss Bischof Waldemars auf das dänische Ostseeimperium. Es untersucht seine Bedeutung für die politische und religiöse Landschaft des Mittelalters im Kontext des Ostseegebietes aus verschiedenen Perspektiven (Rolle in Konflikten, Wirkung auf die kirchliche und politische Ordnung).
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Bischof Waldemar von Schleswig, Dänisches Ostseeimperium, Vetternstreit, Holstein, Nordelbingen, Arnold von Lübeck, Saxo Grammaticus, Papsttum, Mittelalter, Politik, Kirche, Chroniken.
Wo finde ich detailliertere Informationen zu den einzelnen Kapiteln?
Die HTML-Vorschau enthält Kapitelübersichten, die die jeweiligen Inhalte kurz zusammenfassen. Die vollständige Arbeit enthält selbstverständlich detailliertere Informationen.
Für wen ist diese Arbeit bestimmt?
Die Arbeit ist für Wissenschaftler und Studenten bestimmt, die sich mit dem Mittelalter, der Geschichte Dänemarks und des Ostseegebiets, sowie der Rolle der Kirche in der Politik befassen.
- Citation du texte
- Johannes Thoböll (Auteur), 2007, Ein unruhiger Geist: Bischof Waldemar von Schleswig, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/87939