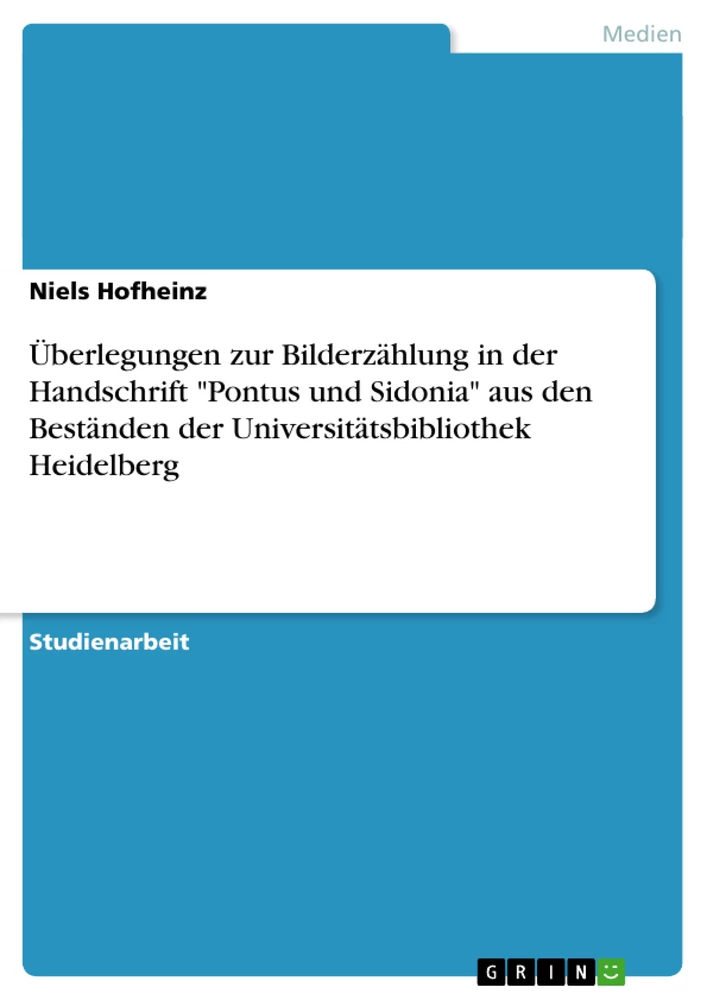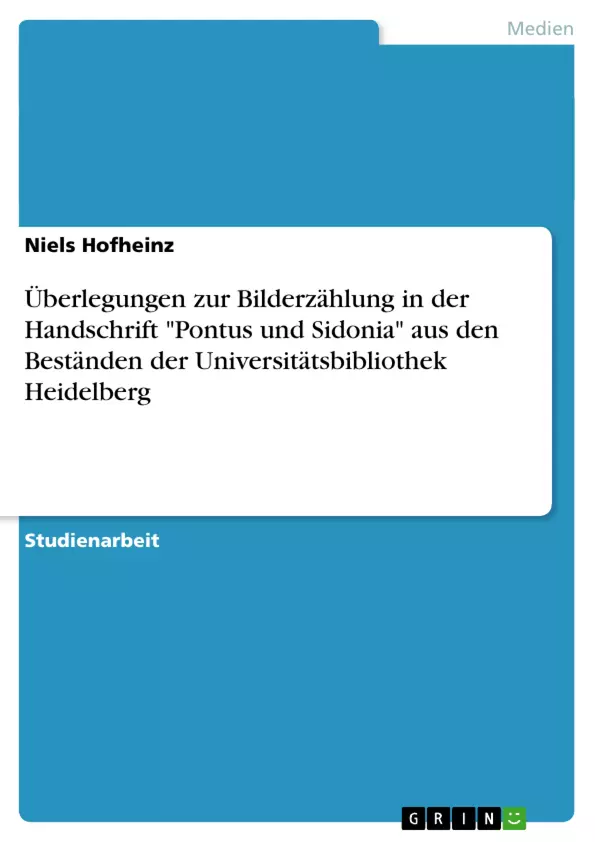Die Entwicklung der Buchmalerei hatte in der zweiten Hälfte de 15. Jahrhunderts bereits ihren Höhepunkt überschritten. Dennoch bestand bei einigen Liebhabern auch noch in den 1470er Jahren großes Interesse an dieser Kunstform. Solcherlei spätmittelalterliche Buchmalerei unterscheidet sich in einigen Punkten erheblich von Arbeiten aus der Hochphase der Buchillumination.
Die in diesem Essay eingehender betrachtete Handschrift, mit großer Wahrscheinlichkeit im Auftrag der Margarethe von Savoyen hergestelltes Produkt der so genannten „Henfflin-Werkstatt“ zählt zur Kategorie jener spätmittelalterlichen „multimedialen“ Werke, die doch bisher in keine Kategorie zu passen schienen: Die Handschrift „Pontus und Sidonia“, die heute unter der Signatur Codex Palatinum Germanicum 142 im Katalog der Heidelberger Universitätsbibliothek zu finden ist. Da eine umfassende Analyse der Handschrift im Rahmen dieser Arbeit praktisch ausgeschlossen ist, sollen anhand der ausführlichen Betrachtung zweier exemplarisch herausgegriffener Illustrationen sowohl einige Rückschlüsse auf die Binnenfunktion der Illustrationen innerhalb der Sequenzen als auch auf die Faktur des Werkes im Gesamten induziert werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Allgemeines zur Handschrift
- Allgemeines zu den untersuchten Abbildungen
- Einige Erwägungen zur Bildflächenbegrenzung
- Bildbetrachtung
- Betrachtung der Abbildung auf Folio 17 verso
- Betrachtung der Abbildung auf Folio 19 recto
- Zum Einsatz piktographischer Elemente auf Folio 19 recto
- Vergleichende Gegenüberstellung und Fazit der Betrachtung der Illustrationen von Folii 17 verso und 19 recto
- Resümee
- Abbildungen
- Literatur
- Quellen
- Sekundärliteratur
- Handschriftendigitalisate und andere digitale Quellen
- Abbildungsnachweis
- Anhang: Tabelle zur Rahmenfarbe
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text befasst sich mit der Analyse der Bilderzählung in der Handschrift "Pontus und Sidonia" aus den Beständen der Universitätsbibliothek Heidelberg. Er untersucht die Funktionen der Illustrationen innerhalb der Sequenzen und analysiert die Faktur des Werkes im Gesamten. Dabei werden zwei exemplarische Illustrationen als "pars pro toto" verwendet, um Rückschlüsse auf das Gesamtwerk zu ziehen.
- Analyse der Bilderzählung in der Handschrift "Pontus und Sidonia"
- Untersuchung der Funktionen der Illustrationen innerhalb der Sequenzen
- Analyse der Faktur des Werkes im Gesamten
- Verwendung von zwei exemplarischen Illustrationen als "pars pro toto"
- Betrachtung der Illustrationen im Kontext ihrer historischen und künstlerischen Bedeutung
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Der Text stellt die Relevanz der Untersuchung der Bilderzählung in der Handschrift "Pontus und Sidonia" dar. Er beleuchtet die Schwierigkeit, „unpopuläre“ Bildquellen im wissenschaftlichen Kontext zu betrachten, und betont die Bedeutung der eigenen Beobachtung als Forschungsmethode.
- Allgemeines zur Handschrift: Dieses Kapitel gibt einen Überblick über die Handschrift "Pontus und Sidonia", die im Auftrag von Margarethe von Savoyen in der "Henfflin-Werkstatt" entstanden ist. Es wird die multimediale Natur des Werkes hervorgehoben, die es schwierig macht, sie in eine Kategorie einzuteilen.
- Allgemeines zu den untersuchten Abbildungen: Das Kapitel stellt die beiden exemplarisch ausgewählten Illustrationen auf Folio 17 verso und 19 recto vor. Es beschreibt den Kontext der Bilder innerhalb der Sequenz, die die Eskalation der kriegerischen Auseinandersetzung zwischen den bretonischen Truppen und dem heidnischen Invasorenheer schildert.
- Einige Erwägungen zur Bildflächenbegrenzung: Dieses Kapitel befasst sich mit der Frage, wie die Grenzen der Bilder in der Handschrift definiert werden. Es analysiert die Beziehung zwischen Text und Bild und betrachtet die Gestaltung der Bildüberschriften.
- Bildbetrachtung: Dieses Kapitel bietet eine detaillierte Analyse der beiden ausgewählten Illustrationen, wobei die Bildthemen, die Gestaltungselemente und die Verwendung piktographischer Elemente im Fokus stehen.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter dieses Textes sind: Bilderzählung, Handschrift, "Pontus und Sidonia", Universitätsbibliothek Heidelberg, Illustration, Faktur, Sequenz, "pars pro toto", Bildbetrachtung, Piktogramm, Gestaltungselemente, historische und künstlerische Bedeutung, multimediale Werke, "Henfflin-Werkstatt", Margarethe von Savoyen.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Besondere an der Handschrift „Pontus und Sidonia“?
Es handelt sich um ein „multimediales“ Werk des Spätmittelalters (1470er Jahre), das Text und Illustrationen in einer für die Zeit spezifischen Bilderzählung verbindet.
Wer war die Auftraggeberin dieses Werkes?
Die Handschrift wurde mit großer Wahrscheinlichkeit im Auftrag von Margarethe von Savoyen in der so genannten „Henfflin-Werkstatt“ hergestellt.
Wo wird die Handschrift heute aufbewahrt?
Sie befindet sich in der Universitätsbibliothek Heidelberg unter der Signatur Codex Palatinum Germanicum 142 (cpg 142).
Welche Rolle spielen piktographische Elemente in der Handschrift?
Die Arbeit analysiert den Einsatz piktographischer Elemente, um die Binnenfunktion der Illustrationen innerhalb der erzählten Sequenzen zu verdeutlichen.
Wie ist die Beziehung zwischen Text und Bild gestaltet?
Die Untersuchung betrachtet die Bildflächenbegrenzung und Bildüberschriften, um zu zeigen, wie die Illustrationen die Handlung des Textes visuell unterstützen.
- Quote paper
- Niels Hofheinz (Author), 2007, Überlegungen zur Bilderzählung in der Handschrift "Pontus und Sidonia" aus den Beständen der Universitätsbibliothek Heidelberg, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/87954