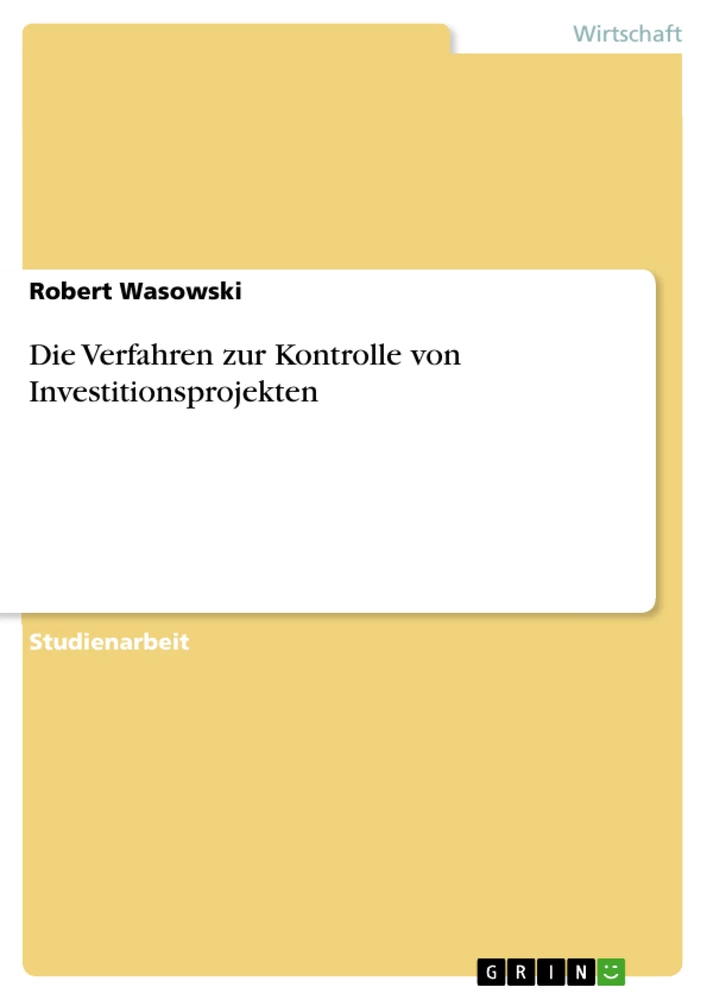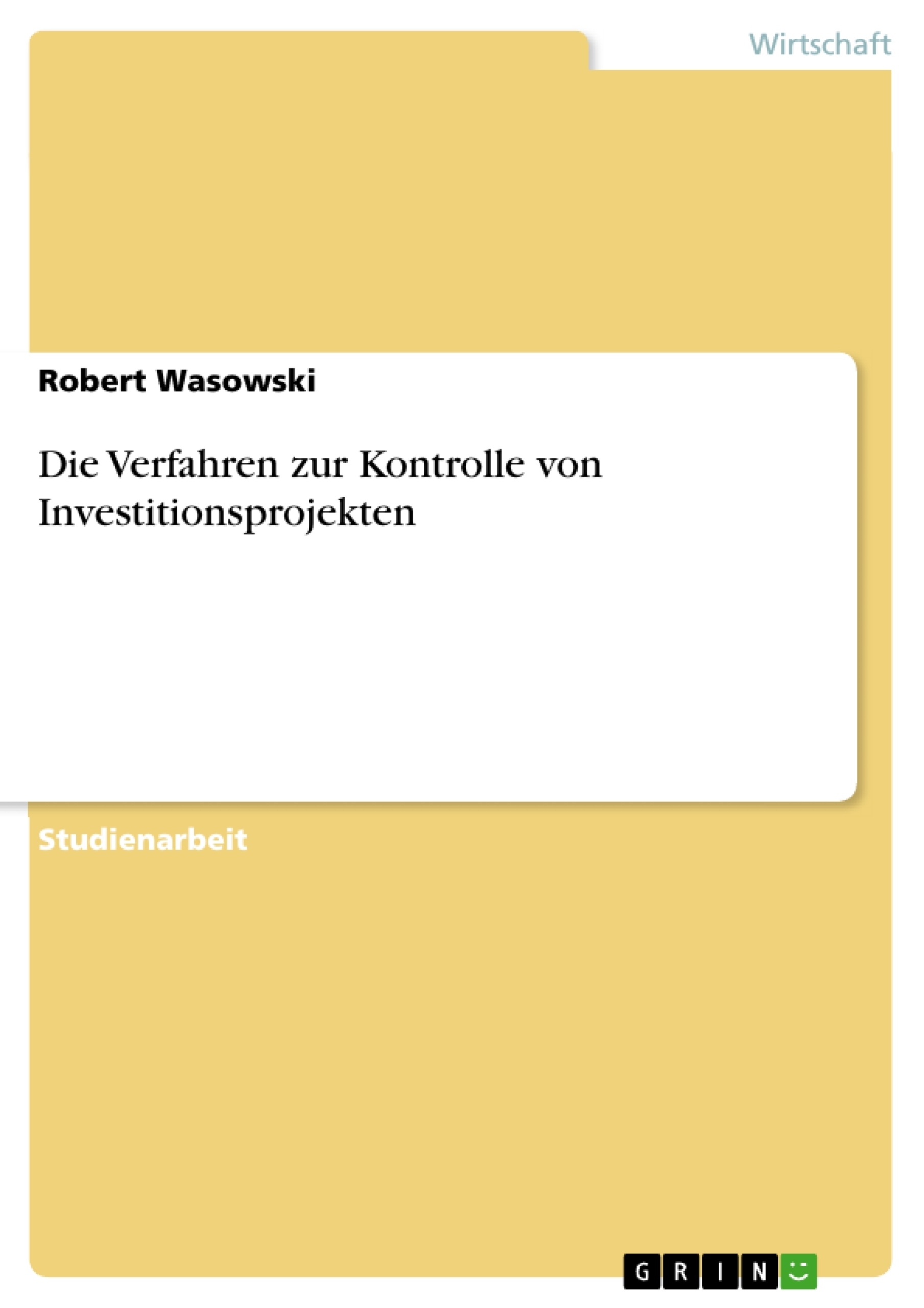Die Gründe für Investitionen können vielfältig sein. In der Privatwirtschaft, um gegenüber Wettbewerbern einen Technologie- und / oder ein Kostenvorteil zu erreichen, oder um gestiegenen Anforderungen an Dienstleistungen öffentlicher Verwaltungen gerecht zu werden.
Gerade in von politischen Entscheidungen so stark abhängigen Organisationen wie der öffentlichen Verwaltung erfolgt die Entscheidung für beziehungsweise die Durchführung der Investitionsmaßnahmen im Rahmen eines Auftraggeber- (Entscheidungsgremium) – Auftragnehmerverhältnisses (Projektleitung/Ausführende). Diese wechselseitigen Abhängigkeitsverhältnisse führen in der Praxis nicht zwangsläufig dazu, dass allen Beteiligten der jeweilige Projekt- bzw. Investitionsstatus transparent ist. Mit der Folge, dass Projekte dazu neigen „aus dem Ruder zulaufen“. Immerhin kommt eine Studie der PA Consulting Group und GPM Deutsche Gesellschaft für Projekt-Management zu dem Ergebnis, dass 37 % aller Projekte nach Einschätzung deutscher Firmen als nicht erfolgreich eingestuft werden . Aus der öffentlichen Berichterstattung sind einige Projekte bekannt, bei denen die Projektziele nicht auf Anhieb erreicht wurden. Beispielhaft seien an dieser Stelle die Einführung LKW-Maut und das Herkules-Projekt der Bundeswehr genannt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Abgrenzung
- Begriffsbestimmungen
- Welche Aufgaben hat die Projektsteuerung und - kontrolle?
- Teilkontrolle / Eckdatenverfolgung
- Nachberechnung / Vollkontrolle
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit befasst sich mit den Verfahren zur Kontrolle von Investitionsprojekten, insbesondere im Kontext von Auftraggeber-Auftragnehmer-Beziehungen. Der Fokus liegt auf der Bedeutung von transparenten Kontrollmechanismen zur Vermeidung von Projektüberlauf und -versagen.
- Herausforderungen bei der Projektsteuerung und -kontrolle
- Bedeutung von transparenten Kontrollmechanismen
- Analyse von Teilkontrolle und Vollkontrolle
- Analyse der Bedeutung der Projektziele in Bezug auf Kosten, Termine und Leistungen
- Die Rolle des "magischen Dreiecks" in der Projektsteuerung
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung führt in das Thema der Investitionsprojekt-Kontrolle ein und erläutert die Notwendigkeit transparenter Kontrollmechanismen in einem Auftraggeber-Auftragnehmer-Verhältnis. Der Autor verweist auf die hohe Anzahl gescheiterter Projekte in Deutschland und erläutert die Relevanz des Themas anhand von Beispielen wie der Einführung der LKW-Maut und dem Herkules-Projekt der Bundeswehr.
Abgrenzung
In diesem Kapitel wird der Fokus der Hausarbeit abgegrenzt. Die Arbeit konzentriert sich auf die Verfahren zur Kontrolle von Investitionsprojekten und geht nicht auf Unterschiede zwischen „Eigenregie“ und extern erbrachten Leistungen ein.
Begriffsbestimmungen
Dieses Kapitel beleuchtet die Begriffe "Investition" und "Projekt" anhand von Definitionen aus der Wirtschaftsliteratur. Der Autor bezieht sich auf die Definitionen von Adam und Fiedler und erklärt die Bedeutung von Kostenersparungen im Zusammenhang mit Investitionen.
Welche Aufgaben hat die Projektsteuerung und – kontrolle?
Dieses Kapitel beschreibt die grundlegenden Aufgaben der Projektsteuerung und -kontrolle und erklärt das Konzept des "magischen Dreiecks", das die Beziehung zwischen Kosten, Terminen und Leistungen eines Projekts darstellt.
Schlüsselwörter
Investitionsprojekte, Projektsteuerung, -kontrolle, Auftraggeber-Auftragnehmer-Verhältnis, Transparenz, Kontrollmechanismen, Teilkontrolle, Vollkontrolle, Kosten, Termine, Leistungen, "magisches Dreieck".
Häufig gestellte Fragen
Warum scheitern viele Investitionsprojekte?
Oft liegt es an mangelnder Transparenz zwischen Auftraggeber und Projektleitung, wodurch Projekte „aus dem Ruder laufen“. Etwa 37 % der Projekte in Deutschland gelten als nicht erfolgreich.
Was ist das „magische Dreieck“ der Projektsteuerung?
Es beschreibt die wechselseitige Abhängigkeit zwischen den drei Zielgrößen: Kosten, Termine und Leistung (Qualität). Änderungen in einer Dimension beeinflussen zwangsläufig die anderen.
Was ist der Unterschied zwischen Teilkontrolle und Vollkontrolle?
Die Teilkontrolle (Eckdatenverfolgung) prüft nur wichtige Meilensteine, während die Vollkontrolle (Nachberechnung) alle Projektdaten detailliert erfasst und analysiert.
Welche Rolle spielen Auftraggeber-Auftragnehmer-Beziehungen?
Diese Beziehungen schaffen Abhängigkeiten. Ohne klare Kontrollmechanismen kann es zu Informationsasymmetrien kommen, die den Projekterfolg gefährden.
Was sind bekannte Beispiele für problematische Großprojekte?
In der öffentlichen Berichterstattung werden häufig die Einführung der LKW-Maut und das Herkules-Projekt der Bundeswehr als Beispiele für Projekte mit Zielverfehlungen genannt.
Was ist die Hauptaufgabe der Projektkontrolle?
Die Hauptaufgabe besteht darin, den aktuellen Projektstatus transparent zu machen, Abweichungen von den Zielen frühzeitig zu erkennen und Gegensteuerungsmaßnahmen einzuleiten.
- Arbeit zitieren
- Robert Wasowski (Autor:in), 2007, Die Verfahren zur Kontrolle von Investitionsprojekten, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/87975