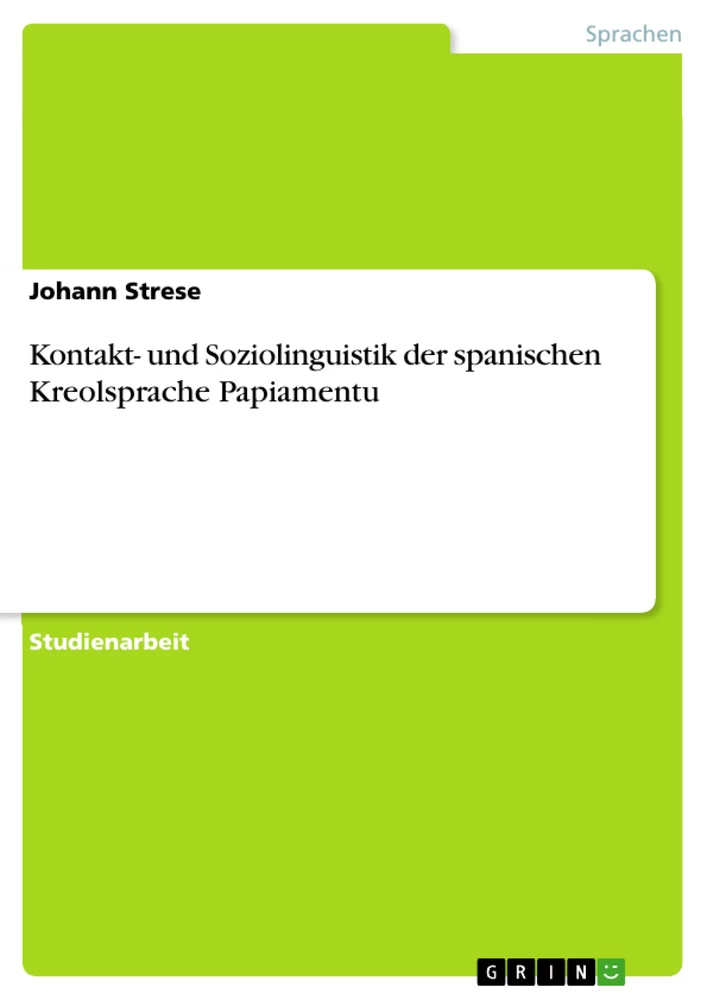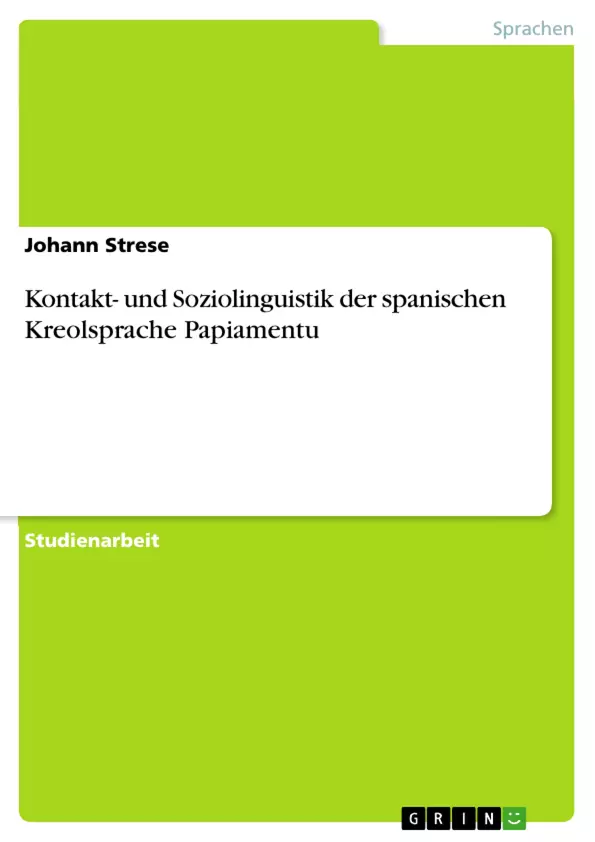Viele Kreolsprachen sind von einer Dekreolisierung oder gar vom Sprachtod bedroht. Sie werden meistens zu Gunsten einer Superstratsprache aufgegeben, da sie sogar unter den eigenen Sprechern kein hohes Prestige genießt.
In dieser Arbeit soll das Kreol Papiamentu unter kontakt- und soziolinguistischen Aspekten betrachtet werden. Es wird auf die Genese, die Sprachkontakte ab dem 18. Jahrhundert und die daraus resultierenden Interferenzen und Codewechsel eingegangen.
Des Weiteren soll aber auch die Sprachgemeinschaft beleuchtet werden. Wobei hier versucht wird, den langen und leidvollen Weg von einer nichtstandardisierten zur einer standardisierten Sprache kurz zu skizzieren.
Das Papiamentu ist die Muttersprache von über 300.000 Menschen und wird vorwiegend auf den Niederländischen Antillen Aruba, Bonaire und Curaçao, den sogenannten ABC-Inseln gesprochen.
Inhaltsverzeichnis
- Entstehung des Papiamentu
- Einleitung
- Gegenwärtige Sprachsituation
- Wandel des Prestiges
- Papiamentu in den Medien
- Papiamentu im Amt- und Bildungswesen
- Varietäten
- Standardisierung des Papiamentu
- Sprachkontakt
- Sprachkontakt mit dem Spanischen
- Sprachkontakt mit dem Niederländischen
- Sprachkontakt mit dem Englischen
- Interferenzen und Codewechsel
- Dekreolisierung
- Schlussbemerkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Kreolsprache Papiamentu unter kontakt- und soziolinguistischen Aspekten. Ziel ist es, die Genese der Sprache, die Sprachkontakte seit dem 18. Jahrhundert und die daraus resultierenden Interferenzen und Codewechsel zu beleuchten. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Beschreibung der Sprachgemeinschaft und dem Weg von einer nicht-standardisierten zu einer standardisierten Sprache.
- Genese des Papiamentu und konkurrierende Theorien (Monogenese vs. Polygenese)
- Sprachkontakte mit Spanisch, Niederländisch und Englisch
- Interferenzen und Codewechsel im Papiamentu
- Soziolinguistische Aspekte: Prestige, Medien, Amt und Bildungswesen
- Standardisierungsprozess des Papiamentu
Zusammenfassung der Kapitel
Entstehung des Papiamentu: Der Text diskutiert verschiedene Theorien zur Entstehung des Papiamentu, wobei die Monogenese-Theorie (portugiesisches Pidgin in Afrika als Ursprung) und die Polygenese-Theorie (Entwicklung auf den Niederländischen Antillen) gegenübergestellt werden. Die Monogenese-Theorie wird als unzureichend bewertet, da die Herkunft der Sklaven und die kurze Zeit des Kontakts in Afrika und auf der Überfahrt eine einheitliche Pidgin-Entwicklung unwahrscheinlich machen. Die Polygenese-Theorie gewinnt an Plausibilität durch die Berücksichtigung der sprachlichen Einflüsse auf die afrikanischen Sklaven auf den Antillen und die Ankunft sephardischer Flüchtlinge aus Brasilien im 17. Jahrhundert. Die Entstehung des Papiamentu wird in die zweite Hälfte des 17. Jahrhunderts datiert, in einer Zeit erhöhten Anteils arbeitender Sklaven im Kontakt mit verschiedenen Sprachen der Herrschenden.
Schlüsselwörter
Papiamentu, Kreolsprache, Soziolinguistik, Kontaktlinguistik, Sprachkontakt, Spanisch, Niederländisch, Englisch, Monogenese, Polygenese, Dekreolisierung, Standardisierung, Sprachgemeinschaft, Interferenzen, Codewechsel, ABC-Inseln.
Häufig gestellte Fragen zu "Papiamentu: Entstehung, Sprachkontakt und Standardisierung"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Kreolsprache Papiamentu unter kontakt- und soziolinguistischen Aspekten. Im Fokus stehen die Genese der Sprache, die Sprachkontakte seit dem 18. Jahrhundert und die daraus resultierenden Interferenzen und Codewechsel. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Beschreibung der Sprachgemeinschaft und dem Weg von einer nicht-standardisierten zu einer standardisierten Sprache.
Welche Themen werden im Einzelnen behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: die Genese des Papiamentu (inkl. der Diskussion von Monogenese- und Polygenese-Theorien), Sprachkontakte mit Spanisch, Niederländisch und Englisch, Interferenzen und Codewechsel, soziolinguistische Aspekte wie Prestige, Mediennutzung, Rolle im Amt und Bildungswesen sowie den Standardisierungsprozess des Papiamentu.
Welche Theorien zur Entstehung des Papiamentu werden diskutiert?
Die Arbeit vergleicht die Monogenese-Theorie (portugiesisches Pidgin in Afrika als Ursprung) und die Polygenese-Theorie (Entwicklung auf den Niederländischen Antillen). Die Monogenese-Theorie wird aufgrund der kurzen Zeit des Kontakts in Afrika und auf der Überfahrt als unzureichend bewertet. Die Polygenese-Theorie wird favorisiert, da sie sprachliche Einflüsse auf die afrikanischen Sklaven auf den Antillen und die Ankunft sephardischer Flüchtlinge aus Brasilien im 17. Jahrhundert berücksichtigt. Die Entstehung wird in die zweite Hälfte des 17. Jahrhunderts datiert.
Welche Rolle spielen Sprachkontakte?
Die Arbeit untersucht detailliert die Sprachkontakte des Papiamentu mit Spanisch, Niederländisch und Englisch. Ein Schwerpunkt liegt auf den daraus resultierenden Interferenzen und Codewechseln, die die sprachliche Entwicklung des Papiamentu geprägt haben.
Welche soziolinguistischen Aspekte werden betrachtet?
Soziolinguistische Aspekte wie das Prestige des Papiamentu, seine Rolle in den Medien, im Amt und im Bildungswesen werden analysiert, um die Sprachsituation und den Status des Papiamentu in der Gesellschaft zu beschreiben.
Wie wird der Standardisierungsprozess des Papiamentu dargestellt?
Die Arbeit beschreibt den Weg des Papiamentu von einer nicht-standardisierten zu einer standardisierten Sprache. Dieser Prozess wird im Kontext der soziolinguistischen Situation und den beschriebenen Sprachkontakten beleuchtet.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Papiamentu, Kreolsprache, Soziolinguistik, Kontaktlinguistik, Sprachkontakt, Spanisch, Niederländisch, Englisch, Monogenese, Polygenese, Dekreolisierung, Standardisierung, Sprachgemeinschaft, Interferenzen, Codewechsel, ABC-Inseln.
- Quote paper
- Johann Strese (Author), 2007, Kontakt- und Soziolinguistik der spanischen Kreolsprache Papiamentu, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/88007