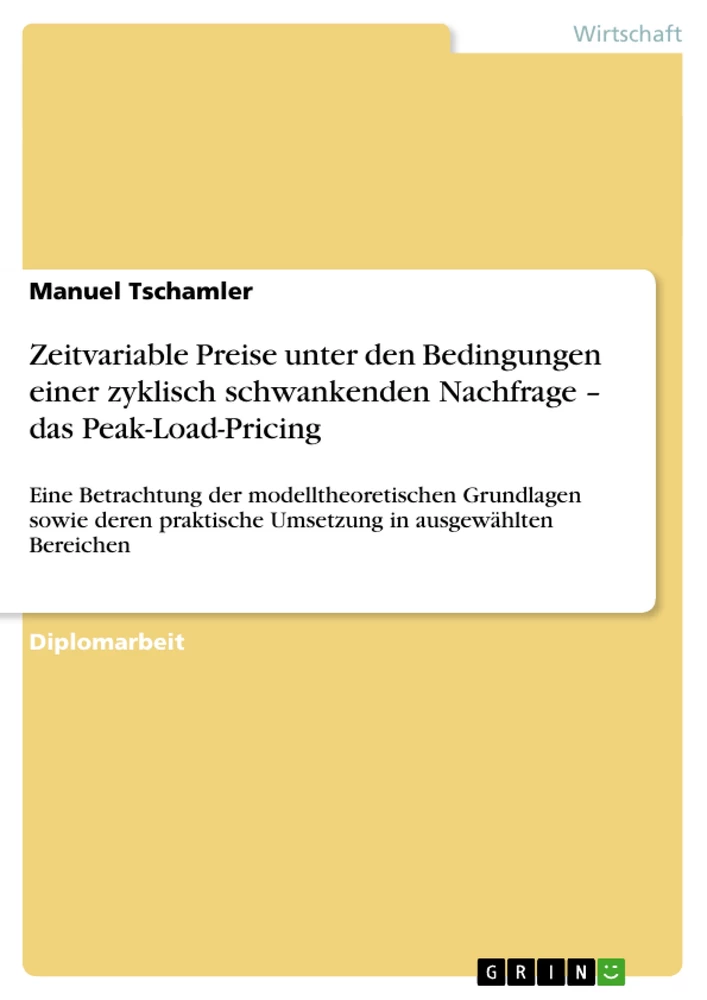In der Präambel (§1) des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) ist gesetzlich festgelegt, dass Energieversorgungsunternehmen verpflichtet sind, „eine möglichst sichere, preisgünstige und umweltverträgliche leitungsgebundene Versorgung mit Elektrizität und Gas im Interesse der Allgemeinheit“ sicherzustellen.
Dies bedeutet für die Versorgungsunternehmen, dass effiziente Preissysteme entwickelt werden müssen, die einerseits die verursachten Kosten adäquat berücksichtigen und andererseits eine effiziente Kapazitätsplanung mit einschließen. Wie die großen Stromausfälle in New York (14.08.2003) und London (28.08.2003) aber gezeigt haben, stehen die Unternehmen sehr oft vor dem Problem, wie eine solche optimale Preis- und Kapazitätsplanung verwirklicht werden soll.
Die Gründe liegen in den spezifischen Eigenschaften der elektrischen Energie. Strom ist ein Produkt, welches insbesondere einer zyklisch schwankenden Nachfrage unterworfen ist und welches nicht in großen Mengen oder nur unter immens hohen Lagerkosten auf Vorrat produziert und gespeichert werden kann. Dies macht Strom zu einem „Just-in-Time“-Produkt. Er muss in genau dem Moment erzeugt werden, in dem die Verbraucher und Stromabnehmer ihn benötigen. Die Stromversorgungsunternehmen müssen aufgrund dieser Tatsache immer eine solche Kapazität an elektrischer Energie bereitstellen, die in der Lage ist, die Spitzennachfrage nach Strom zu decken. Dementsprechend müssen natürlich auch Schwachlastzeiten in die Kapazitätsplanung mit einbezogen werden.
Nur durch diese Vorgehensweise ist es den Unternehmen möglich, Wirtschaftlichkeit und Planungssicherheit zu erreichen und den Verbrauchern eine sichere Stromversorgung gewährleisten zu können. Jegliche Ineffizienz in der Preis- und Kapazitätsplanung birgt die Gefahr einer Netzüberlastung bzw. eines Netzzusammenbruchs mit erheblichen negativen Konsequenzen sowohl für die Unternehmen selbst (Gewinneinbussen), als auch für die Verbraucher (z.B. Plünderungen etc.).
Der Frage, wie eine solche optimale Preis- und Kapazitätsplanung unter einer zyklisch schwankenden Nachfrage in die Realität umgesetzt werden kann, wird in der Literatur mit dem sog. Peak-Load-Pricing (Spitzenlasttarifierung) nachgegangen. Diese Arbeit befasst sich grundlegend mit dem Konzept des Peak-Load-Pricing. Die Hauptzielsetzung besteht darin, aufzuzeigen, welche Preise unter zyklisch schwankender Nachfrage optimal sind und welche Kapazität unter diesen Voraussetzungen bereitgestellt werden soll.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 1.1 Problemrelevanz
- 1.2 Aufbau der Arbeit
- 2 Das natürliche Monopol
- 2.1 Eigenschaften eines Unternehmens im natürlichen Monopol
- 2.1.1 Subadditivität der Kostenfunktion
- 2.1.2 Größenersparnisse bzw. Skalenvorteile
- 2.1.3 Fallender Verlauf der Durchschnittskostenkurve
- 2.1.4 Verbundvorteile (Economies of Scope)
- 2.2 Das natürliche Monopol aus gesamtgesellschaftlicher Sicht
- 2.3 Problemstellung: Ökonomische Effizienz vs. Eigenwirtschaftlichkeit
- 2.1 Eigenschaften eines Unternehmens im natürlichen Monopol
- 3 Die Theorie des Peak-Load-Pricing
- 3.1 Begriffsabgrenzung und Zielsetzung
- 3.2 Die Grundmodelle der Spitzenlastpreisbildung
- 3.2.1 Der Ansatz von Marcel Boiteux (1949, 1960)
- 3.2.1.1 Kostenverläufe für Anlagen flexibler sowie starrer Kapazität
- 3.2.1.2 Kurz- und langfristige Gleichgewichtslösungen unter konstanter Nachfrage
- 3.2.1.3 Kurz- und langfristige Gleichgewichtslösungen unter schwankender Nachfrage
- 3.2.2 Der Ansatz von P. O. Steiner (1957)
- 3.2.2.1 Grundlegende Modellannahmen
- 3.2.2.2 Preissetzung bei einer konstanten Nachfrage während der gesamten Periode
- 3.2.2.3 Preissetzung bei einer Nachfrage in nur einem Periodenabschnitt
- 3.2.2.4 Preissetzung bei einer unterschiedlichen Nachfrage in beiden Periodenabschnitten
- 3.2.2.4.1 Der Firm-Peak-Fall
- 3.2.2.4.2 Der Shifting-Peak-Fall
- 3.2.1 Der Ansatz von Marcel Boiteux (1949, 1960)
- 3.3 Exkurs: optimale Bereitstellung des öffentlichen Gutes
- 3.4 Kritik an den Grundmodellen zum Peak-Load-Pricing
- 3.5 Erweiterungen der klassischen Spitzenlastmodelle
- 3.5.1 Der Ansatz von O. E. Williamson (1966)
- 3.5.1.1 Konstante Nachfrage während der gesamten Periode
- 3.5.1.2 Wirksame Nachfrage in nur einem Periodenabschnitt
- 3.5.1.2.1 Der Firm-Peak-Fall
- 3.5.1.2.2 Der Shifting-Peak-Fall
- 3.5.1.3 Die Berücksichtigung ungleich langer Periodenabschnitte
- 3.5.1.4 Ergebnisse bei Annahme unvollständig teilbarer Anlagen
- 3.5.1.5 Kritik am Modell von Williamson
- 3.5.2 Spitzenlastpreisbildung und Rationierung
- 3.5.3 Spitzenlastpreisbildung unter der Zielsetzung der Gewinnmaximierung
- 3.5.4 Spitzenlastpreise unter zunehmenden Skalenerträgen (Ramsey-Preisregel)
- 3.5.5 Spitzenlastpreisbildung bei abhängiger (verbundener) Nachfrage
- 3.5.1 Der Ansatz von O. E. Williamson (1966)
- 4 Peak-Load-Pricing in der Praxis
- 4.1 Die Elektrizitätswirtschaft
- 4.1.1 Das Tarifsystem der Electricité de France (EdF)
- 4.1.1.1 Der Tarif Bleu - Option "Tempo"
- 4.1.1.2 Die Tarifoption "Heures Pleines/Heures Creuses - HP/HC"
- 4.1.2 Das Tarifsystem der E.ON-Bayern AG
- 4.1.3 Vergleich des französischen mit dem deutschen Preissystem
- 4.1.1 Das Tarifsystem der Electricité de France (EdF)
- 4.2 Der Verkehrssektor
- 4.2.1 Das Road-Pricing-Konzept von Singapur
- 4.2.2 Das Road-Pricing-Konzept von Trondheim
- 4.3 Die Telekommunikationsbranche
- 4.1 Die Elektrizitätswirtschaft
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Theorie des Peak-Load-Pricing und deren praktische Anwendung in verschiedenen Wirtschaftssektoren. Ziel ist es, die modelltheoretischen Grundlagen zu erläutern und die Umsetzung in der Realität zu analysieren. Dabei wird der Fokus auf die Herausforderungen gelegt, die durch die schwankende Nachfrage entstehen.
- Das natürliche Monopol und seine ökonomischen Implikationen
- Die verschiedenen Modelle der Spitzenlastpreisbildung (Peak-Load-Pricing)
- Die Anwendung des Peak-Load-Pricing in der Elektrizitätswirtschaft
- Die Anwendung des Peak-Load-Pricing im Verkehrssektor
- Die Anwendung des Peak-Load-Pricing in der Telekommunikationsbranche
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik des Peak-Load-Pricing ein und begründet die Relevanz des Themas anhand der Herausforderungen, vor denen Energieversorgungsunternehmen aufgrund zyklisch schwankender Nachfrage stehen. Sie veranschaulicht die Notwendigkeit effizienter Preis- und Kapazitätsplanung, um Wirtschaftlichkeit und Versorgungssicherheit zu gewährleisten und negative Konsequenzen wie Netzüberlastungen zu vermeiden. Die Problematik wird nicht nur auf die Stromversorgung beschränkt, sondern auch auf die Telekommunikations- und Verkehrsbranche ausgeweitet.
2 Das natürliche Monopol: Dieses Kapitel beschreibt die Eigenschaften eines natürlichen Monopols, wie Subadditivität der Kostenfunktion, Größenersparnisse und fallende Durchschnittskostenkurven. Es beleuchtet die gesamtgesellschaftliche Perspektive und den Konflikt zwischen ökonomischer Effizienz und Eigenwirtschaftlichkeit. Die Analyse der Kostenstrukturen bildet die Grundlage für die spätere Betrachtung der optimalen Preisgestaltung unter Bedingungen schwankender Nachfrage.
3 Die Theorie des Peak-Load-Pricing: Dieses Kapitel bildet den Kern der Arbeit und präsentiert verschiedene Modelle der Spitzenlastpreisbildung, beginnend mit den Ansätzen von Boiteux und Steiner. Es werden die Grundannahmen, die Modelllogik und die Unterschiede zwischen kurz- und langfristigen Gleichgewichtslösungen unter konstanter und schwankender Nachfrage detailliert erläutert. Weiterhin werden Erweiterungen der klassischen Modelle, beispielsweise von Williamson, diskutiert, welche Aspekte wie ungleich lange Periodenabschnitte, unvollständig teilbare Anlagen und die Gewinnmaximierung einbeziehen. Der Exkurs zur optimalen Bereitstellung öffentlicher Güter verdeutlicht den Kontext und die Bedeutung der effizienten Ressourcenallokation.
4 Peak-Load-Pricing in der Praxis: Dieses Kapitel analysiert die praktische Umsetzung des Peak-Load-Pricing in ausgewählten Bereichen wie der Elektrizitätswirtschaft (am Beispiel von EDF und E.ON), dem Verkehrssektor (Singapur, Trondheim, Warnow-Projekt) und der Telekommunikationsbranche. Es vergleicht verschiedene Tarifsysteme und Road-Pricing-Konzepte und zeigt die Herausforderungen bei der Implementierung in der Realität auf.
Schlüsselwörter
Peak-Load-Pricing, natürliches Monopol, zyklisch schwankende Nachfrage, Kostenstrukturen, Preisgestaltung, Kapazitätsplanung, Elektrizitätswirtschaft, Verkehrssektor, Telekommunikationsbranche, ökonomische Effizienz, Modellbildung, Tarifsysteme, Road Pricing.
Häufig gestellte Fragen zum Dokument "Peak-Load-Pricing"
Was ist der Gegenstand dieses Dokuments?
Das Dokument befasst sich umfassend mit der Theorie und Praxis des Peak-Load-Pricing, einer Methode zur Preisgestaltung bei schwankender Nachfrage, insbesondere in natürlichen Monopolen. Es analysiert verschiedene Modelle der Spitzenlastpreisbildung und deren Anwendung in der Elektrizitätswirtschaft, dem Verkehrssektor und der Telekommunikationsbranche.
Welche Themen werden im Dokument behandelt?
Das Dokument behandelt die Eigenschaften natürlicher Monopole, verschiedene Modelle der Peak-Load-Pricing (z.B. von Boiteux, Steiner, Williamson), die optimale Bereitstellung öffentlicher Güter, die Umsetzung des Peak-Load-Pricing in der Praxis (mit Beispielen aus Frankreich und Deutschland in der Elektrizitätswirtschaft und aus Singapur und Trondheim im Verkehrssektor), sowie einen Vergleich verschiedener Tarifsysteme und Road-Pricing-Konzepte.
Welche Modelle der Spitzenlastpreisbildung werden vorgestellt?
Das Dokument beschreibt detailliert die Modelle von Boiteux (1949, 1960) und Steiner (1957) zur Spitzenlastpreisbildung, einschließlich der Unterscheidung zwischen kurz- und langfristigen Gleichgewichtslösungen unter konstanter und schwankender Nachfrage. Zusätzlich werden Erweiterungen der klassischen Modelle, insbesondere der Ansatz von Williamson (1966), mit Berücksichtigung ungleich langer Periodenabschnitte, unvollständig teilbarer Anlagen und Gewinnmaximierung, erläutert.
Welche Branchen werden als Anwendungsbeispiele für Peak-Load-Pricing genannt?
Das Dokument untersucht die Anwendung von Peak-Load-Pricing in der Elektrizitätswirtschaft (am Beispiel von EDF und E.ON), dem Verkehrssektor (mit Beispielen aus Singapur und Trondheim) und der Telekommunikationsbranche. Es werden konkrete Tarifsysteme und Road-Pricing-Konzepte analysiert und verglichen.
Was ist ein natürliches Monopol und welche Rolle spielt es im Zusammenhang mit Peak-Load-Pricing?
Ein natürliches Monopol ist durch subadditive Kostenfunktionen, Größenersparnisse und fallende Durchschnittskostenkurven gekennzeichnet. Die Analyse der Kostenstrukturen natürlicher Monopole bildet die Grundlage für die Betrachtung der optimalen Preisgestaltung unter schwankender Nachfrage, wie sie beim Peak-Load-Pricing relevant ist. Der Konflikt zwischen ökonomischer Effizienz und Eigenwirtschaftlichkeit wird ebenfalls beleuchtet.
Welche Herausforderungen werden bei der Umsetzung von Peak-Load-Pricing in der Praxis beschrieben?
Das Dokument beschreibt die Herausforderungen bei der Implementierung von Peak-Load-Pricing, die sich aus der schwankenden Nachfrage ergeben. Es werden Unterschiede zwischen theoretischen Modellen und der praktischen Umsetzung in verschiedenen Branchen aufgezeigt und anhand von Beispielen aus der Elektrizitätswirtschaft und dem Verkehrssektor illustriert.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt des Dokuments?
Schlüsselwörter sind: Peak-Load-Pricing, natürliches Monopol, zyklisch schwankende Nachfrage, Kostenstrukturen, Preisgestaltung, Kapazitätsplanung, Elektrizitätswirtschaft, Verkehrssektor, Telekommunikationsbranche, ökonomische Effizienz, Modellbildung, Tarifsysteme, Road Pricing.
- Quote paper
- Manuel Tschamler (Author), 2003, Zeitvariable Preise unter den Bedingungen einer zyklisch schwankenden Nachfrage – das Peak-Load-Pricing, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/88106