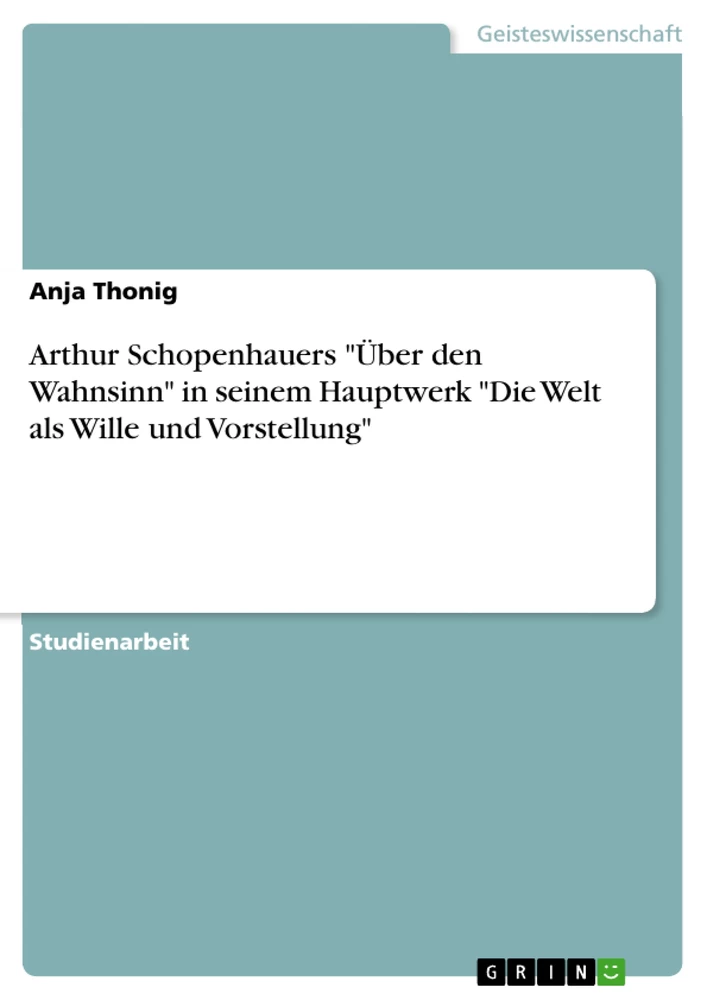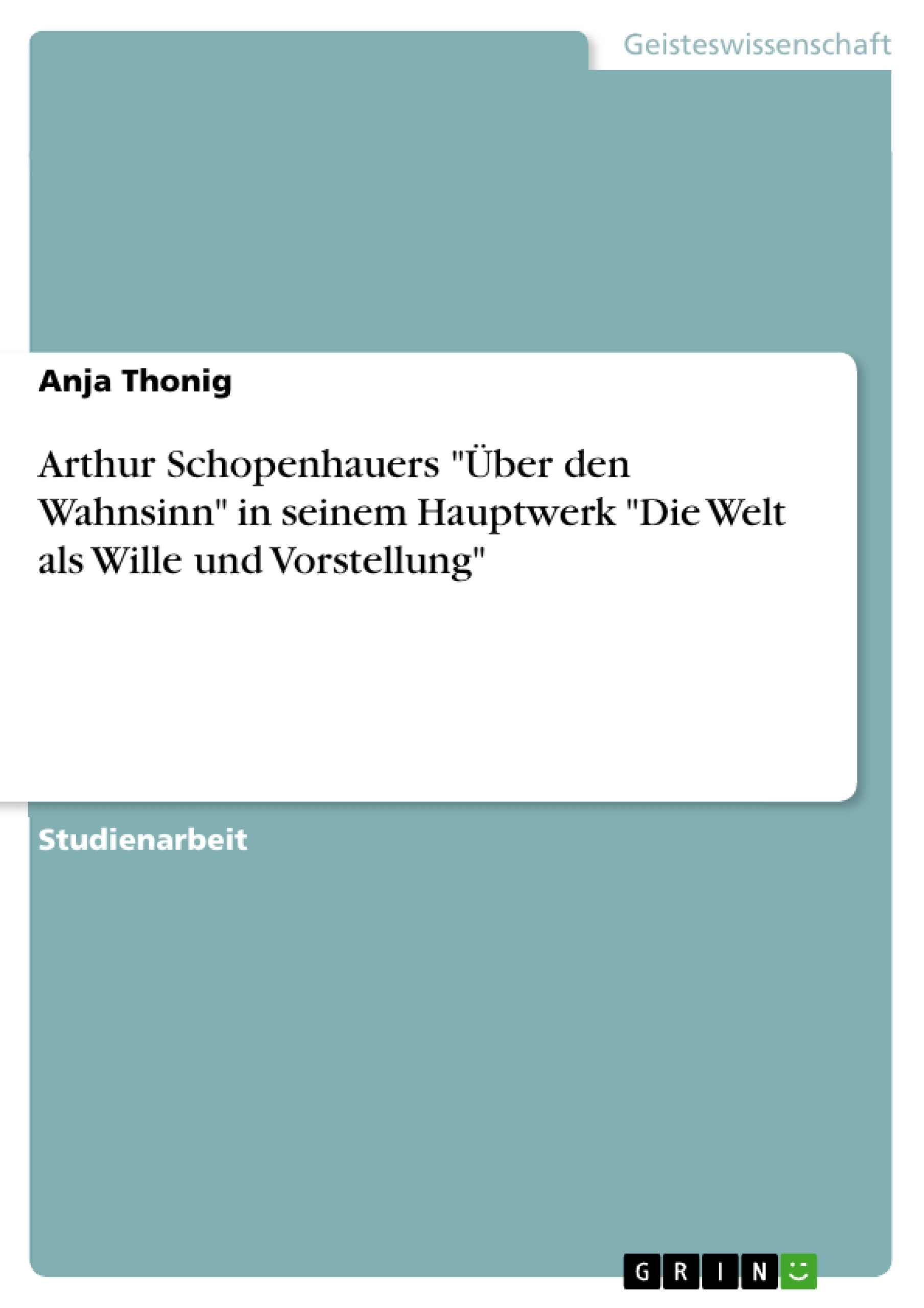Arthur Schopenhauer kann, nachdem seine Werke lange Zeit völlig unbeachtet geblieben waren, nicht als Repräsentant einer bestimmten gesellschaftlichen Front betrachtet werden. So muss sich zunächst, wenn seine Philosophie verstanden werden will, mit Schopenhauers Persönlichkeit beschäftigt werden und das nicht nur mit seinem äußeren Lebensweg, sondern vor allem mit seinem Charakter. Denn hier gilt Fichtes Wort, dass die Philosophie, die man betrachtet, davon abhängig ist, was für ein Mensch man ist.
Anschließend wird ausgehend von einigen grundlegenden Erläuterungen zu den wichtigsten Begrifflichkeiten Schopenhauers aus seinem Hauptwerk „Die Welt als Wille und Vorstellung“ auf die Abhandlung des zweiten Buches „Über den Wahnsinn“ eingegangen, seine Sichtweise näher ausgeführt und Zusammenhänge hergestellt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Persönlichkeit Schopenhauer
- Grundlegende Begrifflichkeiten
- Die Welt als Wille
- Objektität und Objektivation des Willens
- Die Idee
- Die Erkenntnis/ Das Erkennen
- „Über den Wahnsinn“
- Das Genie
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert Arthur Schopenhauers Abhandlung „Über den Wahnsinn“, die im zweiten Buch seines Hauptwerks „Die Welt als Wille und Vorstellung“ enthalten ist. Der Fokus liegt auf der Einordnung des Wahnsinns in Schopenhauers philosophisches System, wobei seine zentralen Begrifflichkeiten und seine Sichtweise auf die Welt als Wille und Vorstellung im Vordergrund stehen. Der Text zielt darauf ab, die Verbindung zwischen Schopenhauers Persönlichkeit und seinen philosophischen Überzeugungen aufzuzeigen und seine Sichtweise auf das Wesen des Wahnsinns zu beleuchten.
- Schopenhauers Leben und seine Persönlichkeit
- Die Welt als Wille und Vorstellung
- Die Rolle des Willens in der Entstehung von Wahnsinn
- Schopenhauers Sicht auf das Genie
- Die Bedeutung des Wahnsinns in Schopenhauers Philosophie
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beleuchtet Schopenhauers Persönlichkeit und stellt seine Philosophie im Kontext seiner Zeit vor. Es wird herausgestellt, dass seine Werke zunächst unbeachtet blieben und dass sein Werk erst nach dem Scheitern der Revolution von 1848 an Bedeutung gewann. Die Zusammenfassung geht auf Schopenhauers Leben und seine zentralen Ideen ein und stellt seine Sichtweise als einen pessimistischen Gegenpol zur damals dominierenden Philosophie Hegels dar.
Das zweite Kapitel befasst sich mit Schopenhauers grundlegenden Begrifflichkeiten. Hier wird das Konzept der „Welt als Wille“ erläutert, das zentrale Element seiner Philosophie. Schopenhauer argumentiert, dass die Welt nicht nur aus Erscheinungen besteht, sondern dass hinter diesen Erscheinungen ein blinder Wille wirkt, der als das eigentliche Wesen der Welt betrachtet werden muss. Der Wille strebt unaufhörlich nach Befriedigung und kann sich in vielfältigen Formen manifestieren, von der Natur bis zum menschlichen Verhalten.
Das dritte Kapitel befasst sich mit Schopenhauers Sicht auf das Genie. Schopenhauer argumentiert, dass Genies nicht nur außergewöhnliche Fähigkeiten besitzen, sondern auch von einem besonderen Grad an Willenskraft und Kreativität angetrieben werden. Genies können die Welt auf eine einzigartige Weise wahrnehmen und ihre Visionen durch ihre Werke realisieren.
Schlüsselwörter
Die Arbeit behandelt zentrale Themen wie die Philosophie Arthur Schopenhauers, insbesondere seine Abhandlung „Über den Wahnsinn“ aus seinem Hauptwerk „Die Welt als Wille und Vorstellung“. Schlüsselbegriffe sind: Wille, Vorstellung, Objektivation des Willens, Wahnsinn, Genie, Pessimismus, Philosophie der Kunst.
Häufig gestellte Fragen
Wie definiert Arthur Schopenhauer den Wahnsinn?
Schopenhauer behandelt Wahnsinn in seinem Hauptwerk als eine Störung der Erkenntnisfähigkeit, bei der der Wille die Oberhand über die vernünftige Vorstellung gewinnt.
Was bedeutet „Die Welt als Wille und Vorstellung“?
Es ist Schopenhauers Kernthese: Die Welt, wie wir sie wahrnehmen, ist nur Vorstellung, während ihr innerstes Wesen ein blinder, unaufhörlich strebender Wille ist.
Welcher Zusammenhang besteht zwischen dem „Genie“ und dem Wahnsinn?
Schopenhauer sieht eine Nähe zwischen beiden, da das Genie die Welt jenseits gewöhnlicher Kausalität wahrnimmt, was jedoch die Gefahr des Realitätsverlusts birgt.
Warum ist Schopenhauers Charakter wichtig für seine Philosophie?
Getreu Fichtes Wort glaubte Schopenhauer, dass die gewählte Philosophie vom Charakter des Menschen abhängt. Sein Pessimismus spiegelt seine eigene Persönlichkeit wider.
Welche Rolle spielt die Objektivation des Willens?
Die Objektivation beschreibt, wie sich der unsichtbare Wille in der sichtbaren Welt (Natur, Mensch, Kunst) manifestiert und erkennbar wird.
- Arbeit zitieren
- Anja Thonig (Autor:in), 2007, Arthur Schopenhauers "Über den Wahnsinn" in seinem Hauptwerk "Die Welt als Wille und Vorstellung", München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/88127