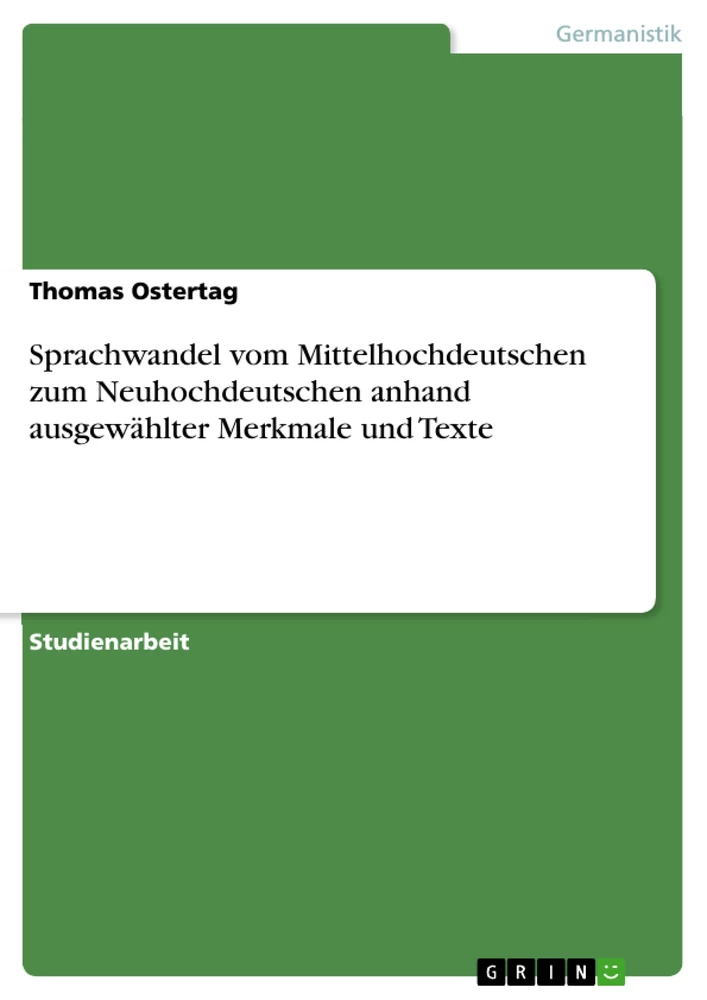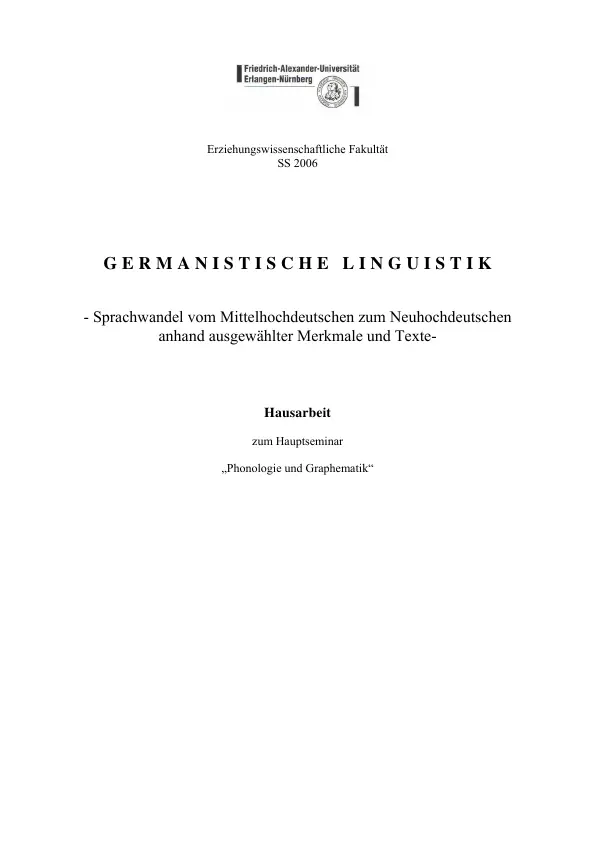1. Einleitung
„Wenn wir den Mund aufmachen, reden immer
Zehntausende Tote mit“
Dieses Zitat von Hugo von Hofmannsthal soll das historische Wachsen unserer Sprache deutlich machen. Viele Eigenschaften dieser Sprache haben sich im Verlauf der Geschichte grundlegend verändert, andere hingegen sind relativ stabil geblieben. Vorliegende Hausarbeit analysiert in diesem Kontext wichtige Aspekte des Sprachwandels der deutschen Sprache ausgehend vom Mittelhochdeutschen zum Neuhochdeutschen.
Das Mittelhochdeutsche war keine überregional einheitliche Sprache wie das Schriftneuhochdeutsche, sondern war ebenso wie das heute gesprochene Deutsch gekennzeichnet durch starke regionale bzw. dialektale Unterschiede. Auch eine einheitliche Orthografie gab es im Mittelalter noch nicht.
Doch warum ist es eigentlich wichtig, dieses Mittelhochdeutsch näher zu betrachten und den Sprachwandelzum heutigen Deutsch genauer zu untersuchen? Sind die Sprachzustände des Deutschen vor ca. 500 bis 1000 Jahren für den heutigen Sprachbenutzer denn nicht völlig uninteressant? Mögliche Antworten auf diese Fragen könnten lauten: Viele Phänomene des heutigen Schriftdeutsch erscheinen dem Sprachbenutzer unnötig kompliziert oder unsinnig. Es lassen sich jedoch viele dieser Erscheinungen nur erklären, wenn man historische Entwicklungen beobachtet und so tiefere Einblicke in dieses Sprachsystem gewinnt. Auch im sprachlichen Alltag wird oft über Sprache reflektiert, d.h. Menschen denken über die Mittel ihrer sprachlichen Kommunikation nach. Gerade im Bereich Wortbedeutung und Wortgeschichte lassen sich hierbei viele Phänomene nur durch sprachhistorische Zusammenhänge erklären. Darüber hinaus haben viele Sprachbenutzer ein Bedürfnis Einblicke in die Geschichte ihrer Sprache zu bekommen, denn z.B. Kultur und Identität von Menschen sind nicht zuletzt auch durch sprachgeschichtliche Entwicklungen zu erklären.
Im ersten Abschnitt meiner Hausarbeit gebe ich einen systematischen Überblick über ausgewählte Regeln, die sowohl den Laut- wie auch den Schreibwandel vom Mhd. zum Nhd. kennzeichnen. Der Schwerpunkt liegt hierbei auf all den grammatischen Erscheinungen, die im zweiten Teil dieser Arbeit anhand eines Textes näher beschrieben und erläutert werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Hauptteil
- Vokalveränderungen vom Mhd. zum Nhd.
- Nhd. Monophthongierung, nhd. Diphthongierung und nhd. Diphthongwandel
- Dehnung und Kürzung
- Rundung und Entrundung
- Apokope, Synkope und Elision
- Konsonantenveränderungen von Mhd. zum Nhd.
- Grammatischer Wechsel
- Assimilation
- Stimmtonverlust im Auslaut
- Mittelhochdeutsches
- Veränderungen von Mhd.
und - Veränderungen von Mhd.
und
- Veränderungen der Verben
- Die starken Verben
- Präterito Präsentien
- Sonstige Veränderungen
- Majuskulierung der Substantive
- Bezeichnung der Vokalquantität
- Das morphologische Prinzip im Neuhochdeutschen
- Analogieausgleich
- Analyse eines Mhd. Textes
- Walther von der Vogelweide „Kreuzigungsstrophe“
- Untersuchung des Laut- und Schreibwandels im Text
- Nhd. Übersetzung des Textes
- Vokalveränderungen vom Mhd. zum Nhd.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit wichtigen Aspekten des Sprachwandels vom Mittelhochdeutschen zum Neuhochdeutschen. Sie untersucht, wie sich die deutsche Sprache im Laufe der Geschichte verändert hat, welche grammatischen Erscheinungen dabei eine Rolle spielen und wie diese Veränderungen anhand eines Textes von Walther von der Vogelweide näher beschrieben und erläutert werden können.
- Der Wandel der Vokalstruktur vom Mittelhochdeutschen zum Neuhochdeutschen, einschließlich der Monophthongierung, Diphthongierung und Diphthongwandels
- Die Veränderungen der Konsonanten im Sprachsystem, zum Beispiel durch grammatischen Wechsel, Assimilation und Stimmtonverlust
- Die Entwicklung der Verben, insbesondere die starken Verben und Präterito Präsentien
- Weitere wichtige Veränderungen, wie die Majuskulierung der Substantive, die Kennzeichnung der Vokalquantität und das morphologische Prinzip im Neuhochdeutschen
- Die Analyse eines Textes von Walther von der Vogelweide, um die Laut- und Schreibwandel in einem konkreten Beispiel zu demonstrieren
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema Sprachwandel ein und erläutert die Bedeutung der Untersuchung des Mittelhochdeutschen für das Verständnis der heutigen deutschen Sprache. Sie stellt die Ziele der Hausarbeit dar und gibt einen Überblick über die Struktur der Arbeit.
Der Hauptteil beleuchtet wichtige Aspekte des Sprachwandels, beginnend mit den Vokalveränderungen. Hier werden Phänomene wie Monophthongierung, Diphthongierung, Dehnung und Kürzung, sowie Rundung und Entrundung näher betrachtet. Anschließend werden die Konsonantenveränderungen untersucht, einschließlich grammatischer Wechsel, Assimilation, Stimmtonverlust und Veränderungen von und
Die Analyse eines Textes von Walther von der Vogelweide dient als praktisches Beispiel zur Veranschaulichung des Laut- und Schreibwandels. Der Text wird in seinen sprachlichen Besonderheiten untersucht und mit einer Neuhochdeutschen Übersetzung verglichen.
Schlüsselwörter
Die zentralen Themen der Arbeit sind der Sprachwandel vom Mittelhochdeutschen zum Neuhochdeutschen, die Analyse von Laut- und Schreibwandel, die Untersuchung grammatischer Erscheinungen, die Veränderungen der Vokale und Konsonanten, die Entwicklung der Verben, die Analyse eines Textes von Walther von der Vogelweide und die Veranschaulichung der sprachlichen Veränderungen durch konkrete Beispiele.
- Quote paper
- Thomas Ostertag (Author), 2006, Sprachwandel vom Mittelhochdeutschen zum Neuhochdeutschen anhand ausgewählter Merkmale und Texte, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/88188