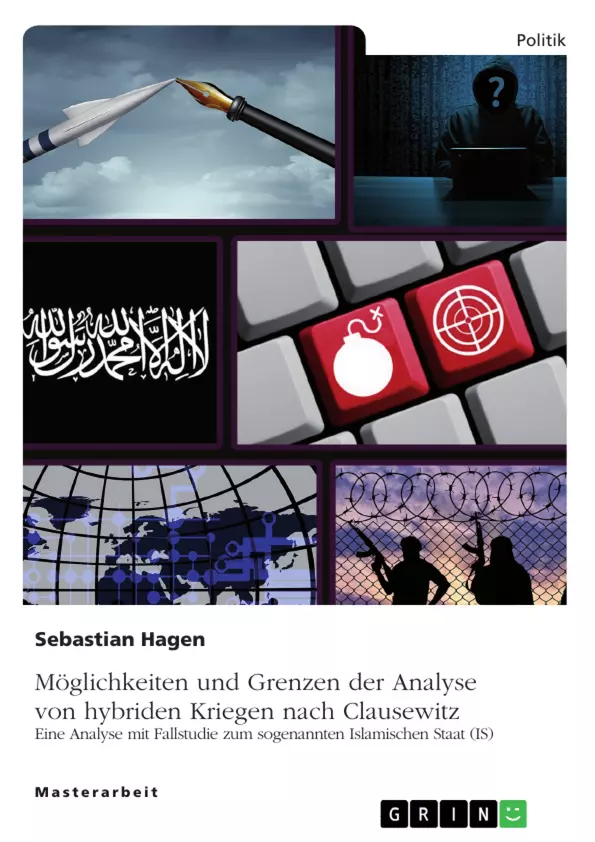Über kaum einen Militärtheoretiker ist in der Vergangenheit mehr geschrieben worden als über Carl von Clausewitz. Van Creveld, Paret und viele mehr haben versucht, die Clausewitz-Theorie zu erklären und zu beurteilen. Dabei waren die Einschätzungen – vor allem jene über die Aktualität und Gültigkeit seiner Theorie in Gegenwart und Zukunft – einem ständigem Auf und Ab unterworfen. Dies hat zum einen mit der Komplexität des Werkes Vom Kriege zu tun, das zwar als inhaltlich abgeschlossen betrachtet werden kann, jedoch von Clausewitz abschließend nicht ‚geordnet‘ werden konnte. Dies gestaltet den geistigen Zugang schwieriger. Hinzu kommt eine deutlich ins Philosophische ragende Sprache und Gedankenwelt, die zweifellos Clausewitz’ Nähe zur Gedankenwelt der Philosophen seiner Tage Rechnung trägt. Zum anderen wird gerade in Deutschland die Diskussion über Strategie seit dem Ende der Kriege des 20. Jahrhunderts nicht in der breiten Öffentlichkeit geführt. Selbst innerhalb des Militärs werden die Thesen des Carl von Clausewitz allzu häufig auf die operative Ebene beschränkt. Diese Sichtweise wird ihm jedoch nicht gerecht; sie verzerrt auch den wesentlichen Kern seiner Theorie, in der er sich mit dem Wesen des Krieges an sich beschäftigt. Dabei adressiert er nicht die operative oder taktische Ebene. Er richtet sich vielmehr an strategische Entscheidungsträger.
Zweifelsfrei haben sich die Formen und Arten von Kriegen in der Geschichte gewandelt. Aktuell ist häufig von hybrider Kriegführung und ‚Gray-Zone-Areas‘ die Rede, beispielsweise wenn es um die Beschreibung des russischen Vorgehens auf der Krim und in der Ostukraine oder eine mögliche Bedrohung des Baltikums geht.
Kann jedoch, zumal sich die Clausewitz-Theorie mit dem Wesen des Krieges an sich beschäftigt, postuliert werden, dass ihre Inhalte als zeitlos gelten? Und wenn ja, wie können sie in heutigen Konflikten genutzt werden?
Unter Berücksichtigung dieser grundsätzlichen Frage verfolgt die vorliegende Arbeit das Ziel, die Möglichkeiten und Grenzen der Clausewitz-Strategie zur Analyse von hybriden Kriegen zu analysieren.
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG
- 1. DIE THEORIE DES CARL VON CLAUSEWITZ.
- 1.1. DIE WUNDERLICHE DREIFALTIGKEIT
- 1.2. DIE ZWECK-ZIEL-MITTEL-RELATION
- 1.3. FRIKTIONEN, WAHRSCHEINLICHKEITEN, ZUFÄLLE.
- 2. CLAUSEWITZ' THEORIE ALS INSTRUMENTARIUM.
- 3. ZWISCHENFAZIT
- 4. AKTUELLE KONFLIKTE: HYBRIDE KRIEGE UND GRAY-ZONE-AREAS...
- 4.1. DEFINITION UND WESEN
- 4.2. DIE ANWENDBARKEIT DER CLAUSEWITZ-THEORIE
- 5. FALLSTUDIE ZUM,ISLAMISCHEN STAAT' (IS) ……………….………..\n
- 5.1. DER ISLAMISCHE STAAT ALS AKTEUR...
- 5.2. ANWENDUNG DES CLAUSEWITZ-INSTRUMENTARIUMS AUF DEN IS
- 6. FAZIT.....
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Relevanz der Clausewitz-Theorie für die Analyse von modernen Konflikten, insbesondere sogenannten "hybriden Kriegen". Sie untersucht, ob und wie die Theorie des Carl von Clausewitz auf aktuelle Konfliktformen angewendet werden kann. Dazu werden die wichtigsten Elemente der Clausewitz-Theorie, wie die "wunderliche Dreifaltigkeit", die "Zweck-Ziel-Mittel-Relation" und "Friktionen, Wahrscheinlichkeiten und Zufälle", definiert und in ein Instrumentarium zur praktischen Anwendung überführt. Dieses Instrumentarium wird anschließend in einer Fallstudie zum "Islamischen Staat" (IS) erprobt. Die Arbeit zielt darauf ab, sowohl die Möglichkeiten als auch die Grenzen der Clausewitz-Theorie in der Analyse von modernen Konflikten aufzuzeigen.
- Die Relevanz der Clausewitz-Theorie für die Analyse moderner Konflikte
- Die Anwendung der Clausewitz-Theorie auf sogenannte "hybride Kriege"
- Die Entwicklung eines Instrumentariums zur praktischen Anwendung der Clausewitz-Theorie
- Die Analyse des "Islamischen Staates" (IS) mithilfe des entwickelten Instrumentariums
- Die Möglichkeiten und Grenzen der Clausewitz-Theorie in der Analyse moderner Konflikte
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einführung in die Clausewitz-Theorie und deren Bedeutung für das Verständnis moderner Konflikte. Sie untersucht die drei zentralen Elemente der Theorie, nämlich die "wunderliche Dreifaltigkeit", die "Zweck-Ziel-Mittel-Relation" sowie die Bedeutung von "Friktionen, Wahrscheinlichkeiten und Zufällen". Ausgehend von diesen Elementen entwickelt die Arbeit ein Instrumentarium zur praktischen Anwendung der Theorie. Dieses Instrumentarium wird anschließend auf die aktuelle Konfliktform der "hybriden Kriege" und "Gray-Zone-Areas" angewendet. Die Arbeit gipfelt in einer Fallstudie zum "Islamischen Staat" (IS), in der das Instrumentarium zur Analyse des IS als Akteur eingesetzt wird.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter dieser Arbeit sind: Clausewitz, Kriegstheorie, hybride Kriege, Gray-Zone-Areas, "wunderliche Dreifaltigkeit", Zweck-Ziel-Mittel-Relation, Friktionen, Wahrscheinlichkeiten, Zufälle, Islamischer Staat (IS), strategisches Handeln.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht Clausewitz unter der "wunderlichen Dreifaltigkeit"?
Sie besteht aus den drei Elementen: dem ursprünglichen Hass (Gewalt), dem Spiel der Wahrscheinlichkeiten (Zufall) und der Unterordnung unter die Politik (Vernunft).
Ist die Clausewitz-Theorie heute noch aktuell?
Ja, die Arbeit argumentiert, dass seine Theorie zum Wesen des Krieges zeitlos ist und auch zur Analyse moderner hybrider Kriege genutzt werden kann.
Was kennzeichnet "hybride Kriege"?
Hybride Kriege zeichnen sich durch eine Vermischung von regulären und irregulären Kampfmitteln, Desinformation und Operationen in "Gray-Zone-Areas" aus.
Wie wird der 'Islamische Staat' (IS) in der Arbeit analysiert?
Der IS dient als Fallstudie, um das Clausewitz-Instrumentarium auf einen modernen, nicht-staatlichen Akteur anzuwenden.
Was bedeutet "Friktion" in der Kriegstheorie?
Friktion bezeichnet die unvorhersehbaren Schwierigkeiten und Zufälle, die im Krieg selbst einfache Dinge kompliziert machen und die Planung erschweren.
- Citar trabajo
- Sebastian Hagen (Autor), 2018, Möglichkeiten und Grenzen der Analyse von hybriden Kriegen nach Clausewitz, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/882440