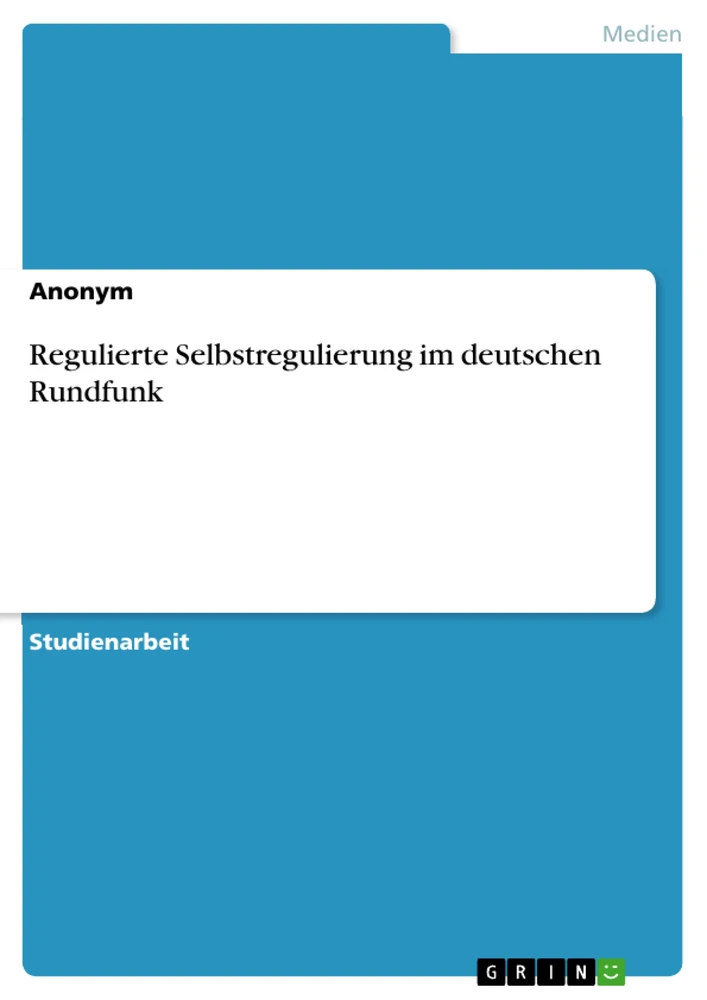Auch im 21. Jahrhundert ist die Gesellschaft einem stetigen Wandel unterworfen. Ob im Bereich der Politik, der Wirtschaft oder der Medien – eine Anpassung an die neuen Gegebenheiten stellt sich als teilweise schwer durchsetzbare Notwendigkeit dar. Am Beispiel des deutschen Rundfunksystems wird im Folgenden die Regulierte Selbstregulierung als ein flexibles bedingt staatsfernes Steuerungssystem vorgestellt, welches dem gesellschaftlichen Wandel gerecht werden soll.
Gemäß des §2 S.1 im Rundfunkstaatsvertrag ist Rundfunk „ein linearer Informations- und Kommunikationsdienst. [Er] ist die für die Allgemeinheit und zum zeitgleichen Empfang bestimmte Veranstaltung und Verbreitung von Angeboten in Bewegtbild oder Ton entlang eines Sendeplans unter Benutzung elektromagnetischer Schwingungen“ (Vgl. §2 Abs.2 RStV).
Der Begriff „elektromagnetische Schwingungen“ stammt aus der analogen Verbreitungsform und schließt auch digitale Verbreitung ein. Hörfunk und Fernsehen als technisch basierte Zeichensysteme wurden somit durch ihre Bereitstellung von Ton und Bild im Rundfunkstaatsvertrag definiert und eingeschlossen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Klärung der Begriffe
- 2.1 Definition Rundfunk
- 2.2 Duales Rundfunksystem
- 2.2.1 Öffentlich-rechtlicher Rundfunk
- 2.2.2 Privat-rechtlicher Rundfunk
- 2.3 Abgrenzung und Definition der „Regulierten Selbstregulierung“
- 2.3.1 Hoheitliche Regulierung
- 2.3.2 Freiwillige Selbstregulierung
- 2.3.3 Regulierte Selbstregulierung
- 3. Regulierte Selbstregulierung im deutschen Rundfunk
- 3.1 Steuerungskrise des Staates
- 3.2 Regulierungsziele
- 3.3 Staatliche Rahmensetzung
- 3.4 Regulierte Selbstregulierung im öffentlich-rechtlichen Rundfunk
- 3.5 Regulierte Selbstregulierung im privat-rechtlichen Rundfunk
- 4. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Regulierte Selbstregulierung im deutschen Rundfunksystem als Antwort auf die Herausforderungen des gesellschaftlichen Wandels. Sie analysiert die Funktionsweise dieses Systems und beleuchtet seine Vor- und Nachteile im Kontext der Medienlandschaft.
- Definition und Abgrenzung verschiedener Regulierungsformen (hoheitlich, freiwillig, reguliert)
- Das duale Rundfunksystem in Deutschland (öffentlich-rechtlich vs. privat-rechtlich)
- Die Rolle des Staates in der Regulierten Selbstregulierung
- Die Ziele und Herausforderungen der Regulierten Selbstregulierung im Rundfunk
- Die Funktionsweise der Regulierten Selbstregulierung in der Praxis
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Regulierten Selbstregulierung im deutschen Rundfunk ein und beschreibt den Kontext des gesellschaftlichen Wandels und die Notwendigkeit eines flexiblen Steuerungssystems. Sie legt den Fokus auf die Anpassungsfähigkeit des Systems an neue Gegebenheiten.
2. Klärung der Begriffe: Dieses Kapitel liefert präzise Definitionen zentraler Begriffe. Es beginnt mit der Definition von Rundfunk gemäß des Rundfunkstaatsvertrags, unterscheidet zwischen öffentlich-rechtlichem und privat-rechtlichem Rundfunk im dualen System, und beschreibt die Unterschiede zwischen hoheitlicher Regulierung, freiwilliger Selbstregulierung und der regulierten Selbstregulierung als Fokus der Arbeit. Die Bedeutung der Medienvielfalt und der jeweiligen Funktionsweisen der beiden Rundfunksysteme wird ausführlich erläutert. Der Abschnitt veranschaulicht die unterschiedlichen Organisationsstrukturen und Finanzierungsmodelle beider Systeme sowie deren jeweilige Relevanz für die Medienlandschaft.
3. Regulierte Selbstregulierung im deutschen Rundfunk: Dieses Kapitel untersucht die Regulierte Selbstregulierung im deutschen Rundfunk. Es beginnt mit der Darstellung der "Steuerungskrise des Staates" und der daraus resultierenden Notwendigkeit neuer Regulierungsansätze. Die Regulierungsziele werden erläutert, und die Rolle des Staates als Anbieter eines "regulativen Rahmens" für die Selbstregulierung der Medienunternehmen wird im Detail beschrieben. Der Abschnitt analysiert die Anwendung der Regulierten Selbstregulierung im öffentlich-rechtlichen und privat-rechtlichen Rundfunk, inklusive der beteiligten Institutionen und deren Funktionen. Die jeweiligen Aufgaben und Verantwortlichkeiten der Institutionen werden im Detail erläutert, und es wird dargestellt, wie diese Institutionen zur Erreichung der Regulierungsziele beitragen.
FAQ: Regulierte Selbstregulierung im deutschen Rundfunk
Was ist der Inhalt dieses Dokuments?
Dieses Dokument bietet eine umfassende Vorschau auf eine Arbeit über die Regulierten Selbstregulierung im deutschen Rundfunksystem. Es beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und die Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und wichtige Stichwörter. Der Fokus liegt auf der Analyse der Funktionsweise dieses Systems und der Bewertung seiner Vor- und Nachteile im Kontext des gesellschaftlichen Wandels.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in vier Kapitel: 1. Einleitung, 2. Klärung der Begriffe, 3. Regulierte Selbstregulierung im deutschen Rundfunk und 4. Fazit. Kapitel 2 definiert wichtige Begriffe wie Rundfunk, das duale Rundfunksystem (öffentlich-rechtlich und privat-rechtlich) und die verschiedenen Regulierungsformen (hoheitlich, freiwillig, reguliert). Kapitel 3 analysiert die Regulierte Selbstregulierung im Detail, einschließlich der Rolle des Staates, der Regulierungsziele und der Funktionsweise in beiden Rundfunksystemen.
Was sind die Zielsetzung und die Themenschwerpunkte der Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Regulierte Selbstregulierung als Reaktion auf den gesellschaftlichen Wandel. Sie analysiert die Funktionsweise dieses Systems und beleuchtet seine Vor- und Nachteile. Wichtige Themen sind die Definition und Abgrenzung verschiedener Regulierungsformen, das duale Rundfunksystem in Deutschland, die Rolle des Staates, die Ziele und Herausforderungen der Regulierten Selbstregulierung und ihre praktische Funktionsweise.
Wie wird das duale Rundfunksystem in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit beschreibt ausführlich das deutsche duale Rundfunksystem, unterscheidet zwischen öffentlich-rechtlichem und privat-rechtlichem Rundfunk und erläutert die unterschiedlichen Organisationsstrukturen, Finanzierungsmodelle und Relevanz für die Medienlandschaft. Die Unterschiede in der Anwendung der Regulierten Selbstregulierung in beiden Systemen werden ebenfalls analysiert.
Welche Rolle spielt der Staat in der Regulierten Selbstregulierung?
Die Arbeit analysiert die Rolle des Staates als Anbieter eines „regulativen Rahmens“ für die Selbstregulierung der Medienunternehmen. Sie beleuchtet die „Steuerungskrise des Staates“ und die daraus resultierende Notwendigkeit neuer Regulierungsansätze. Die staatliche Rahmensetzung und die Interaktion zwischen staatlicher Regulierung und Selbstregulierung werden detailliert untersucht.
Welche Arten der Regulierung werden unterschieden?
Die Arbeit unterscheidet zwischen hoheitlicher Regulierung, freiwilliger Selbstregulierung und regulierter Selbstregulierung. Sie definiert diese Begriffe präzise und beschreibt ihre jeweiligen Merkmale und Unterschiede im Kontext des deutschen Rundfunksystems.
Was sind die zentralen Ergebnisse der Arbeit (laut Zusammenfassung)?
Die Arbeit zeigt die Funktionsweise der Regulierten Selbstregulierung im deutschen Rundfunk auf, beleuchtet die Herausforderungen des gesellschaftlichen Wandels und die Notwendigkeit eines flexiblen Steuerungssystems. Sie analysiert die Anwendung der Regulierten Selbstregulierung im öffentlich-rechtlichen und privat-rechtlichen Rundfunk und beschreibt die beteiligten Institutionen und deren Funktionen. Die Anpassungsfähigkeit des Systems an neue Gegebenheiten wird hervorgehoben.
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2020, Regulierte Selbstregulierung im deutschen Rundfunk, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/882583