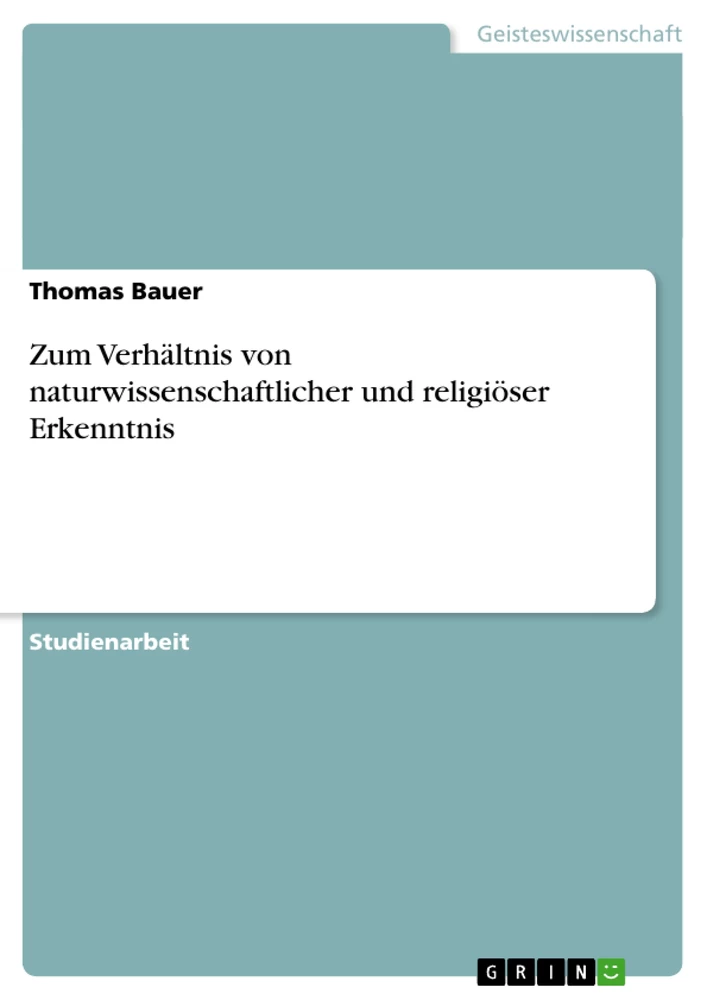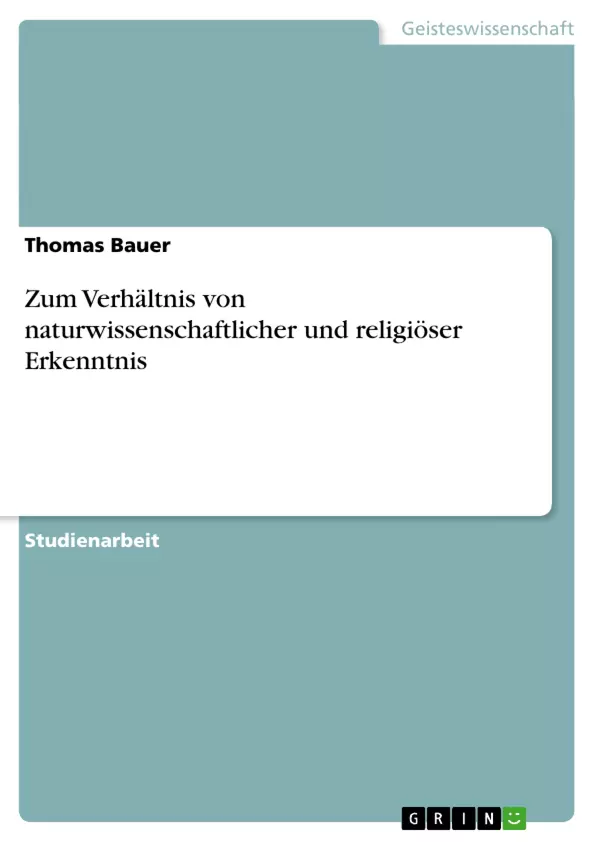„Der christliche Glaube beruht also nicht auf Poesie und Politik, diesen beiden Quellen der Religion; er beruht auf Erkenntnis.“ Den meisten Naturwissenschaftlern wird diese Aussage von Kardinal Ratzinger, heute Papst Benedikt XVI. nur ein müdes Lächeln abringen. Kann ein religiöses System überhaupt Erkenntnis haben? Was bedeutet ‚Erkenntnis’ überhaupt? Es ist doch alles relativ, lehrt uns Einstein. Und wenn wir heute den Pluralismus der Religionen sehen, dann kann man doch nicht ernsthaft behaupten, dass eine Religion, respektive das Christentum auf Erkenntnis beruht, die mit der Erkenntnis von Naturwissenschaftlern gleich zu setzten sei!
Bei einen flüchtigen Blick in die Geschichte kann man den Eindruck bekommen, dass seit der Zeit der Aufklärung Naturwissenschaft und Glaube unversöhnlich nebeneinander stehen. Die Verurteilung Galileo Galileis durch die Inquisition gilt bis heute als Paradebeispiel der Wissenschaftsfeindlichkeit der katholischen Kirche. Viele Menschen, ob gläubiger Christ, Atheist oder Naturwissenschaftler wollen mit diesem Verweis auf Galileo zeigen, dass Religion und Naturwissenschaft nicht zusammenpassen. War es doch der Glaube, der die Erkenntnisse von Galileo unterdrückte und sogar verurteilte. In dieser Arbeit kann hier leider nicht näher auf den Fall Galileo eingegangen werden. Angemerkt sei hier nur, dass es sich lohnt, einen näheren Blick in die Geschichtsforschung zu diesem Thema zu werfen. Viele Vorurteile würden damit beseitigt werden.
Zweifelsohne gibt es Unterschiede in der Methode und der Art und Weise wie Naturwissenschaft und Glaube zu Erkenntnissen kommen. In der vorliegenden Arbeit möchte ich diesen unterschiedlichen Methoden nachgehen, und versuchen herauszustellen, ob und inwieweit diese zu vereinbaren sind.
In einem ersten Kapitel werden zu erst unterschiedliche Begriffe geklärt um, mit diesen Begriffen im zweiten Kapitel zu fragen, wie wir Menschen Erkenntnis betreiben und welche Unterschiede zwischen naturwissenschaftlicher und religiöser Erkenntnis bestehen.
Werner Heisenberg sagte einmal: „Wirkliches Neuland in einer Wissenschaft kann wohl nur gewonnen werden, wenn man an einer entscheidenden Stelle bereit ist, den Grund zu verlassen, auf dem die bisherige Wissenschaft ruht, und gewissermaßen ins Leere zu springen.“ Getreu diesem Motto möchte ich den bisherigen Grund ein wenig verlassen um die Frage nach der Erkenntnis und der Wahrheit im Hinblick auf das Wissen der Relativitätstheorie hin bearbeiten.
Inhaltsverzeichnis
- ,,Begriffsklärung“
- Das Naturgesetz
- Exkurs: Operationalisierbarkeit
- Wie und was können wir erkennen?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Frage des Verhältnisses von naturwissenschaftlicher und religiöser Erkenntnis. Sie untersucht, ob und inwiefern die unterschiedlichen Methoden beider Bereiche vereinbar sind.
- Die Definition von zentralen Begriffen wie "Wissen", "Erkennen", "Verstehen" und "Erklären"
- Die Untersuchung der unterschiedlichen Methoden der Erkenntnisgewinnung in Naturwissenschaften und Religion
- Die Frage nach der Gültigkeit und Grenzen von naturwissenschaftlicher und religiöser Erkenntnis
- Die Einordnung der Relativitätstheorie in den Diskurs über Erkenntnis und Wahrheit
- Die Diskussion um den Einfluss von Subjektivität und Objektivität auf den Erkenntnisprozess
Zusammenfassung der Kapitel
- ,,Begriffsklärung“: In diesem Kapitel werden wichtige Begriffe wie "Wissen", "Erkennen", "Verstehen" und "Erklären" geklärt, um eine gemeinsame Grundlage für die weitere Analyse zu schaffen. Dabei wird auf die unterschiedlichen Bedeutungen dieser Begriffe in der Umgangssprache, der Philosophie und den Wissenschaften eingegangen.
- Das Naturgesetz: In diesem Kapitel wird der Begriff des Naturgesetzes aus philosophischer Perspektive beleuchtet. Es wird untersucht, wie sich der Begriff des Naturgesetzes im Laufe der Geschichte entwickelt hat und welche unterschiedlichen Auffassungen darüber bestehen. Die Rolle der Beobachtung, der Induktion und der Notwendigkeit in der Naturwissenschaft wird dabei diskutiert.
- Exkurs: Operationalisierbarkeit: Dieser Exkurs befasst sich mit dem Problem der Operationalisierbarkeit in der Naturwissenschaft. Es wird der logische Positivismus von Auguste Comte und Rudolph Carnap vorgestellt, der die Erkenntnis von nicht beobachtbaren Dingen ablehnt.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Themen Erkenntnistheorie, Naturwissenschaften, Religion, Wissen, Erkennen, Verstehen, Erklären, Naturgesetz, Operationalisierbarkeit, Subjektivität, Objektivität, Relativitätstheorie. Die Arbeit greift auf zentrale Konzepte der Philosophie, insbesondere der Kant'schen Erkenntnistheorie, zurück.
Häufig gestellte Fragen
Können Religion und Naturwissenschaft denselben Anspruch auf Erkenntnis erheben?
Die Arbeit untersucht, ob religiöse Systeme echte Erkenntnis liefern können oder ob dieser Begriff ausschließlich den Naturwissenschaften vorbehalten ist. Dabei werden Methoden und Wahrheitsansprüche verglichen.
Was ist der Unterschied zwischen „Erklären“ und „Verstehen“?
In der Begriffsklärung wird differenziert, dass Naturwissenschaften oft Phänomene „erklären“ (Ursache-Wirkung), während Religion und Philosophie eher auf das „Verstehen“ von Sinnzusammenhängen abzielen.
Welche Rolle spielen Naturgesetze in der Erkenntnistheorie?
Naturgesetze werden als philosophische Konstrukte analysiert, die auf Beobachtung und Induktion basieren, aber auch Grenzen in ihrer absoluten Gültigkeit haben.
Was bedeutet Operationalisierbarkeit in der Wissenschaft?
Operationalisierbarkeit bezieht sich auf die Messbarkeit von Phänomenen. Der logische Positivismus lehnt Erkenntnisse ab, die nicht direkt beobachtbar oder messbar sind, was einen Konflikt zur religiösen Erkenntnis darstellt.
Wie beeinflusst die Relativitätstheorie die Frage nach der Wahrheit?
Werner Heisenbergs Zitat verdeutlicht, dass wissenschaftlicher Fortschritt oft einen „Sprung ins Leere“ erfordert, was Parallelen zum religiösen Glauben aufweist und die Vorstellung einer rein objektiven Wahrheit relativiert.
- Quote paper
- Thomas Bauer (Author), 2008, Zum Verhältnis von naturwissenschaftlicher und religiöser Erkenntnis, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/88263